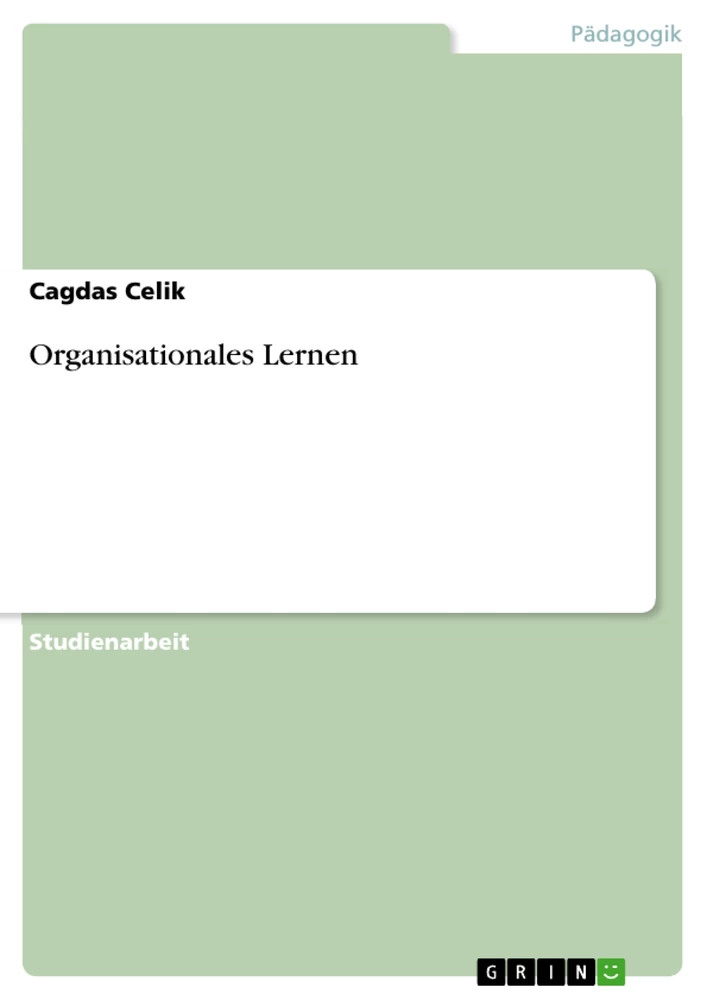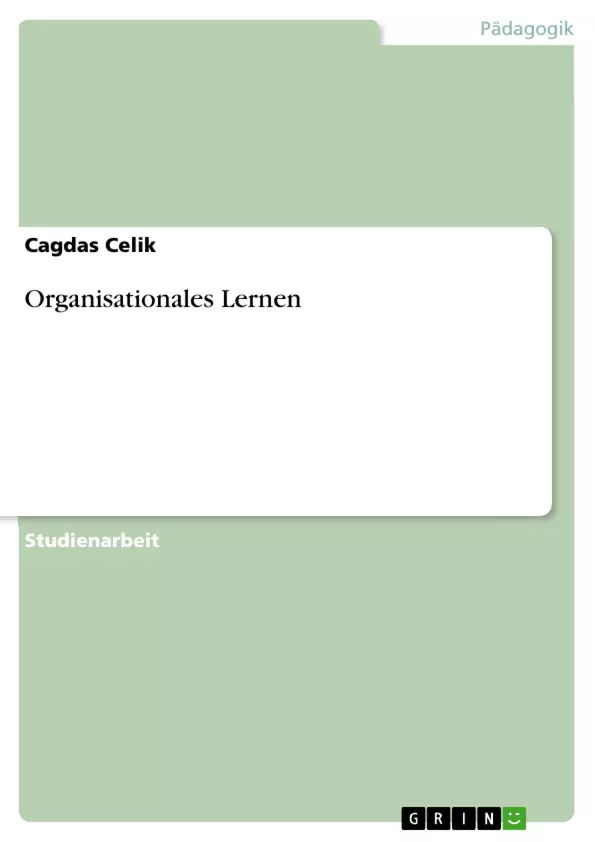Vom allgemeinen Lernbegriff zum „organisationalen Lernen". Der Begriff des „Lernens“ zählt zu den Grundbegriffen der Pädagogik/Erziehungswissenschaft und beschreibt den Erwerb von nicht angeborenen Weltorientierungen und Handlungs- bzw. Verhaltungsmöglichkeiten. Der Mensch wird als ein weltoffenes Wesen betrachtet, welches von Natur aus auf Erfahrung
und Lernen angewiesen ist. Diese muss „lernen“ sich in der Welt zu orientieren und die für sein Leben nötigen Verhaltensregeln erwerben. Erziehung wäre also ohne Lernen unvorstellbar.
Inhalt
1. Vom allgemeinen Lernbegriff zum „organisationalen Lernen“
2. Unterrichtsvorschlag:
3. Wie kann man es erforschen?
4. Literaturverzeichnis
1. Vom allgemeinen Lernbegriff zum „organisationalen Lernen“
Der Begriff des „Lernens“ zählt zu den Grundbegriffen der Pädagogik/ Erziehungswissenschaft (vgl. Steindorf 1995) und beschreibt den Erwerb von nicht angeborenen Weltorientierungen und Handlungs- bzw. Verhaltungsmöglichkeiten.
Der Mensch wird als ein weltoffenes Wesen betrachtet, welches von Natur aus auf Erfahrung und Lernen angewiesen ist. Diese muss „lernen“ sich in der Welt zu orientieren und die für sein Leben nötigen Verhaltensregeln erwerben. Erziehung wäre also ohne Lernen unvorstellbar. (vgl. Steindorf 1985)
Zu Beginn des Lernvorganges steht das „Sich- Öffnen“, um das Neue und Unvertraute ins Bewusstsein aufnehmen zu können, im Vordergrund. Jedoch ist hierfür auch die gewisse Aufnahmebereitschaft und Aufmerksamkeit wichtig. „Gelernt“ ist dann, wenn das Aufgenommene durch Wiederholung ins Gedächtnis eingeprägt wird; erst was nicht nur rezipiert, sondern auch memoriert ist, gilt als gelernt. (GRZESIK 1992)
In den Theorien wird „Lernen“ als Selbstverständnis der Gesellschaft angesehen. Hierbei wird der Lerner als autopoietisches System bevorzugt. Es gilt die Taktik des Selbstmanagers, der selbstorganisierte Lerner. (MEYER-DRAWE; SCHRATZ 2012)
Wir haben bis jetzt ständig vom Lernen von Individuen gehört. Sei es nun ein Mensch, ein Organismus, ein Lebewesen es ging um den Einzelnen, den Lernenden. Doch unser Lernen geht darüber hinaus. Es geht um das Lernen, Anwenden und Aneignen von Wissen als Ganzes und erst wenn eine Veränderung in diesen Aspekten stattgefunden hat, kann man vom „organisationalen Lernen“ reden. Der Begriff Körper kann hier beliebig gefüllt werden, die Anzahl der Menschen und ihrer Eigenschaften können beliebig sein, doch muss ein bestimmtes Modell zustande kommen, damit man solch ein Lernen erzielen kann.
Das Modell ist ein behavioristisches Model was bedeutet.
Der behavioristisch- assoziationistische Ansatz übergeht den Zusammenhang zwischen Lernen und Erkenntnis, kognitive Lerntheorien sprechen zwar von Erkenntnis, ignorieren jedoch das erkenntniskonstitutive Merkmal des Wahrheitsbezuges. (BUCK 1989)
Es gibt vier Funktionen oder Voraussetzungen die erfüllt werden müssen um solch ein Lernen erzielen zu können.
Vier Phasen des idealen Kreislaufs:
- Problem formulieren
- individuelles Handeln an einer Entscheidung
- Führt zu organisationalen Handeln
- Wahrnehmung der Reaktion
Zu Beginn ist es wichtig, dass die Individuen sich im Klaren sind, dass sie etwas Gemeinsames haben, nämlich ein gewisses Problem oder eine Sache die in der Realität nicht dem entspricht was man sich erdenken mag. Ist dies vorhanden so ist es von Nöten, dass der im Körper vorhandenen Individuen dazu Handeln am Entscheidungsprozess um dagegenzuwirken. Jede Einzelne sieht sich als ein Körper, ein kollektiver, überindividuelle Körper, dass ein Ziel vor Augen hat und ein Erstreben hat.
Es ist wichtig, dass man beim Auftauchen von Problemsituationen gemeinsam gegen diese vorgeht! Dies wird in der gemeinsamen Definition von Argyris und Schön verdeutlicht. (Argyris/ Schön 1999: S. 31f., Hervorh. M.G.)
Da wir ständig im Wandeln sind, begegnen wir auch immer Veränderungen und manchmal sogar auch Fehler. Diese Fehler werden zumeist Entdeckt – Korrigiert – und es werden Lösungen generiert. Fehler werden nicht nur vertuscht sondern als Hinweis genommen um etwas zu erlernen. Hierbei werden zwei Faktoren postuliert, wie man etwas lernen kann: einerseits durch bewußte oder durch unbewußte Erfahrung. (vgl. Buck 1967, Meyer- Drawe 2003)
Der Ausdifferenzierung des Lernens in Wissen-, Können-, Leben- und Lernen- Lernen (Göhlich 2001, S. 232 ff., vgl. Göhlich/Wulf/Zirfas im vorliegenden Band) folgend, läßt sich auch organisationales Lernen vielschichtig präzisieren:
1) Wissen- Lernen: körperliche und soziale Dinge werden lernbar sachlich gemacht
2) Können- Lernen: verkörperlichte Handlungsfähigkeit
3) Leben- Lernen: Flexibilisierung und Pluralisierung von Lebenspraxis muss als biographische Integration erlernt werden.
4) Lernen- Lernen: beinhaltet alle Aspekte die zuvor genannt wurden und läuft im jeglichen Lernen mit.
2. Unterrichtsvorschlag:
Das organisatorische Lernen ist besonders praktisch in Schulen, da nicht nur die Schule selber sondern auch die Klassen unterteilt sind in Subkategorien. So kann man dieses besondere überindividuelle Lernen in den verschiedensten Gebieten innerhalb der Schule anwenden. Doch was uns hier speziell interessiert ist der Bezug auf den Unterricht selbst.
Eine Unterrichtsklasse ist nichts anderes als eine Versammlung bzw. eine bestimmte Menge an Individuen die sich in einem Raum zusammentreffen um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: Der Schulerfolg. Dieser Schulerfolg ist für jeden einzelnen dieser Individuen ein bekanntes und gewünschtes Ziel.
In Bezug auf den Unterricht, hier spezifisch nun ein Vorschlag für den Geographieunterricht, wird versucht das organisationales Lernen anzuwenden. Der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt, wenn man Geographie hört ist die Weltkarte und die Unterteilung der Landfläche in ihre Kontinente und Staaten. Da die Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Nationen stammen besteht eine Unterscheidung zwischen deren Herkunft. Man erstellt sich ein Problem, das beispielsweise in der Klasse vorherrschend ist. Hier wird die kulturelle und nationale Unterscheidung als
Problem jedes Individuums präsentiert. Hat man das Problem festgestellt so ist das Handeln des Einzelnen zur Lösung zu erwirken. Danach wird jeder dieser individuellen Wirkungen zur
Wirkung der gesamten Organisation. Schließlich wird das Ergebnis präsentiert und darüber reflektiert und mit dem Grundproblem verglichen. Der genaue Vorschlag schaut folgendermaßen aus: Jeder einzelne Schülerinnen und Schüler tut sich zusammen mit jedem anderen Schülerinnen und Schüler, der die selbe Herkunft hat. Diese Schüler präsentieren ihre Nation mit bekannten Klischees, Sehenswürdigkeiten und/oder Merkmalen und versucht die restlichen Schülerinnen und Schüler ihre Nation vorzustellen, um ein gemeinsames Wissen zu erlangen oder vorhandenes, eventuell unwahres Wissen zu verändern bzw. zu berichtigen. Somit erlangt die ganze Organisation ein neues, frisches Wissen aus Individuen aus demselben Körper und bildet sich so fort. Das führt dazu, dass sie sich nicht nur besser kennen lernen, sondern auch einander respektieren. Nicht nur deren Herkunft, sondern auch die Individuen selbst. Wird dies vom ganzen Körper betrieben so wirkt man gegen das Problem. Am Ende erhält man ein Produkt, eine Organisation, die gelernt hat und sich gegenseitig stützt und unter der Führungsposition des Lehrers einen wichtigen Schritt Richtung Schulerfolg hinter sich gebracht haben.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "organisationalem Lernen"?
Es beschreibt das Lernen, Anwenden und Aneignen von Wissen durch eine Gruppe oder Organisation als Ganzes, was zu einer dauerhaften Veränderung führt.
Was sind die vier Phasen des idealen Lernkreislaufs in Organisationen?
Der Kreislauf besteht aus: Problem formulieren, individuelles Handeln an einer Entscheidung, organisationales Handeln und Wahrnehmung der Reaktion.
Wie kann organisationales Lernen im Unterricht angewendet werden?
Schüler können als kollektiver Körper agieren, um gemeinsam Probleme (z. B. kulturelle Vorurteile) zu lösen und neues Wissen durch Austausch zu generieren.
Welche Rolle spielen Fehler beim Lernen in Organisationen?
Fehler werden als Hinweis zum Erlernen neuer Lösungen genutzt. Sie werden entdeckt, korrigiert und dienen als Basis für bewusste oder unbewusste Erfahrungen.
Was bedeutet "Lernen-Lernen"?
Es ist eine übergeordnete Kompetenz, die alle Aspekte wie Wissen-, Können- und Leben-Lernen umfasst und in jedem Lernprozess mitschwingt.
Was ist ein "autopoietisches System" im Lernkontext?
Es bezeichnet einen selbstorganisierten Lerner, der Informationen selbstständig aufnimmt und verarbeitet, um sich in der Welt zu orientieren.
- Arbeit zitieren
- Cagdas Celik (Autor:in), 2014, Organisationales Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462452