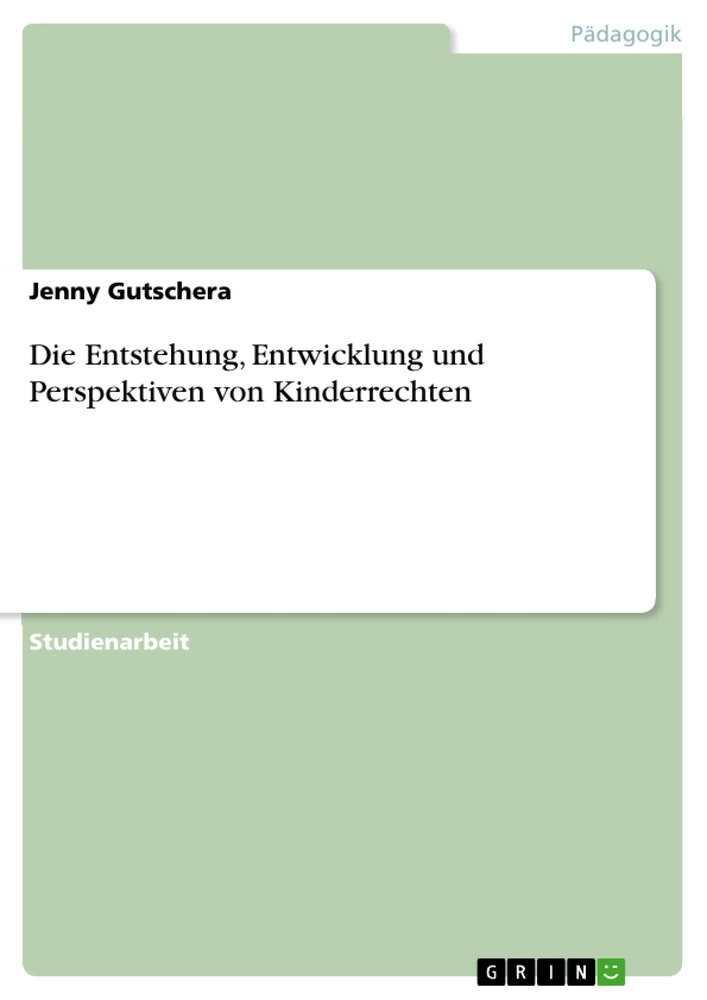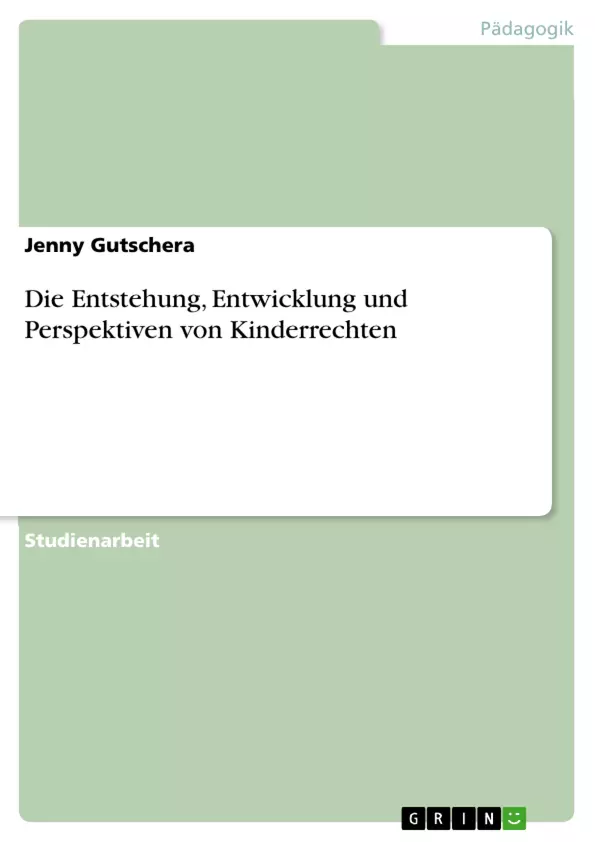Kinder haben Rechte. Sie benötigen besonderen Schutz und Förderung, daher gelten für sie eigene Kinderrechte. Dennoch werden die Rechte von Millionen Kindern täglich verletzt, denn weltweit werden Kinder geschlagen, ausgebeutet, vernachlässigt und gedemütigt. Werden die Kinderrechte nicht effektiv genug durchgesetzt? In dieser Hausarbeit soll die Entstehung der Kinderrechte präsentiert werden, sowie deren Entwicklung und die Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt werden.
Dazu wird zunächst eine Definition der Lebensphase Kindheit vorgenommen. Daraufhin wird der Weg der Kinderrechtskonvention aufgezeigt: Dieser Weg führt über die Menschenrechtserklärung, da dort die Rechte von Kindern erstmalig erwähnt werden. Schließlich wird die Geschichte der Kinderrechte dargestellt, die mit der UN-Kinderrechtskonvention ihren Höhepunkt fand. Nach diesem geschichtlichen Hintergrund wird versucht, die Frage nach der weltweiten Effektivität und Umsetzung der Kinderrechte zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Definition der Lebensphase Kindheit.
- Kinder haben Rechte
- Die Menschenrechtserklärung.
- Die Geschichte der Kinderrechte.
- Die UN-Kinderrechtskonvention.
- Das Gebäude der Kinderrechte
- Effektivität und Umsetzung der Kinderrechte weltweit
- Material für Kinder zu ihren Rechten
- Wimmelposter von Wolfgang Friesslich
- Homepage vom Kinderschutzbund...
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung der Kinderrechte mit einem Fokus auf die UN-Kinderrechtskonvention. Sie beleuchtet die Bedeutung dieser Rechte für Kinder und die Herausforderungen ihrer Umsetzung weltweit. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Rechte von Kindern und deren Bedeutung für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft zu vermitteln.
- Definition der Lebensphase Kindheit
- Historische Entwicklung der Kinderrechte
- Die UN-Kinderrechtskonvention
- Herausforderungen der Umsetzung der Kinderrechte
- Materialien zur Vermittlung von Kinderrechten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition der Lebensphase Kindheit und beleuchtet die kulturelle und evolutionäre Entwicklung des Begriffs. Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der Kinderrechte, beginnend mit der Menschenrechtserklärung von 1948, und zeigt die historischen Meilensteine auf, die zur Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention führten. Das dritte Kapitel widmet sich der UN-Kinderrechtskonvention, erklärt deren Inhalte und untersucht die Effektivität und Umsetzung dieser Rechte weltweit. Das vierte Kapitel stellt Materialien für Kinder zu ihren Rechten vor und diskutiert deren Bedeutung für die Bewusstseinsbildung von Kindern.
Schlüsselwörter
Kinderrechte, UN-Kinderrechtskonvention, Menschenrechtserklärung, Kindheit, Entwicklung, Schutz, Förderung, Effektivität, Umsetzung, Materialien, Bewusstseinsbildung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die UN-Kinderrechtskonvention?
Es ist ein internationales Übereinkommen, das Kindern weltweit spezifische Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung zusichert.
Wie werden Kinderrechte in der Geschichte hergeleitet?
Die Entwicklung begann mit der allgemeinen Menschenrechtserklärung, in der Kinderrechte erstmals erwähnt wurden, und gipfelte in der eigenständigen Konvention.
Werden Kinderrechte weltweit effektiv umgesetzt?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und stellt fest, dass Millionen Kinder trotz der Konvention täglich Opfer von Ausbeutung, Gewalt und Vernachlässigung werden.
Wie definiert man die Lebensphase „Kindheit“?
Der Begriff Kindheit wird unter Berücksichtigung kultureller, evolutionärer und rechtlicher Aspekte als schutzbedürftige Entwicklungsphase definiert.
Welche Materialien gibt es, um Kindern ihre Rechte zu erklären?
Die Hausarbeit nennt Beispiele wie das Wimmelposter von Wolfgang Friesslich oder die Online-Angebote des Kinderschutzbundes.
Warum brauchen Kinder eigene Rechte zusätzlich zu den Menschenrechten?
Aufgrund ihrer besonderen Verletzlichkeit und ihres speziellen Bedarfs an Förderung und Schutz reichen allgemeine Menschenrechte oft nicht aus, um kinderspezifische Bedürfnisse abzudecken.
- Citar trabajo
- Jenny Gutschera (Autor), 2019, Die Entstehung, Entwicklung und Perspektiven von Kinderrechten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462656