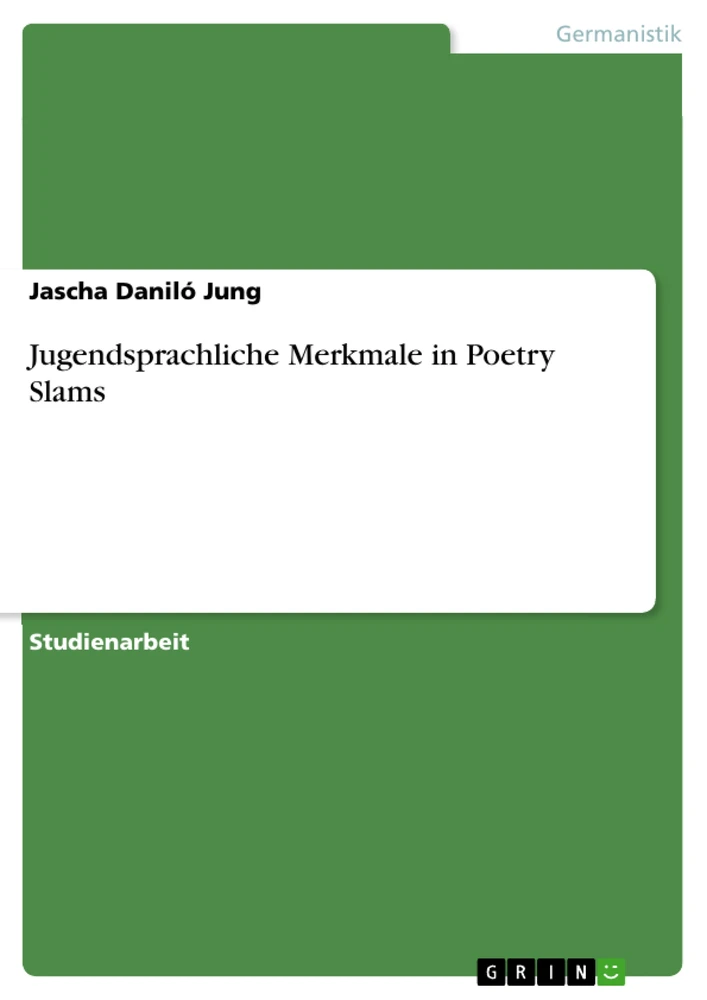Poetry Slams sind eine relativ junge Literaturform mündlicher Vorträge von zuvor niedergeschriebenen Texten, die sich in den 80er Jahren in den USA entwickelt hat und in den 90er Jahren nach Europa gekommen ist.
Hier erfreut es sich vor allem in Deutschland großer Beliebtheit und es gibt eine Vielzahl dieser "Dichterwettstreite" in allen größeren Städten. Dabei messen sich gerade Jugendliche in spielerischem und nicht allzu ernstem Wettstreit und tragen selbstgeschriebene Texte einem Publikum vor, welches anschließend über den Sieger abstimmt.
Im Folgenden sollen daher einige Texte dieser "jungen" literarischen Gattung auf typische Merkmale der Jugendsprache untersucht werden, wie sie in der neueren linguistischen Forschung dargestellt werden. Dazu werden Texte einer "Slam-Anthologie", welche von den vortragenden Dichtern eigenhändig verfasst wurden, als Grundlage genommen.
Zunächst soll jedoch der Begriff "Poetry Slam" erläutert und danach die Möglichkeiten und Probleme eines Vergleichs mit "Jugendsprache" aufgezeigt werden. Anschließend werden einige spezifische Merkmale der Jugendsprache dargestellt und anschließend in den untersuchten Texten beispielhaft ausfindig gemacht. Weiterhin werden "Kategorien der Gesprächsführung bei Jugendlichen" vorgestellt und deren Anwendbarkeit auf Poetry Slam-Texte überprüft. Zum Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, sowie ein Ausblick auf weitere mögliche Auseinandersetzungen mit diesem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was sind Poetry Slams?
- Poetry Slams und Jugendsprache
- Jugendsprachliche Merkmale
- Grammatik
- Lexik
- Semantik/Pragmatik
- Phraseologie
- Stilistik
- Gesprächsführung
- Textanalyse
- Bastian Böttcher: Teleliebe
- Katja Huber: Helsinki sehen und sterben
- sushi: dtrdf-Liebesgedicht
- Martin Auer: Deutsch für Außerirdische
- Heike Geißler: so eine
- Kategorien jugendsprachlicher Gesprächsführung und Poetry Slam-Texte
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Poetry Slams als literarische Form und analysiert sie auf jugendsprachliche Elemente. Dabei werden die Möglichkeiten und Probleme eines Vergleichs mit 'Jugendsprache' beleuchtet. Im Fokus stehen die spezifischen Merkmale der Jugendsprache, die im Rahmen der Untersuchung von Poetry Slams als 'jugendsprachliche Ausdrucksweise' relevant erscheinen. Ziel ist es, einen ersten Anstoß zu einer Auseinandersetzung mit Jugendsprache in Poetry Slams zu geben.
- Untersuchung von Poetry Slams als literarische Form
- Analyse jugendsprachlicher Elemente in Poetry Slams
- Möglichkeiten und Probleme eines Vergleichs mit 'Jugendsprache'
- Darstellung spezifischer Merkmale der Jugendsprache im Kontext von Poetry Slams
- Erste Annäherung an die Auseinandersetzung mit Jugendsprache in Poetry Slams
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Poetry Slams und deren Relevanz für die Untersuchung von Jugendsprache ein. Kapitel 2 erläutert die grundlegenden Regeln von Poetry Slams und hebt deren Bedeutung für die Literatur hervor. In Kapitel 3 werden die Möglichkeiten und Probleme eines Vergleichs von Poetry Slams mit 'Jugendsprache' diskutiert, wobei die heterogene Natur von Jugendsprache betont wird. Kapitel 4 stellt verschiedene Merkmale der Jugendsprache vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit als Analysewerkzeuge dienen.
Kapitel 5 bietet eine Analyse von fünf Poetry Slam-Texten, die auf typische Merkmale der Jugendsprache untersucht werden. Schließlich geht Kapitel 6 auf Kategorien der Gesprächsführung bei Jugendlichen ein und überprüft deren Anwendbarkeit auf Poetry Slam-Texte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Poetry Slams, Jugendsprache, literarische Form, jugendsprachliche Ausdrucksweise, Analyse von Texten, Kategorien der Gesprächsführung, Mehrsprachigkeit, Anglizismen und Wortneubildungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Poetry Slam?
Ein Poetry Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne vor Publikum mündlich vorgetragen werden.
Welche jugendsprachlichen Merkmale finden sich in Poetry Slams?
Typische Merkmale sind spezifische Lexik, Wortneubildungen, Anglizismen sowie besondere stilistische Mittel der Grammatik und Phraseologie.
Warum wird Jugendsprache in Poetry Slams untersucht?
Da Poetry Slams besonders bei Jugendlichen beliebt sind, spiegeln die Texte oft die aktuelle "junge" Sprache und deren kommunikative Kategorien wider.
Welche Autoren werden beispielhaft analysiert?
Die Arbeit untersucht unter anderem Texte von Bastian Böttcher ("Teleliebe"), Katja Huber und Martin Auer auf ihre sprachliche Gestaltung.
Wie hängen Gesprächsführung und Poetry Slam zusammen?
Die Arbeit überprüft, inwieweit Kategorien der jugendsprachlichen Gesprächsführung auf die schriftlich fixierten, aber für den mündlichen Vortrag gedachten Slam-Texte anwendbar sind.
- Citar trabajo
- Jascha Daniló Jung (Autor), 2014, Jugendsprachliche Merkmale in Poetry Slams, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462789