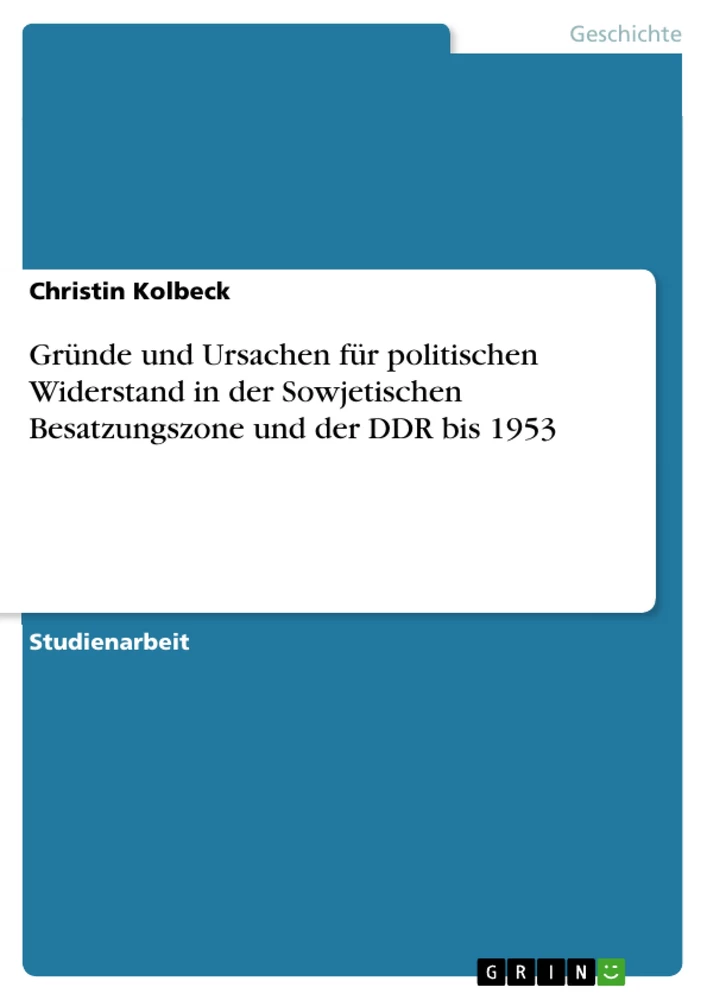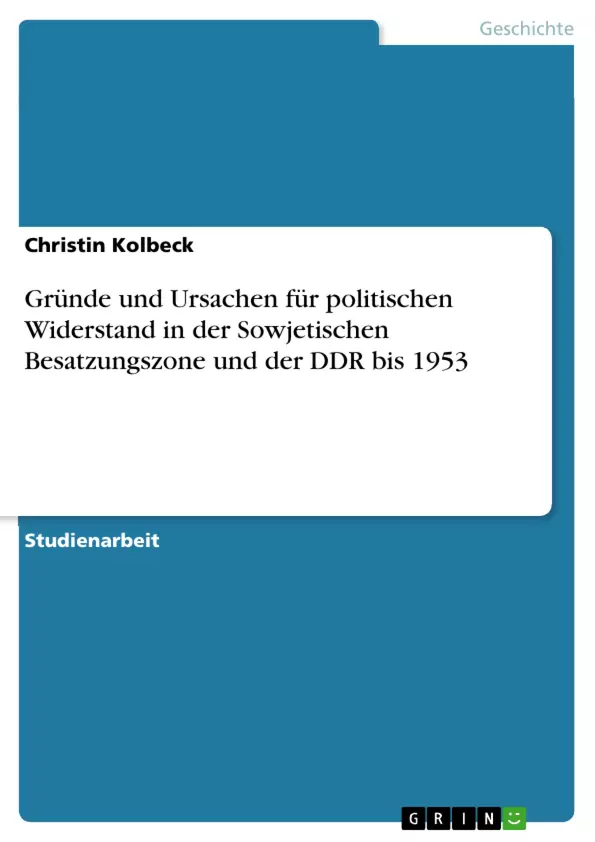Diese Arbeit untersucht die Gründe und Ursachen für den politischen Widerstand in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR bis 1953.
"Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille", skandierten die Demonstranten am 17. Juni 1953 bei ihren Zügen durch ostdeutsche Städte. Sie zielten mit der Parole auf Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl ab, allesamt in der Führungsriege der Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Für die Demonstranten waren sie der Inbegriff dessen, was sie "versklavte". Die Bevölkerung lebte in einem Staat geführt von einer Partei, welche streng nach Moskauer Vorbild fungierte und agierte. Dieser Staat provozierte es, dass acht Jahre nach Ende des Krieges erneut russische Panzer durch deutsche Städte fuhren. Er provozierte es ebenso, dass Demonstranten, in ihrer Mehrheit Menschen der Arbeiterklasse, mit Steinen nach den Panzern schmissen. Dieser Kampf, David gegen Goliath, konnte jedoch nicht mit Steinen gewonnen werden und wurde, auf Basis eines Befehls aus Moskau, gewaltsam niedergeschlagen.
Die DDR hatte sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit als Unrechtsstaat enttarnt und versuchte dennoch das Bild eines friedlichen, realsozialistischen Einheitsstaats aufrecht zu erhalten. Innenpolitisch jedoch lösten die Aufstände des Junis 1953 einen Flächenbrand aus, den die SED-Führung rigoros erstickte. Dass sie allerdings diese Aufstände selbst provozierte und schlussendlich auch die Konsequenzen hierfür tragen musste, steht historisch betrachtet nicht zur Debatte. Was jedoch beleuchtet werden muss, sind die genauen Ursachen, der genaue Weg, der letztendlich zur Eskalation geführt hat. Dies begann nicht erst mit der Staatsgründung im Oktober 1949, sondern bereits im Juni 1945.
Inhaltsverzeichnis
- Politischer Protest
- Vorgeschichte der DDR
- Die SMAD
- Die privilegierte Staatspartei
- Vereinigung zur SED und politischer Terror
- Macht durch Wirtschaft
- Normerhöhung und Neuer Kurs
- Zwischenstand
- Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953
- Die Folgen des Aufstandes
- Die Kausalität des Widerstandes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Gründe und Ursachen des politischen Widerstands in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bis 1953. Sie beleuchtet die Rolle der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) in der Etablierung des Realsozialismus nach Moskauer Vorbild sowie die Entstehung der SED und ihre politische Kontrolle. Zudem untersucht die Arbeit die wirtschaftlichen Faktoren, die zum Aufstand vom 17. Juni 1953 führten.
- Politischer Widerstand in der SBZ und der DDR
- Rolle der SMAD und die Installation des Realsozialismus
- Entstehung der SED und ihre politische Kontrolle
- Wirtschaftliche Faktoren und ihre Auswirkungen auf den Widerstand
- Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953
Zusammenfassung der Kapitel
- Politischer Protest: Dieses Kapitel stellt den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 als zentralen Punkt des politischen Widerstands in der DDR dar. Es beleuchtet die Protestaktionen, die Parolen und die Reaktion des Regimes.
- Vorgeschichte der DDR: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der DDR in der Nachkriegszeit und die Rolle der SMAD als einflussreiche Besatzungsmacht. Es erklärt die Etablierung des Realsozialismus, die Gründung der SED und die Entstehung von politischem Terror.
- Macht durch Wirtschaft: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR, die Normerhöhungen und den „Neuen Kurs“ der SED. Es beleuchtet die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Bevölkerung.
- Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des Volksaufstandes. Es behandelt die Reaktion des Regimes und die Repressionen.
Schlüsselwörter
Politischer Widerstand, Sowjetische Besatzungszone, Deutsche Demokratische Republik, SMAD, SED, Realsozialismus, Wirtschaft, Normerhöhung, Neuer Kurs, Volksaufstand, 17. Juni 1953.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Hauptursache für den Volksaufstand am 17. Juni 1953?
Unmittelbarer Auslöser war die Erhöhung der Arbeitsnormen durch die SED-Führung. Dies traf auf eine bereits tief unzufriedene Bevölkerung, die unter schlechten wirtschaftlichen Bedingungen und politischer Unterdrückung litt.
Welche Rolle spielte die SMAD in der SBZ?
Die Sowjetische Militäradministration (SMAD) war die entscheidende Machtinstanz. Sie installierte den Realsozialismus nach Moskauer Vorbild und ebnete den Weg für die Alleinherrschaft der SED.
Wer waren die Zielscheiben des Protests von 1953?
Der Protest richtete sich gegen die Führungsriege der DDR, insbesondere gegen Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, die als Inbegriff der Unfreiheit galten.
Wie reagierte die Sowjetunion auf die Aufstände?
Die Sowjetunion schlug den Aufstand gewaltsam mit Panzern nieder, nachdem ein entsprechender Befehl aus Moskau ergangen war. Dies enttarnte die DDR vor der Weltöffentlichkeit als Unrechtsstaat.
Was war der „Neue Kurs“ der SED?
Kurz vor dem Aufstand verkündete die SED den „Neuen Kurs“, der einige Belastungen für die Bevölkerung senken sollte. Da die Normerhöhungen jedoch bestehen blieben, reichte dies nicht aus, um die Eskalation zu verhindern.
- Citar trabajo
- Christin Kolbeck (Autor), 2019, Gründe und Ursachen für politischen Widerstand in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR bis 1953, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463048