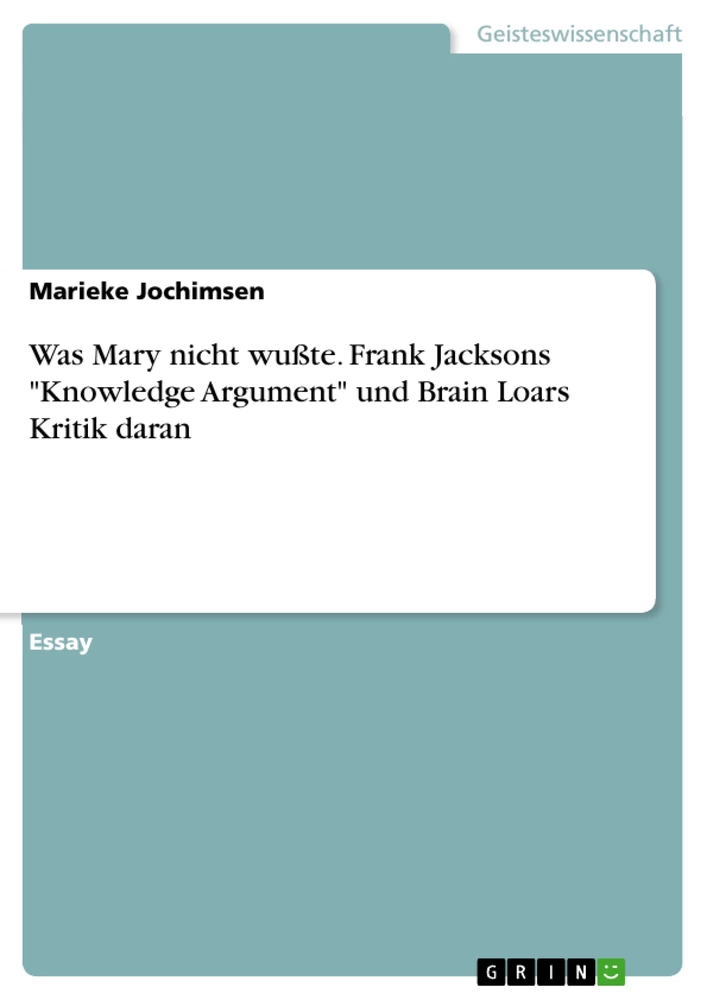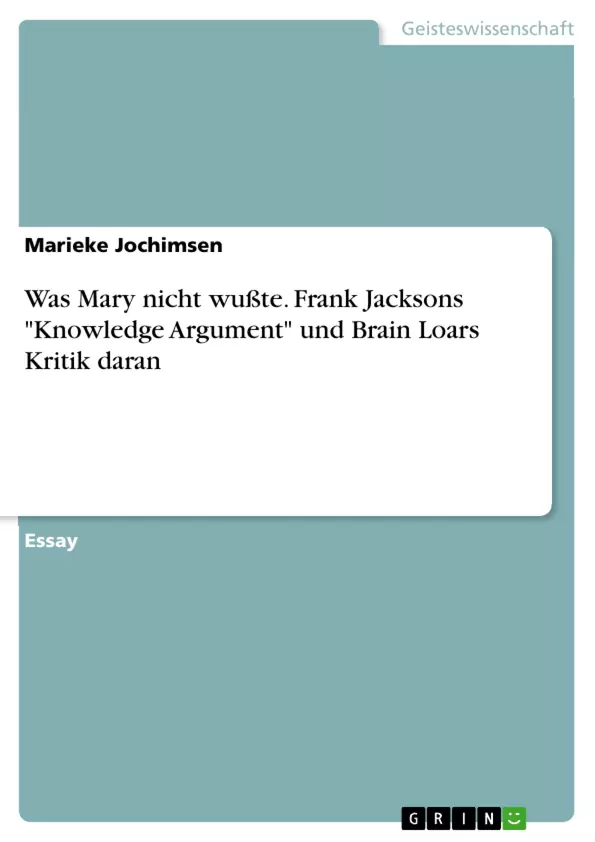„[…] there are certain features of the bodily sensations especially, but also of certain perceptual experiences, which no amount of purely physical information includes. Tell me everything physical there is to tell about what is going on in a living brain, the kind of states, their functional role, their relation to what goes on at other times and in other brains, and so on and so forth, and be I as clever as can be in fitting it all together, you won't have told me about the hurtfulness of pains, the itchiness of itches, pangs of jealousy, or about the characteristic experience of tasting a lemon, smelling a rose, hearing a loud noise or seeing the sky.“ Frank Jackson (2006)
Wie in diesem Eingangszitat von Jackson zum Ausdruck kommt, scheint es bestimmte Eigenschaften körperlicher, sinnlicher oder kognitiver Erfahrung zu geben, die in ihrer Gänze nicht durch physikalische Informationen beschreibbar sind, d.h. jede noch so vollständige Beschreibung einer solchen Erfahrung lässt immer bestimmte phänomenale Erlebnisqualitäten außen vor. Wenn allerdings der Physikalismus behauptet, eine umfassende Theorie der Wirklichkeit schlechthin zu sein, so müssen seine Erklärungen eben solche Aspekte einschließen können. Diesen Punkt verdeutlicht Jackson in seinem Aufsatz „Epiphenomenal Qualia“ anhand des Gedankenexperiments der Wissenschaftlerin Mary.
Dieser Essay stellt an anknüpfend an Jacksons Wissensargument Brian Loars Antwort darauf vor, die es uns ermöglicht an unserer phänomenologischen Grundintuition festzuhalten ohne gleichzeitig den Physikalismus zurückzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Was Mary nicht wusste - Das Knowledge Argument
- Loars Antwort auf das Knowledge Argument
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Marieke Jochimsen befasst sich mit Frank Jacksons Wissensargument und Brain Loars Kritik daran. Ziel des Textes ist es, Jacksons Argumentation und Loars Gegenargument zu präsentieren und zu analysieren. Dabei werden die wichtigsten Punkte des Arguments beleuchtet und die zugrundeliegenden philosophischen Konzepte erläutert.
- Das Knowledge Argument: Jacksons Gedankenexperiment und seine Implikationen für den Physikalismus.
- Phänomenale Qualitäten: Die Frage, ob phänomenale Eigenschaften durch physikalische Informationen vollständig beschreibbar sind.
- Begriffe und Eigenschaften: Die Unterscheidung zwischen begrifflicher Irreduzibilität und physisch-funktionalen Eigenschaften.
- Kontingente Gegebenheitsweisen: Loars Argumentation, dass phänomenale Konzepte auf kontingente Gegebenheitsweisen von physikalischen Eigenschaften referieren.
- Die Rolle der ersten Person-Perspektive: Die Bedeutung der persönlichen Erfahrung für die Bildung phänomenaler Begriffe.
Zusammenfassung der Kapitel
Was Mary nicht wusste - Das Knowledge Argument
Der erste Abschnitt des Essays führt in das Knowledge Argument von Frank Jackson ein. Jackson argumentiert, dass es bestimmte phänomenale Eigenschaften gibt, die nicht durch physikalische Informationen vollständig erfasst werden können. Dies wird anhand des Gedankenexperiments der Wissenschaftlerin Mary verdeutlicht, die zwar über alle physikalischen Informationen über Farbwahrnehmung verfügt, aber nie ein Farberlebnis hatte. Durch die Erfahrung der Farbe lernt Mary etwas Neues, was bedeutet, dass es mehr in der Welt gibt als nur physikalische Tatsachen. Der Physikalismus, der behauptet, dass alle Tatsachen physikalische Tatsachen sind, wird somit in Frage gestellt.
Loars Antwort auf das Knowledge Argument
Im zweiten Abschnitt des Essays präsentiert Jochimsen Loars Kritik an Jacksons Wissensargument. Loar räumt zwar ein, dass phänomenale Eigenschaften irreduzible Bestandteile der Wirklichkeit sind, argumentiert aber, dass sie kein Problem für den Physikalismus darstellen. Durch die Unterscheidung zwischen Begriffen und Eigenschaften argumentiert er, dass wir sowohl die begriffliche Irreduzibilität phänomenaler Qualitäten akzeptieren als auch sie gleichzeitig mit physisch-funktionalen Eigenschaften identifizieren können. Loar führt das Beispiel von Alkohol und Wasser an, um zu verdeutlichen, dass wir neue Tatsachen über die Welt lernen können, ohne dass diese neue Tatsachen im Sinne von grundlegend anderen Tatsachen darstellen. Der Erkenntniszuwachs, den wir durch epistemisches Wissen erwerben, besteht demnach nicht aus neuen Tatsachen, sondern in verschiedenen Gegebenheitsbeschreibungen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind: Knowledge Argument, Physikalismus, phänomenale Qualitäten, begriffliche Irreduzibilität, physisch-funktionale Eigenschaften, kontingente Gegebenheitsweisen, erste Person-Perspektive.
- Citar trabajo
- Marieke Jochimsen (Autor), 2018, Was Mary nicht wußte. Frank Jacksons "Knowledge Argument" und Brain Loars Kritik daran, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463070