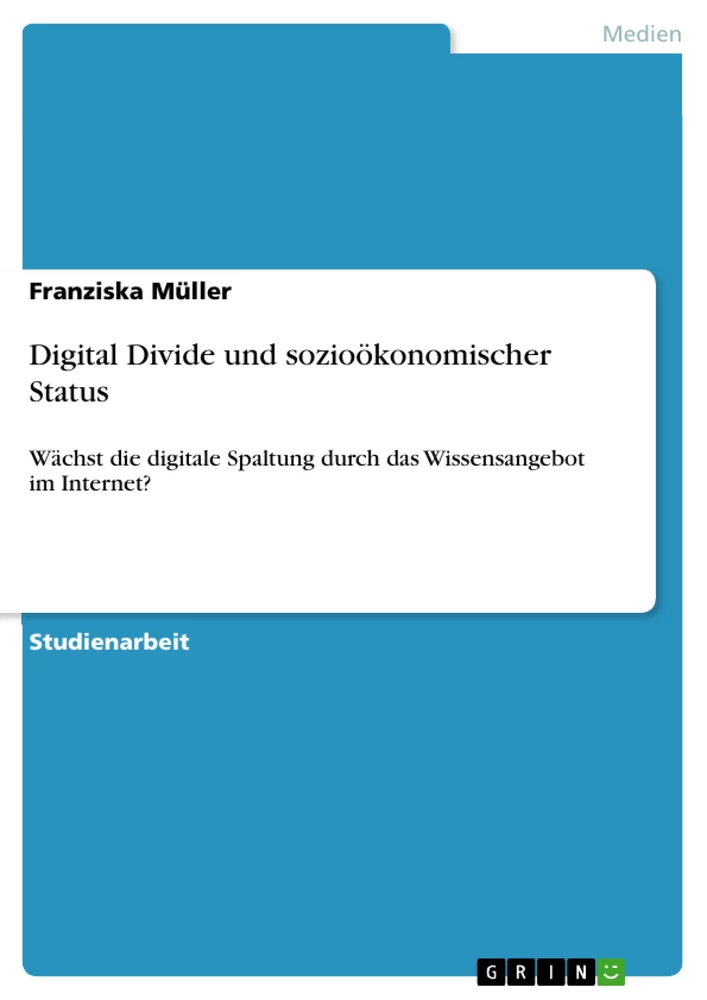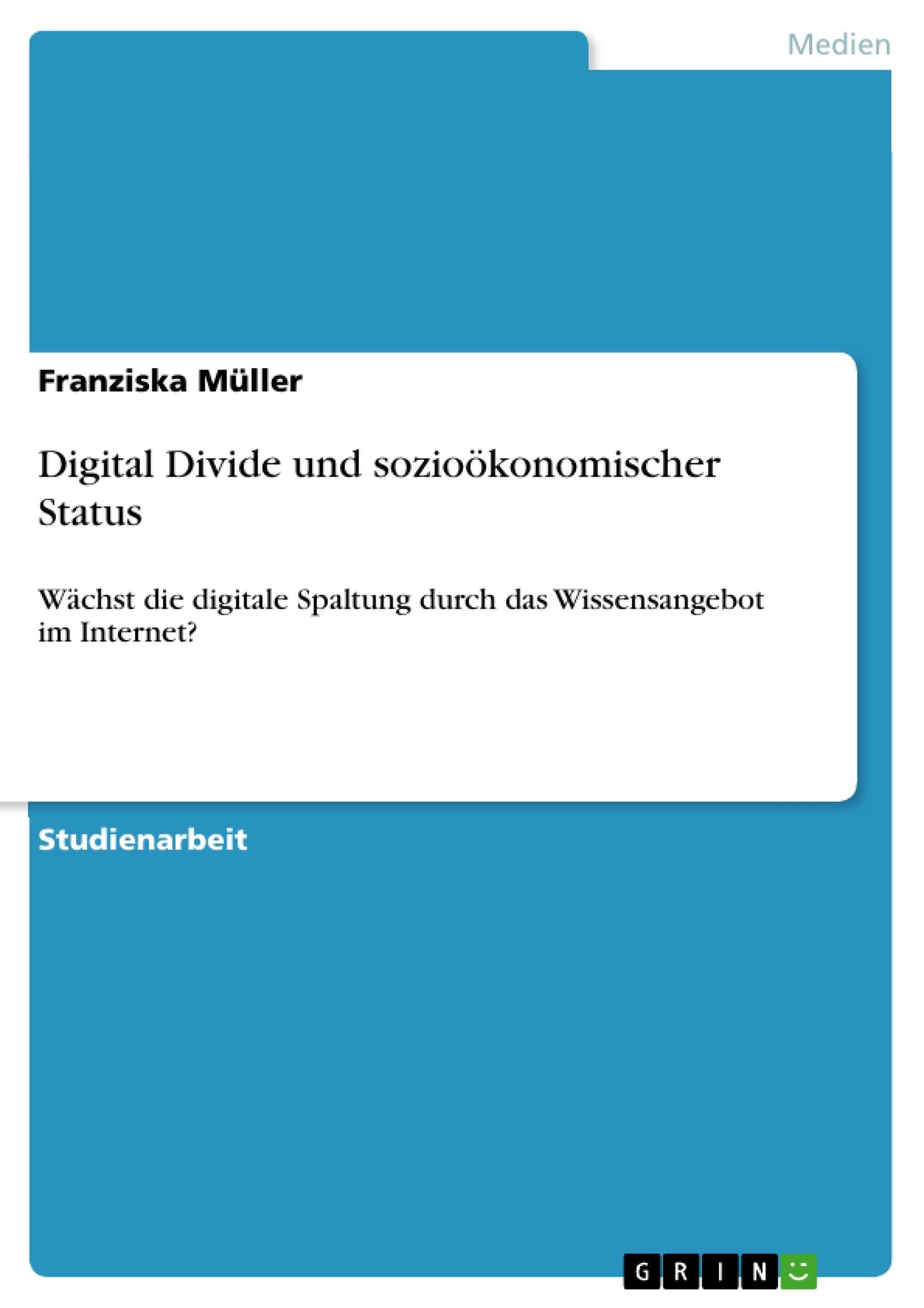In dieser Arbeit soll die Relation des Wissensangebotes im Netz zu der sogenannten digitalen Spaltung geklärt werden. Genauer geht es um die Frage, ob eine digitale Spaltung speziell zwischen Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status durch das Wissensangebot im Internet gefördert wird.
Dazu erfolgt zu Beginn eine Erläuterung der Begriffe „Wissensklufthypothese“ und„Digital Divide“, in der sowohl deren Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede deutlich werden. Darauf folgend werden die Chancen des Internets dessen Herausforderungen gegenübergestellt. Es wird sich hierbei nur auf die für die Arbeitsfrage relevanten Möglichkeiten und Probleme, speziell auf die der Nutzungsweisen, beschränkt. Eine kurze Darstellung, wie das Web von den unterschiedlichen sozialen Gruppen tatsächlich genutzt wird, erfolgt danach.Abschließend wird in einem Fazit die Frage beantwortet, ob das Wissensangebot des Internets Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status spaltet. Darüber hinaus werden weitere Fragen und Probleme, die sich durch die Arbeiter schließen, skizziert.
Das Internet – fast jeder nutzt es. Heutzutage gilt es als die zentrale Wissens- und Informationsressource. Es wird erwartet, dass wir dieses Medium entsprechend unserer eigenen Bedürfnisse bedienen können und sollten. Theoretisch stehen jedem die gleichen Inhalte im Web zur Verfügung, doch werden sie auch gleich genutzt? Haben alle das gleiche Bedürfnis an Informationen und Wissen zu gelangen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen formaler Bildung, Beruf, Einkommen und der Nutzung der zur Verfügung stehenden Informationen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Wissensklufthypothese
- Digital Divide
- Statusbedingte Nutzungsunterschiede?
- Herausforderung des Internets
- Chancen des Internets
- Wie wird das Internet genutzt?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Wissensangebot im Internet und der sogenannten digitalen Spaltung. Genauer gesagt, wird die Frage beleuchtet, ob die digitale Spaltung, insbesondere zwischen Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status, durch das Wissensangebot im Internet verstärkt wird.
- Die Wissensklufthypothese und ihre Anwendung auf das Internet
- Die Definition und verschiedenen Interpretationen des Begriffs „Digital Divide“
- Die Herausforderungen und Chancen des Internets im Hinblick auf soziale Ungleichheit
- Die tatsächliche Nutzung des Internets durch verschiedene soziale Gruppen
- Die Frage, ob das Wissensangebot des Internets Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status spaltet
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Fragestellung, ob das Wissensangebot im Internet zu einer digitalen Spaltung zwischen Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status führt. Zudem werden die wichtigsten Begriffsdefinitionen, der Aufbau der Arbeit und die Zielsetzung skizziert.
Theoretische Grundlagen
Wissensklufthypothese
Dieses Kapitel erläutert die Wissensklufthypothese, die besagt, dass Menschen mit einem höheren sozioökonomischen Status massenmediale Informationen schneller aufnehmen als Menschen mit einem niedrigeren Status. Es wird zudem auf die verschiedenen Arten der Wissenskluft, wie die rezeptionsbedingte, angebotsbedingte und nutzungsbedingte Wissenskluft, eingegangen.
Digital Divide
Das Kapitel erläutert den Begriff „Digital Divide“ und seine Verbindung zur Wissenskluftforschung. Es wird die These der digitalen Spaltung vorgestellt, die besagt, dass durch den Zugang und die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien neue gesellschaftliche Klüfte entstehen.
Statusbedingte Nutzungsunterschiede?
Herausforderung des Internets
Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen des Internets im Hinblick auf soziale Ungleichheit. Es werden die Aspekte der digitalen Spaltung und die Auswirkungen auf unterschiedliche soziale Gruppen betrachtet.
Chancen des Internets
Dieses Kapitel beleuchtet die Chancen des Internets, insbesondere für Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status. Es wird die Möglichkeit des Internets, Wissen und Informationen zugänglicher zu machen, hervorgehoben.
Wie wird das Internet genutzt?
Das Kapitel beschreibt, wie das Internet von verschiedenen sozialen Gruppen tatsächlich genutzt wird. Es werden die unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten und -motive analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die digitale Spaltung, die Wissensklufthypothese, der sozioökonomische Status und die Nutzung des Internets. Die Arbeit untersucht den Einfluss des Wissensangebotes im Internet auf die digitale Spaltung und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
Häufig gestellte Fragen zum Digital Divide
Was bedeutet der Begriff „Digital Divide“?
Der Digital Divide (digitale Spaltung) bezeichnet die Ungleichheit beim Zugang zu und bei der Nutzung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen verschiedenen sozialen Gruppen.
Was besagt die Wissensklufthypothese?
Sie besagt, dass Menschen mit höherem sozioökonomischem Status Informationen aus Massenmedien schneller aufnehmen als Menschen mit niedrigerem Status, wodurch sich die Wissenskluft vergrößert.
Fördert das Internet die digitale Spaltung?
Die Arbeit untersucht, ob das Wissensangebot im Internet Menschen mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status eher spaltet, da Nutzungsgewohnheiten und Informationsbedürfnisse stark variieren.
Gibt es Chancen für Menschen mit niedrigem Status im Internet?
Ja, das Internet bietet theoretisch jedem den gleichen Zugang zu Informationen und kann so helfen, Bildungsbarrieren abzubauen, sofern die entsprechenden Kompetenzen vorhanden sind.
Welche Faktoren beeinflussen die Internetnutzung?
Vor allem die formale Bildung, der Beruf und das Einkommen hängen eng damit zusammen, wie intensiv und zu welchem Zweck (Unterhaltung vs. Information) das Web genutzt wird.
- Arbeit zitieren
- Franziska Müller (Autor:in), 2018, Digital Divide und sozioökonomischer Status, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463242