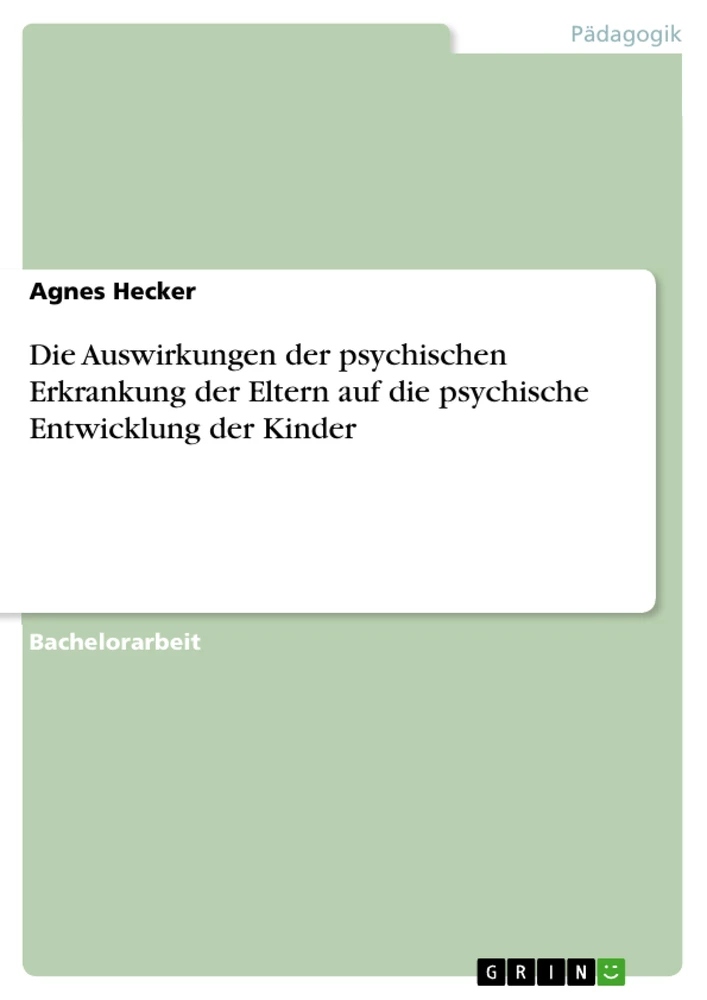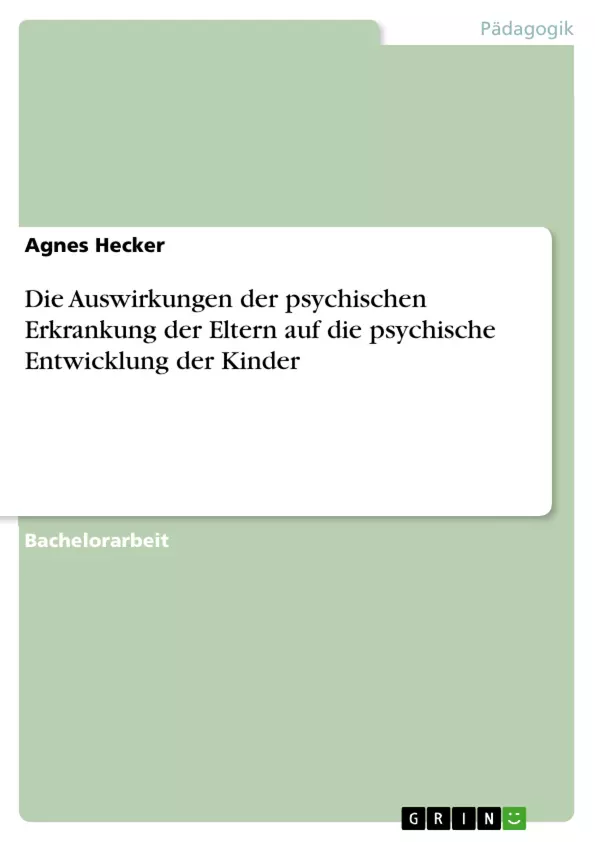Die vorliegende Arbeit setzt sich intensiv mit den Auswirkungen der psychischen Erkrankungen der Eltern auf die psychische Entwicklung der Kinder auseinander. Es wird geschätzt, dass ca. 3 Millionen Kinder im Laufe eines Jahres, ein Elternteil erleben, welcher psychisch krank ist. Die psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst- und Zwangsstörung, Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen verändern den kranken Elternteil in seinem Denken und Verhalten, welcher wiederum Einfluss auf die Kinder hat. Sie erleben einen veränderten Elternteil, welcher sie verwirrt und befremdlich wirkt. Die Tabuisierung der Krankheit in der Familie führt dazu, dass sie sich selbst Schuld für die Erkrankung geben.
Die Eltern belasten die Kinder mit einer unangemessenen Verantwortung, was zur Parentifizierung führt. Eine stationäre Behandlung des kranken Elternteils ruft Verlust- und Trennungsängste hervor. Die Kinder leben in einer für sie belastenden Situation, die sich negativ auf ihre psychische Entwicklung auswirkt. Die Kinder haben ein um ein vielfaches erhöhtes Risiko selbst an einer psychischen Störung zu erkranken. Unter diesen Belastungen, in Verbindung mit krankheitsspezifischen Verhaltensmustern der Eltern, entwickeln sie eine unsichere Bindung, zeigen externalisierte sowie internalisierte Verhaltensauffälligkeiten und ihre sozialen Kompetenzen sind eingeschränkt. Die psychischen Grundbedürfnisse der Kinder können nicht befriedigt werden.
Die Resilienzforschung hat schützende Faktoren für die Kinder festgestellt: Unterstützung durch außerfamiliäre Kontakte, gute soziale Kompetenz des Kindes, offener Umgang mit der Erkrankung in der Familie und Psychoedukation für Kinder. Präventive Angebote im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe greifen diese Schutzfaktoren auf, um die Kinder bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation zu stärken. In der praktischen Umsetzung der Hilfen, ist eine starke Vernetzung sowie eine gute fachliche Kompetenz aller unterstützenden Akteure notwendig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über psychische Erkrankungen
- Affektive Störungen
- Zwangsstörungen
- Angststörung
- Schizophrenie
- Persönlichkeitsstörungen
- Alkoholabhängigkeit
- Psychische Grundbedürfnisse von Kindern
- Bindungsbedürfnis
- Orientierung und Kontrolle
- Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung
- Lustgewinn und Unlustvermeidung
- Belastungen der Kinder
- Wahrnehmung des psychisch kranken Elternteils
- Tabuisierung
- Die Suche nach der Krankheitserklärung
- Gefühlswelt der Kinder
- Parentifizierung
- Stationäre Behandlung
- Krankheitsbezogene Probleme und Risiken
- Kinder von Eltern mit affektiven Störungen
- Kinder von Eltern mit Schizophrenie
- Kinder von Eltern mit Angststörungen
- Kinder von Eltern mit Zwangsstörung
- Kinder von Eltern mit Persönlichkeitsstörung
- Kinder von Eltern mit Alkoholabhängigkeit
- Stärkung und Förderung von betroffenen Kindern durch die Kinder- und Jugendhilfe
- Allgemeine Resilienzfaktoren
- Spezifische Resilienzfaktoren
- Förderung der Erfüllung von psychischen Grundbedürfnissen
- Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe
- Präventive Angebote
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf die psychische Entwicklung ihrer Kinder. Sie befasst sich mit den spezifischen Belastungen, die Kinder in solchen Familien erleben, und den Risiken, die mit den verschiedenen Arten von psychischen Erkrankungen der Eltern verbunden sind.
- Die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf Kinder
- Die Belastungen, die Kinder in Familien mit psychisch kranken Eltern erleben
- Die psychischen Grundbedürfnisse von Kindern und deren Beeinträchtigung in diesen Familien
- Die Rolle von Resilienzfaktoren und die Bedeutung von Unterstützung durch Kinder- und Jugendhilfe
- Die Notwendigkeit präventiver Angebote für Kinder mit psychisch kranken Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Relevanz der Untersuchung erläutert. Anschließend werden verschiedene psychische Erkrankungen wie affektive Störungen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen und Alkoholabhängigkeit vorgestellt. Das dritte Kapitel beleuchtet die psychischen Grundbedürfnisse von Kindern und deren Bedeutung für eine gesunde Entwicklung. Der vierte Abschnitt analysiert die Belastungen, die Kinder in Familien mit psychisch kranken Eltern erfahren, wie die Wahrnehmung des kranken Elternteils, die Tabuisierung der Krankheit und die Parentifizierung. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die krankheitsspezifischen Probleme und Risiken für die Kinder, wobei die Folgen von verschiedenen psychischen Erkrankungen der Eltern für die Kinder betrachtet werden. Schließlich behandelt das sechste Kapitel die Stärkung und Förderung von betroffenen Kindern durch die Kinder- und Jugendhilfe und stellt die Rolle von Resilienzfaktoren und präventiven Angeboten heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselthemen der Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf Kinder. Hierbei stehen Belastungen der Kinder, psychische Grundbedürfnisse, Resilienzfaktoren und die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe im Fokus.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder sind von psychisch kranken Eltern betroffen?
Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 3 Millionen Kinder in Deutschland pro Jahr mindestens einen Elternteil mit einer psychischen Erkrankung erleben.
Was bedeutet „Parentifizierung“?
Es beschreibt die Rollenumkehr, bei der Kinder unangemessene Verantwortung für ihre kranken Eltern übernehmen und so ihre eigene Kindheit vernachlässigen.
Welche Risiken bestehen für die betroffenen Kinder?
Kinder haben ein vielfach erhöhtes Risiko, selbst eine psychische Störung, unsichere Bindungen oder Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln.
Welche Schutzfaktoren (Resilienz) gibt es?
Wichtige Faktoren sind außerfamiliäre Kontakte, gute soziale Kompetenzen, ein offener Umgang mit der Krankheit und Psychoedukation.
Wie hilft die Kinder- und Jugendhilfe in diesen Fällen?
Durch präventive Angebote, Stärkung der Resilienz und Vernetzung der unterstützenden Akteure, um die psychischen Grundbedürfnisse der Kinder zu sichern.
- Quote paper
- Agnes Hecker (Author), 2018, Die Auswirkungen der psychischen Erkrankung der Eltern auf die psychische Entwicklung der Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463363