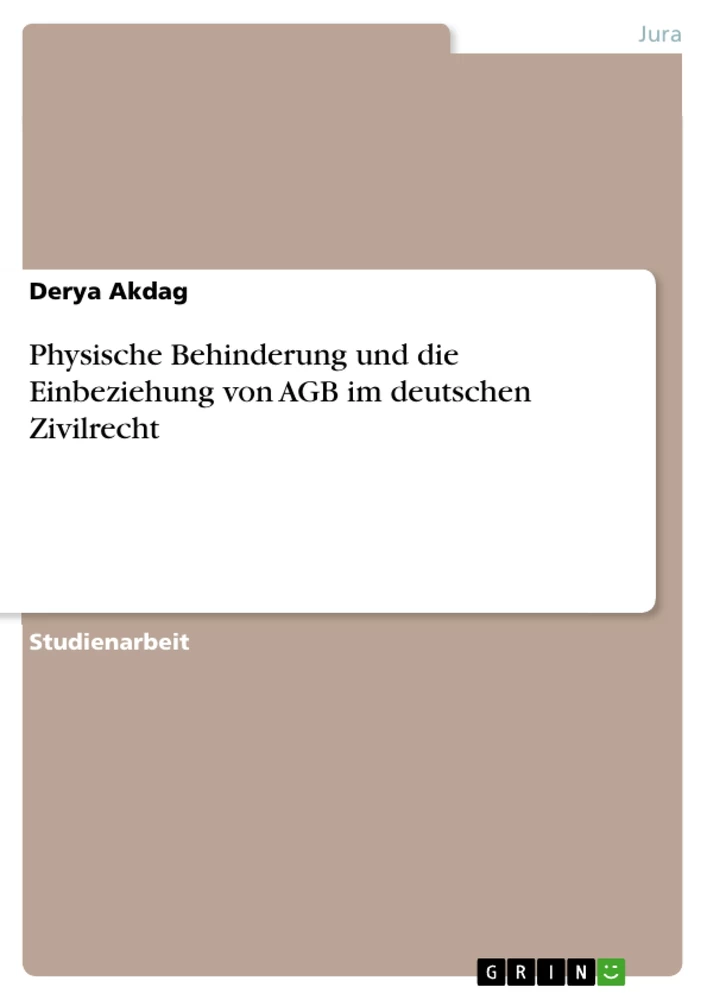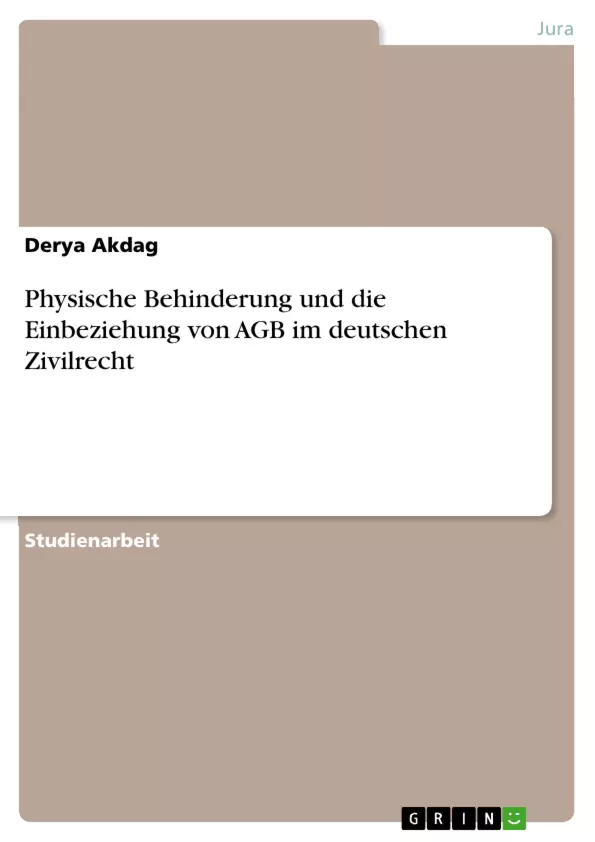Der Bereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im deutschen Zivilrecht ist sehr vielfältig und komplex. Die AGB weisen eine dynamische Entstehungsgeschichte auf. Ursprünglich hat das Gesetz zur Regelung des Rechts der AGB das Recht der AGB geregelt, welches aufgrund einer europäischen Richtlinie modifiziert und angepasst worden ist. Erst mit der Schuldrechtsmodernisierung sind die AGB in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) integriert worden. Die folgende Seminararbeit wird die Einbeziehung der AGB im Fall von physisch behinderten Menschen analysieren.
Die Thematik wird in der Einführung mithilfe allgemeiner Begrifflichkeiten präzisiert. Um die Struktur und die Bedeutung der AGB verstehen zu können, ist es notwendig, ihre Entstehungsgeschichte zu kennen, weshalb diese dargestellt wird. Ferner wird auf den Inhalt, den Schutzzweck und den Anwendungsbereich der AGB eingegangen und jeweils der Fall des gesunden Menschen mit dem einer körperlich behinderten Person verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Entstehungsgeschichte der AGB und ihre Bedeutung
- Gesetz zur Regelung des Rechts der AGB (AGBG)
- Beachtung der europäischen Richtlinie 93/13/EWG
- Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts
- Begriff, Schutzzweck und Anwendungsbereich der AGB
- Begriff der AGB
- Schutzzweck der AGB
- Anwendungsbereich der AGB
- Teil I - Einbeziehungskontrolle der AGB i.e.S. unter Bezugnahme auf physische Behinderungen
- Hinweispflicht des Verwenders (§ 305 II Nr. 1 BGB)
- Ausdrücklicher Hinweis (§ 305 II Nr. 1 Alt. 1 BGB)
- Hinweisersatz durch Aushang (§ 305 II Nr. 1 Alt. 2 BGB)
- Hyperlink im Internet
- Möglichkeit der Kenntnisnahme (§ 305 II Nr. 2 BGB)
- Zumutbarkeit der Kenntnisnahme
- Zeitpunkt der Einbeziehung
- Einverständnis des anderen Teils (§ 305 II a.E. BGB)
- Teil II - Einbeziehungskontrolle der AGB
- Rahmenvereinbarungen (§ 305 III BGB)
- Einbeziehungshindernisse
- Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB)
- Überraschungsklauseln (§ 305c I BGB)
- Auslegung von AGB (§ 305c II BGB)
- Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung der AGB
- Unwirksamkeit der AGB als grds. Rechtsfolge (§ 306 BGB)
- Einbeziehung in besonderen Fällen (§ 305a BGB)
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) im deutschen Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung physischer Behinderungen. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu analysieren und die Herausforderungen bei der Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen im Kontext von AGB zu beleuchten.
- Einbeziehungskontrolle von AGB
- Anpassung der AGB an die Bedürfnisse von Menschen mit physischen Behinderungen
- Auslegung und Wirksamkeit von AGB-Klauseln
- Rechtliche Folgen der Nichteinbeziehung von AGB
- Bedeutung des Gesetzes zur Regelung des Rechts der AGB (AGBG)
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung bietet einen Überblick über das Thema der Arbeit, die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im deutschen Zivilrecht, insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung physischer Behinderungen. Sie skizziert die zentrale Fragestellung und den methodischen Ansatz der Untersuchung. Die Bedeutung der AGB im modernen Vertragsrecht und die Herausforderungen im Kontext von Inklusion werden kurz angerissen, um den Leser auf die nachfolgenden Kapitel vorzubereiten.
Entstehungsgeschichte der AGB und ihre Bedeutung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der AGB und ihre zunehmende Bedeutung im modernen Wirtschaftsleben. Es analysiert die verschiedenen gesetzlichen Regelungen, beginnend mit dem Gesetz zur Regelung des Rechts der AGB (AGBG), die Berücksichtigung der europäischen Richtlinie 93/13/EWG und die Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts. Die Entwicklung des rechtlichen Schutzes vor unangemessenen AGB wird detailliert dargestellt, unter Berücksichtigung der Veränderungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext.
Begriff, Schutzzweck und Anwendungsbereich der AGB: Dieses Kapitel definiert den Begriff der AGB präzise und beschreibt ihren Schutzzweck. Es analysiert den Anwendungsbereich der AGB im Detail, unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Verträgen und beschreibt die spezifischen Herausforderungen für Menschen mit physischen Behinderungen im Umgang mit standardisierten Vertragsbedingungen. Der Fokus liegt auf der Auslegung der rechtlichen Bestimmungen und deren Anwendung in der Praxis.
Teil I - Einbeziehungskontrolle der AGB i.e.S. unter Bezugnahme auf physische Behinderungen: Dieser Teil befasst sich umfassend mit der Kontrolle der Einbeziehung von AGB, insbesondere im Kontext von physischen Behinderungen. Es werden die verschiedenen Aspekte der Einbeziehungskontrolle detailliert untersucht und analysiert, wie diese die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen können. Die Kapitel untersuchen die rechtlichen Anforderungen an die Hinweispflicht und die Möglichkeit der Kenntnisnahme, wobei spezifische Probleme im Zusammenhang mit Barrierefreiheit und Zugang zu Informationen erörtert werden.
Teil II - Einbeziehungskontrolle der AGB: Dieser Teil vertieft die Analyse der Einbeziehungskontrolle von AGB. Er behandelt Rahmenvereinbarungen, Einbeziehungshindernisse wie den Vorrang individualvertraglicher Abreden und überraschende Klauseln. Die Auslegung von AGB und die Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung werden ebenfalls eingehend beleuchtet. Die Kapitel untersuchen die verschiedenen rechtlichen Mechanismen, die gewährleisten sollen, dass die AGB transparent, verständlich und fair sind.
Häufig gestellte Fragen zu: Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) unter Berücksichtigung physischer Behinderungen
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über die Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) im deutschen Zivilrecht, wobei ein besonderer Fokus auf die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit physischen Behinderungen gelegt wird. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis (implizit durch die Gliederung).
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehung und Bedeutung von AGB, ihren Begriff, Schutzzweck und Anwendungsbereich. Es analysiert die Einbeziehungskontrolle von AGB, insbesondere die Hinweispflicht des Verwenders, die Möglichkeit der Kenntnisnahme und die Bedeutung des Einverständnisses des Vertragspartners. Weitere Themen sind Rahmenvereinbarungen, Einbeziehungshindernisse (z.B. überraschende Klauseln), die Auslegung von AGB und die Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung. Der gesamte Kontext wird unter dem Aspekt der Berücksichtigung physischer Behinderungen beleuchtet.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Dokument bezieht sich auf das Gesetz zur Regelung des Rechts der AGB (AGBG), die europäische Richtlinie 93/13/EWG, das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts und relevante Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere § 305, § 305a, § 305b, § 305c und § 306 BGB.
Wie wird der Aspekt der physischen Behinderung berücksichtigt?
Der Aspekt physischer Behinderungen wird im gesamten Dokument berücksichtigt, indem die Herausforderungen bei der Einbeziehung von AGB für Menschen mit Behinderungen beleuchtet werden. Dies betrifft insbesondere die Fragen der Zugänglichkeit von Informationen (z.B. Hinweispflicht im Internet), der Zumutbarkeit der Kenntnisnahme und der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse bei der Auslegung und Anwendung der AGB.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel: Einführung, Entstehungsgeschichte der AGB und ihre Bedeutung, Begriff, Schutzzweck und Anwendungsbereich der AGB, Teil I - Einbeziehungskontrolle der AGB i.e.S. unter Bezugnahme auf physische Behinderungen, Teil II - Einbeziehungskontrolle der AGB, Konklusion. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Einbeziehung von AGB zu analysieren und die Herausforderungen bei der Berücksichtigung individueller Bedürfnisse, insbesondere von Menschen mit physischen Behinderungen, zu beleuchten. Es soll ein umfassendes Verständnis der rechtlichen Situation schaffen.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus einer Nichteinbeziehung der AGB?
Die Rechtsfolgen der Nichteinbeziehung von AGB werden behandelt. Grundsätzlich führt die Nichteinbeziehung zur Unwirksamkeit der AGB (§ 306 BGB). Es werden jedoch auch Ausnahmen und besondere Fälle (§ 305a BGB) diskutiert.
Welche Rolle spielen Rahmenvereinbarungen und überraschende Klauseln?
Das Dokument behandelt die Bedeutung von Rahmenvereinbarungen (§ 305 III BGB) und analysiert Einbeziehungshindernisse wie den Vorrang individualvertraglicher Abreden und überraschende Klauseln (§ 305c I BGB).
- Citar trabajo
- Derya Akdag (Autor), 2017, Physische Behinderung und die Einbeziehung von AGB im deutschen Zivilrecht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463376