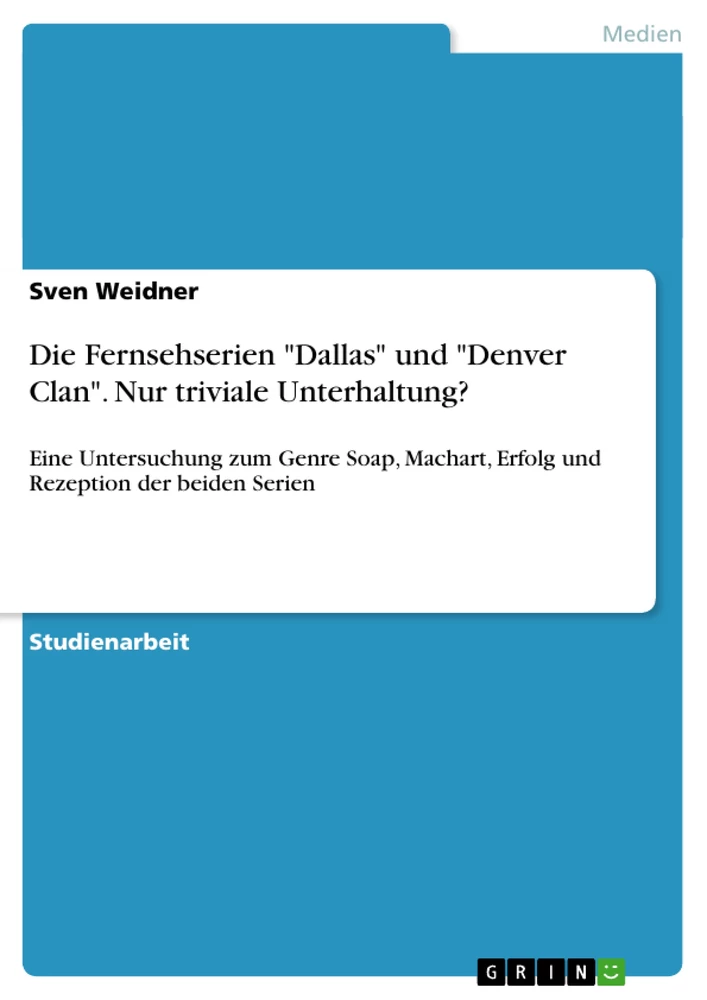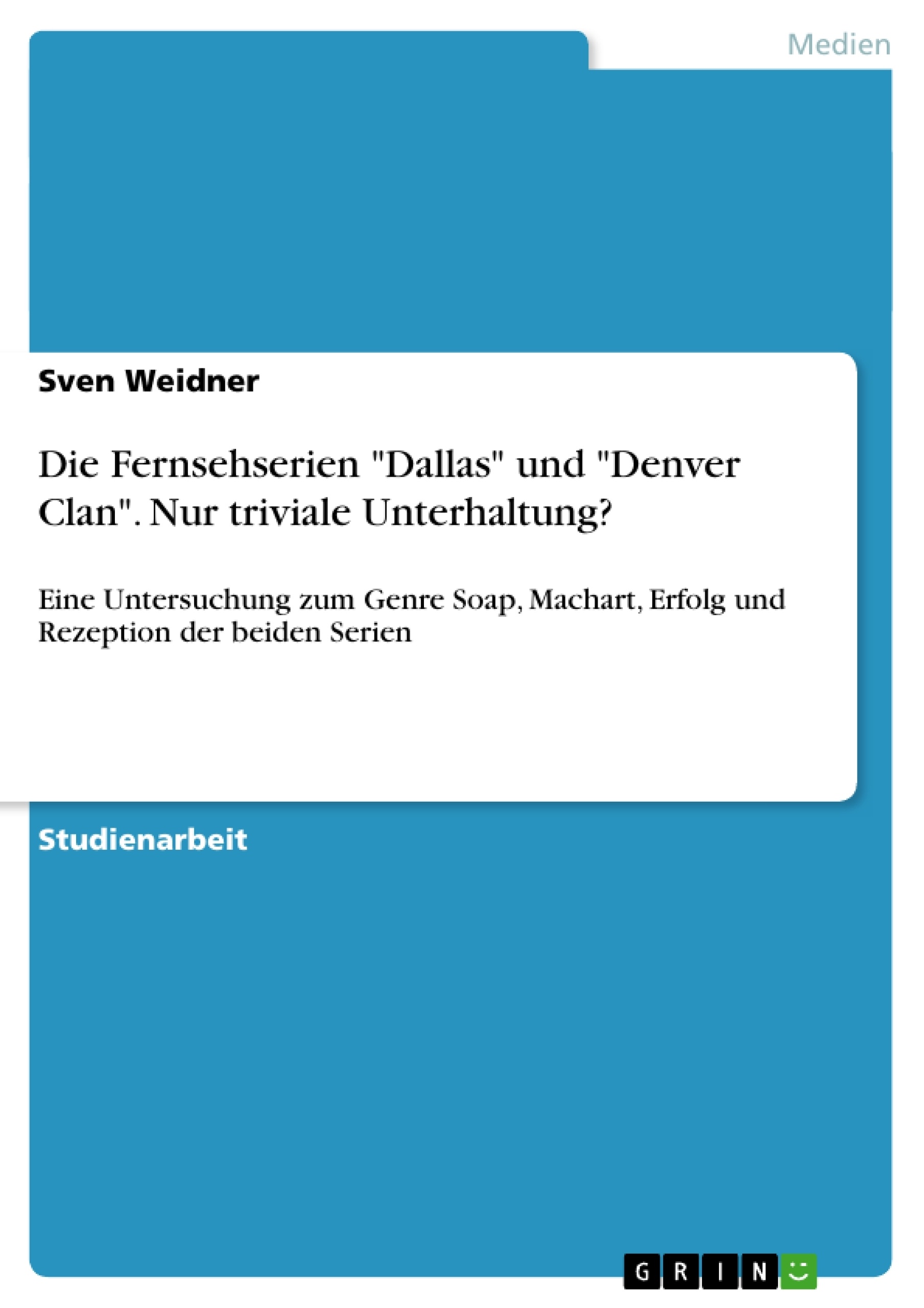Hemmungslose Gefühlshingabe, Polarisierung und Schematisierung moralischer
Standpunkte, superreiche Ölmagnaten, exaltierte Frauenkeilereien, bodenlose Infamie, dunkle Machenschaften, exzessive Liebschaften und Geld en masse. Das sind nur einige der wenigen Attribute, die man zu hören bekommt, sobald die Sprache auf die in den 80er Jahren durchaus populären Fernsehsoaps Dallas und Denver Clan kommt. Die beiden US-Importe verzeichneten nicht nur einen ungemeinen Erfolg bei den Einschaltquoten, sie ließen auch die Herzen von Medienwissenschaftlern hörbar höher schlagen, und das im negativen wie positiven Sinne; gleichwohl sorgten sie für eine Menge Zündstoff nicht nur in der medienpolitischen, sondern auch in der kulturpolitischen Arena. Während Intellektuelle aber auch Feuilletonisten den Untergang des Fernsehabendlandes kassandrahaft an die Wand malten, und Politiker in Bundestagsdebatten darüber stritten, ob eine solch intellektuell anspruchslose Produktion, die ein völlig verzerrtes und unwirkliches Amerikabild transportierte nicht verboten werden sollte, fieberten die Fans von Dallas jeden Dienstag mit den Ewings und delektierten sich an J.R.`s Rachegelüsten. Gleiches gilt für den Mittwoch, wo die Zuschauer geradezu begierig auf die nächste, klug ausgedachte Intrige von Alexis warten. Selbst der schwedische Regisseur Ingmar Bergmann – Grandseigneur im Filmbetrieb - fand Gefallen an Dallas und auch Elke Heidenreich brach für Dallas eine Lanze.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Das Genre Soap Opera
- Die Machart von Dallas und Denver-Clan
- Gründe für den lang anhaltenden Erfolg der beiden Soaps
- Die Rezeption von Dallas und Denver-Clan
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Erfolg der Fernsehserien "Dallas" und "Denver Clan" im Kontext ihres Genres, ihrer Produktionsweise und ihrer Rezeption. Ziel ist es, die Gründe für ihre anhaltende Popularität zu analysieren und die gängige Kritik an ihnen als "triviale Unterhaltung" zu hinterfragen.
- Das Genre der Soap Opera und seine Entwicklung
- Die Produktionsweise und dramaturgischen Merkmale von "Dallas" und "Denver Clan"
- Faktoren, die zum Erfolg der Serien beitrugen (z.B. Identifikationspotenzial, Intrigen, Charaktere)
- Die gesellschaftliche Rezeption und die damit verbundenen Debatten
- Die Frage nach der "trivialen Unterhaltung" im Kontext der Serien
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen: Die Einleitung beschreibt die kontroverse Rezeption von "Dallas" und "Denver Clan", die sowohl immensen Erfolg als auch scharfe Kritik hervorrief. Die Serien wurden sowohl von Zuschauern aller Gesellschaftsschichten begeistert aufgenommen als auch von Intellektuellen und Politikern heftig kritisiert. Die Einleitung betont die globale Reichweite und den Einfluss der Serien, sowie den wirtschaftlichen Erfolg für die produzierenden Sender.
Das Genre Soap Opera: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte und die Merkmale des Genres "Soap Opera". Es wird die Entwicklung von der Commedia dell'arte über Fortsetzungsromane bis hin zu den ersten Radio- und Fernsehserien nachgezeichnet. Die Bedeutung melodramatischer Elemente, die chronologische Erzählweise mit Unterbrechungen und die Verwendung der "Salamitechnik" werden hervorgehoben. Der Ursprung des Begriffs "Soap Opera" im Zusammenhang mit der Produktplatzierung von Waschmitteln wird erklärt. Schließlich werden unterschiedliche Serienmodelle, darunter das Modell der abgeschlossenen Folgen und das Saga-Modell, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Dallas, Denver Clan, Soap Opera, Fernsehserien, Rezeption, Erfolg, Melodrama, Intrigen, Identifikation, Triviale Unterhaltung, Medienwissenschaft, Kulturpolitik, 80er Jahre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von "Dallas" und "Denver Clan"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Erfolg der Fernsehserien "Dallas" und "Denver Clan". Im Fokus stehen die Gründe für ihre anhaltende Popularität und eine kritische Auseinandersetzung mit der gängigen Kritik als "triviale Unterhaltung".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Genre Soap Opera, die Produktionsweise und dramaturgischen Merkmale von "Dallas" und "Denver Clan", die Faktoren ihres Erfolgs (Identifikationspotenzial, Intrigen, Charaktere), die gesellschaftliche Rezeption und die damit verbundenen Debatten sowie die Frage nach "trivialen Unterhaltung" im Kontext der Serien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Vorbemerkungen", "Das Genre Soap Opera", "Die Machart von Dallas und Denver-Clan", "Gründe für den lang anhaltenden Erfolg der beiden Soaps", "Die Rezeption von Dallas und Denver-Clan" und "Schlussbetrachtungen".
Was wird in den Vorbemerkungen behandelt?
Die Einleitung beschreibt die kontroverse Rezeption von "Dallas" und "Denver Clan", ihren immensen Erfolg, die scharfe Kritik, die globale Reichweite, den Einfluss der Serien und den wirtschaftlichen Erfolg für die produzierenden Sender.
Was wird im Kapitel "Das Genre Soap Opera" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte und Merkmale des Genres "Soap Opera", von der Commedia dell'arte über Fortsetzungsromane bis hin zu Radio- und Fernsehserien. Es werden melodramatische Elemente, die chronologische Erzählweise mit Unterbrechungen, die "Salamitechnik", der Ursprung des Begriffs "Soap Opera" und unterschiedliche Serienmodelle (abgeschlossene Folgen, Saga-Modell) behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dallas, Denver Clan, Soap Opera, Fernsehserien, Rezeption, Erfolg, Melodrama, Intrigen, Identifikation, Triviale Unterhaltung, Medienwissenschaft, Kulturpolitik, 80er Jahre.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Erfolg von "Dallas" und "Denver Clan" im Kontext ihres Genres, ihrer Produktionsweise und ihrer Rezeption. Ziel ist es, die Gründe für ihre anhaltende Popularität zu analysieren und die Kritik als "triviale Unterhaltung" zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Sven Weidner (Autor:in), 2005, Die Fernsehserien "Dallas" und "Denver Clan". Nur triviale Unterhaltung? , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46345