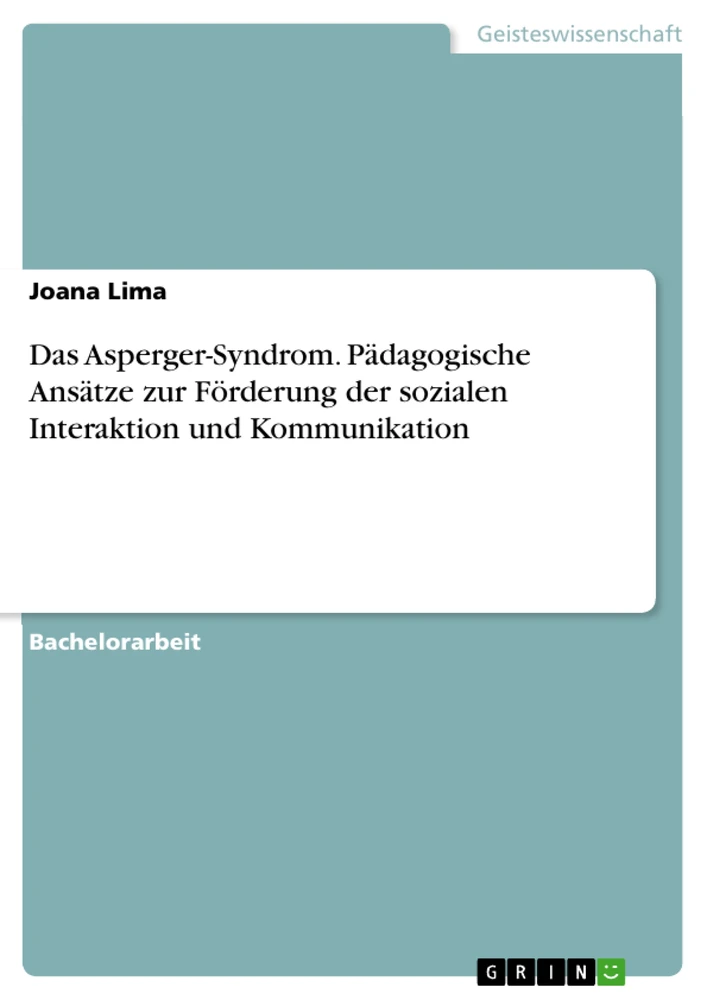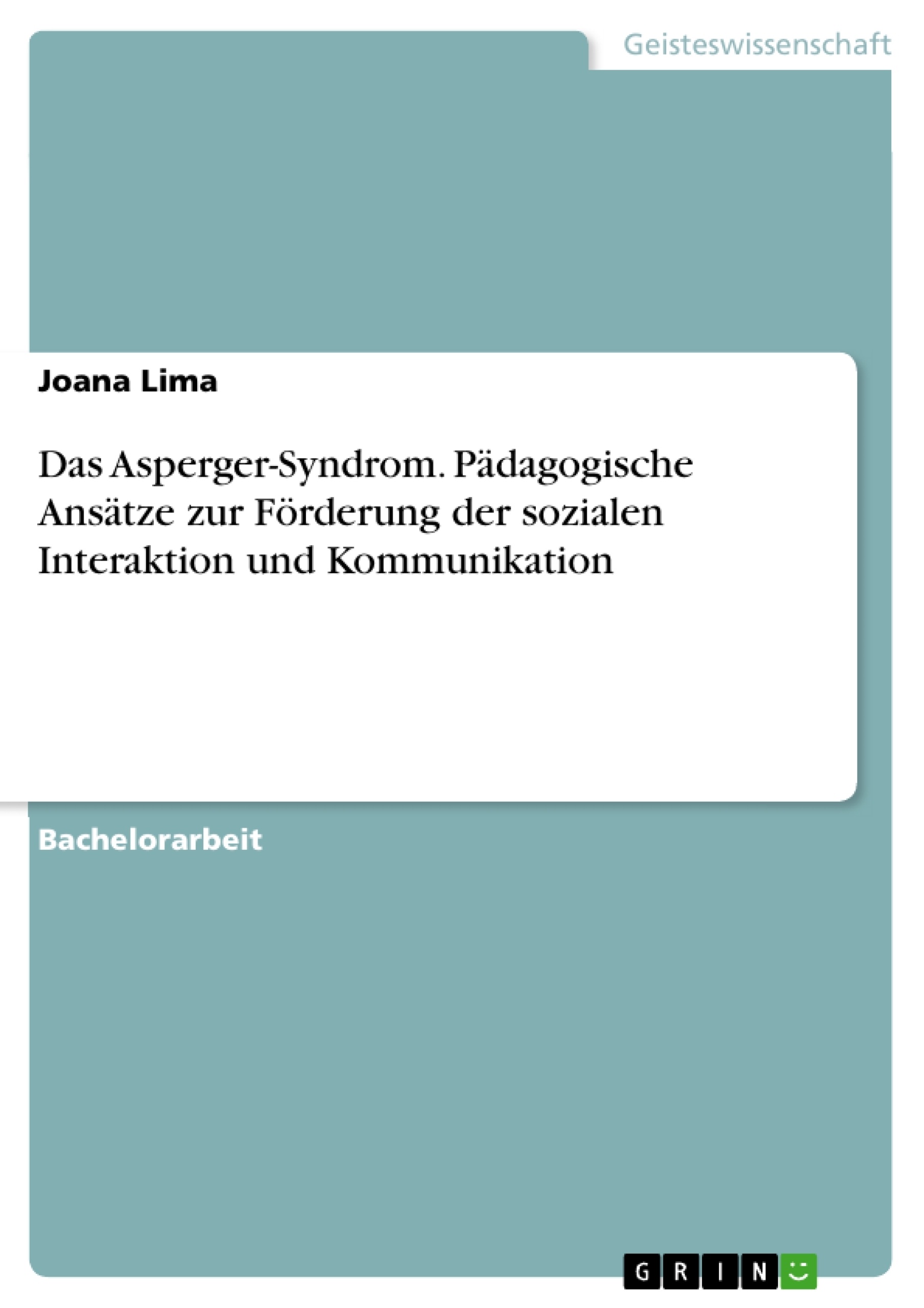“Der Autismus an sich ist keine Hölle. Die Hölle entsteht erst durch eine Gesellschaft, die sich weigert, Menschen zu akzeptieren, die anders sind als die Norm, oder diese Menschen zur Anpassung zwingen will“. Dieses Zitat von einer Asperger-Autistin veranschaulicht die heutzutage vorherrschende strikte Kategorisierung und Stigmatisierung von autistischen Menschen durch die Gesellschaft, ohne Genaueres über ihr Wesen in Erfahrung gebracht zu haben. Gerade Menschen, die nicht der gesellschaftlichen „Norm“ entsprechen und besondere Charakteristiken aufweisen, sollten unser Interesse wecken, mehr über ihren Alltag, ihre Gefühlswelt und ihre Wahrnehmung zu erfahren. Wie fühlen und denken autistische Menschen und wie empfinden sie zwischenmenschliche Beziehungen?
Für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen besteht die grundlegende Schwierigkeit, soziale Signale angemessen aufzunehmen, zu verarbeiten und sie effektiv zu beantworten. Aufgrund dieser Problematik fokussiert sich die vorliegende, literaturbasierte Bachelorarbeit, um unter anderem den letztgenannten entgegenwirken zu können, auf die gezielte Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation von Schülern mit dem Asperger-Syndrom durch Lehrkräfte an Regelschulen mithilfe von geeigneten pädagogischen Fördermaßnahmen. Aus den Gründen, dem Inklusionsgedanken entgegenzukommen und den betroffenen Schülern Unterricht in einem „anregungsreichen und fordernden [inklusiven] Lernmilieu“ zu ermöglichen, das sich als „förderlicher“ für Schüler mit den Schwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“ erweisen soll als das einer Förderschule, fokussiert sich diese Arbeit im Speziellen auf die Beschulung an Regelschulen. Im Hinblick auf den besonderen Fokus auf die Asperger-Autisten, denen nach Eckert und Volkart (2016) aktuell „eine zunehmende Aufmerksamkeit und Beachtung im Fachdiskurs und in der öffentlichen Berichterstattung“ geschenkt wurde, lässt sich vermuten, dass die anregende Lernatmosphäre sich positiv auf die sozialen Fähigkeiten dieser Zielgruppe auswirken können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Störungsbild Asperger-Syndrom
- 2.2 Klassifikation nach ICD-10 und DSM-V
- 2.3 Symptomatik
- 2.4 Prävalenz und Beschulung
- 3 Inklusion
- 4 Herausforderungen im inklusiven Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit dem Asperger-Syndrom
- 5 Fragestellung
- 6 Empirisch-belegte pädagogische Ansätze zur Förderung von sozialer Interaktion und Kommunikation im Unterricht
- 6.1 Das TEACCH-Programm
- 6.2 Das soziale Kompetenztraining SOSTA-FRA für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung
- 6.3 TOMTASS - Das Theorie-of-Mind-Training
- 7 Diskussion
- 8 Literaturverzeichnis
- 9 Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation von Schülern mit Asperger-Syndrom an Regelschulen. Ziel ist es, geeignete pädagogische Fördermaßnahmen zu identifizieren und einen weiterentwickelten Ansatz für die inklusive Beschulung vorzuschlagen. Die Arbeit beleuchtet den Asperger-Autismus aus verschiedenen Perspektiven, berücksichtigt die Herausforderungen im inklusiven Unterricht und analysiert ausgewählte Förderprogramme.
- Das Störungsbild Asperger-Syndrom und seine Abgrenzung zu anderen Autismus-Spektrum-Störungen.
- Herausforderungen für Lehrkräfte im inklusiven Unterricht mit Schülern mit Asperger-Syndrom.
- Analyse verschiedener evidenzbasierter pädagogischer Förderansätze (TEACCH, SOSTA-FRA, TOMTASS).
- Die Bedeutung der Inklusion für die Beschulung von Schülern mit Asperger-Syndrom.
- Empfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Schulen zur optimalen Förderung von Schülern mit Asperger-Syndrom.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die gesellschaftliche Stigmatisierung von Autismus und die Notwendigkeit, mehr über die Wahrnehmungs- und Gefühlswelt autistischer Menschen zu erfahren. Sie betont die Schwierigkeiten im Umgang mit sozialen Signalen und fokussiert auf die gezielte Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation von Schülern mit Asperger-Syndrom an Regelschulen im Rahmen der Inklusion. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, geeignete pädagogische Fördermaßnahmen zu analysieren und einen verbesserten Ansatz für die inklusive Beschulung vorzuschlagen, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Asperger-Autisten und der Herausforderungen für Lehrkräfte.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Asperger-Syndrom als tiefgreifende Entwicklungsstörung innerhalb des Autismus-Spektrums. Es differenziert das Asperger-Syndrom von anderen Autismus-Formen (frühkindlicher Autismus, atypischer Autismus) hinsichtlich Symptomatik, kognitiver Entwicklung und sprachlicher Fähigkeiten. Die Kapitel beleuchtet die Klassifizierung nach ICD-10 und DSM-V und geht auf Prävalenz und aktuelle Beschulungssituationen ein, um das Verständnis für die Herausforderungen im Umgang mit Asperger-Autisten zu vertiefen. Die Kapitel legt den Grundstein für die spätere Diskussion pädagogischer Fördermaßnahmen.
Schlüsselwörter
Asperger-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung, Inklusion, soziale Interaktion, Kommunikation, pädagogische Fördermaßnahmen, TEACCH, SOSTA-FRA, TOMTASS, inklusive Beschulung, Regelschule, Lehrkräfte, Herausforderungen im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation von Schülern mit Asperger-Syndrom an Regelschulen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation von Schülern mit Asperger-Syndrom im inklusiven Regelschulunterricht. Ziel ist die Identifizierung geeigneter pädagogischer Fördermaßnahmen und die Entwicklung eines verbesserten Ansatzes für die inklusive Beschulung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Störungsbild Asperger-Syndrom, seine Abgrenzung zu anderen Autismus-Spektrum-Störungen, die Herausforderungen im inklusiven Unterricht, die Analyse evidenzbasierter Förderansätze (TEACCH, SOSTA-FRA, TOMTASS), die Bedeutung der Inklusion und praktische Empfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Schulen.
Welche Förderprogramme werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Förderprogramme TEACCH, SOSTA-FRA und TOMTASS hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation bei Schülern mit Asperger-Syndrom.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund (inkl. Klassifizierung nach ICD-10 und DSM-V, Symptomatik und Prävalenz), ein Kapitel zur Inklusion, ein Kapitel zu den Herausforderungen im inklusiven Unterricht, die Fragestellung, die Analyse der Förderprogramme, eine Diskussion, ein Literaturverzeichnis und ein Abbildungsverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, geeignete pädagogische Fördermaßnahmen für Schüler mit Asperger-Syndrom zu identifizieren und einen weiterentwickelten Ansatz für deren inklusive Beschulung vorzuschlagen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Asperger-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung, Inklusion, soziale Interaktion, Kommunikation, pädagogische Fördermaßnahmen, TEACCH, SOSTA-FRA, TOMTASS, inklusive Beschulung, Regelschule, Lehrkräfte, Herausforderungen im Unterricht.
Welche Herausforderungen im inklusiven Unterricht werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen Lehrkräfte im inklusiven Unterricht mit Schülern mit Asperger-Syndrom begegnen.
Welche Empfehlungen gibt die Arbeit?
Die Arbeit gibt Empfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Schulen zur optimalen Förderung von Schülern mit Asperger-Syndrom.
Wie wird das Asperger-Syndrom in der Arbeit eingeordnet?
Die Arbeit ordnet das Asperger-Syndrom als tiefgreifende Entwicklungsstörung innerhalb des Autismus-Spektrums ein und differenziert es von anderen Autismus-Formen.
Was ist der Fokus der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die gesellschaftliche Stigmatisierung von Autismus, die Notwendigkeit mehr über die Wahrnehmungs- und Gefühlswelt autistischer Menschen zu erfahren und fokussiert auf die gezielte Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation im inklusiven Kontext.
- Citar trabajo
- Joana Lima (Autor), 2018, Das Asperger-Syndrom. Pädagogische Ansätze zur Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463465