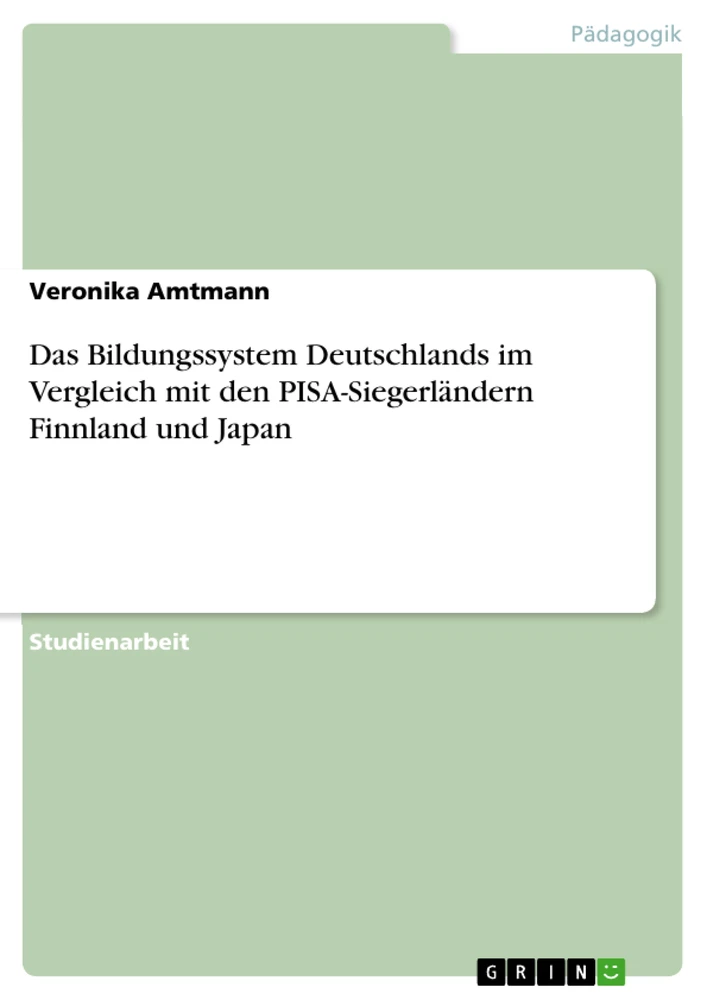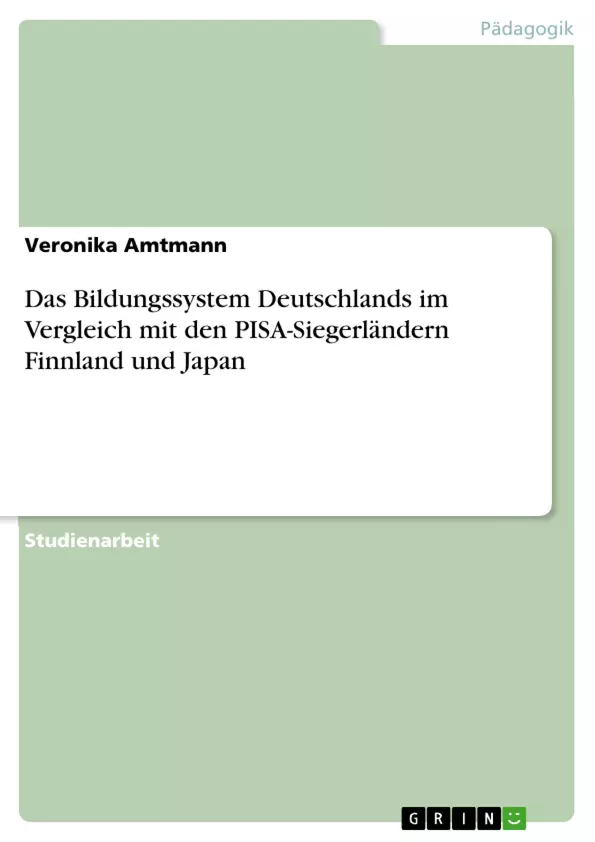PISA ist ein Teil des Indikatorprogramms der OECD, das zur langfristigen Erfassung von Schülerleistungen im internationalen Bereich dient. Das Ziel ist es den OECD-Staaten vergleichende Daten über die Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen. Dabei beteiligten sich im Frühjahr 2000 erstmals 28 Staaten. Seitdem wird der standardisierte Test im dreijährigen Rhythmus fortgeführt. Dabei werden die Kenntnisse in den drei Litacy Domänen Leseverständnis, Naturwissenschaften und Mathematik, sowie Lern- und Denkstrategien, Lernmotivation, Selbstkompetenz, fachliches Interesse und Schulfreude bei einer Altersstichprobe von 15-Jährigen geprüft. PISA ist als large-scale studies insofern besonders, da die Ergebnisse öffentlich zugänglich und damit von besonderem Interesse sind. Gerade das öffentliche Interesse an PISA ist groß, da vor allem die Platzierung der nationalen Ergebnisse im internationalen Ranking verfolgt werden. Dabei dient das Ranking als Anlass für Reform- und Finanzierungsvorschläge im nationalen Bereich. Nach dem Erscheinen der ersten Ergebnisse im Jahr 2001, in dem Deutschland unterdurchschnittlich schlecht abschnitt, kam es in Deutschland zum sogenannten ‚PISA-Schock‘. Daraufhin entschloss sich die Politik das Bildungsangebot zu verbessern, indem das deutsche Bildungswesen modernisiert werden sollte. Zwar gab es bereits 1990 Überlegungen und Pläne zur Modernisierung des Bildungswesens, allerdings wurde erst durch die erschreckenden Ergebnisse der PISA-Studie ein intensiver bildungspolitischer Aktionismus ausgelöst. Zwar wurden deutsche Schulen und das Bildungssystem der Bundesrepublik nach den Ergebnissen des PISA-Schocks reformiert und auch die Ergebnisse der darauffolgenden PISA Studien verbesserten sich erheblich, trotzdem zählt Deutschland noch immer nicht zu den „Siegerländern“ der PISA-Studie. Seit dem Beginn der Erhebung ist auffällig, dass die Länder Finnland, China, Japan, Kanada und Südkorea häufig die vorderen Plätze des Rankings belegen, wohingegen sich Deutschland lediglich im oberen Mittelfeld verorten lässt. In dieser Arbeit soll geklärt werden, inwiefern sich die Bildungssysteme der „PISA-Siegerländer" zu Deutschland unterscheiden. Dabei wird im Rahmen der Arbeit vor allem auf den europäischen Vorreiter Finnland, sowie für den asiatischen Raum exemplarisch auf Japan eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das deutsche Schulsystem
- 2.1 Das finnische Schulsystem
- 2.2 Das japanische Schulsystem
- 3. Schulsysteme im Vergleich
- 3.1 Schulpolitische Entscheidungsfindungen in Finnland
- 3.2 Schulpolitische Entscheidungsfindungen in Deutschland
- 3.3 Schulpolitische Entscheidungsfindungen in Japan
- 4. Beruf und Ausbildung der Lehrer*innen im Vergleich
- 5. Abschlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das deutsche Bildungssystem im Vergleich mit den PISA-Siegerländern Finnland und Japan. Sie zielt darauf ab, die Unterschiede in den Bildungssystemen hervorzuheben und zu untersuchen, welche Faktoren zum Erfolg der PISA-Siegerländer beitragen.
- Analyse der Unterschiede in den Bildungssystemen Deutschlands, Finnlands und Japans
- Bewertung der deutschen Bildungsreformen im Kontext der PISA-Ergebnisse
- Untersuchung der Bedeutung von Schulpolitik und Lehrer*innen-Ausbildung für den Bildungserfolg
- Identifizierung von Stärken und Schwächen der einzelnen Bildungssysteme
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen für das deutsche Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der PISA-Studie als international vergleichendes Instrument zur Messung von Schülerleistungen. Sie erläutert die Zielsetzung der Studie und die Bedeutung der Ergebnisse für die Bildungssysteme der teilnehmenden Länder. Außerdem wird der „PISA-Schock“ in Deutschland nach den ersten Ergebnissen der Studie und die anschließenden Reformen im Bildungswesen thematisiert.
2. Das deutsche Schulsystem
Das zweite Kapitel stellt das deutsche Schulsystem vor, wobei insbesondere die Grundschule und die Sekundarstufe I näher beleuchtet werden. Dabei werden die verschiedenen Schulformen und die Organisation des Bildungssystems in den Bundesländern dargestellt. Auch die Themen Schulgeldfreiheit, Chancengleichheit und Förderung werden behandelt.
2.1 Das finnische Schulsystem
Im Fokus des dritten Kapitels steht das finnische Bildungssystem, wobei die Besonderheiten der Gesamtschule mit ihrer langen Tradition und den verschiedenen Phasen der schulischen Laufbahn vorgestellt werden. Auch die Rolle von Lehrkräften, die Lernkultur und die Organisation der Schule in Finnland werden beleuchtet.
2.2 Das japanische Schulsystem
Das vierte Kapitel widmet sich dem japanischen Schulsystem. Dabei werden die Organisation des Bildungssystems, die Rolle von Lehrkräften und die Lernkultur in Japan im Vergleich zum deutschen System dargestellt.
3. Schulsysteme im Vergleich
Das fünfte Kapitel vergleicht die Schulsysteme Deutschlands, Finnlands und Japans in Bezug auf die Entscheidungsfindungen in der Schulpolitik, die Ausbildung der Lehrer*innen und die Lernkultur.
4. Beruf und Ausbildung der Lehrer*innen im Vergleich
Im sechsten Kapitel werden die Unterschiede in der Ausbildung und dem Beruf der Lehrer*innen in den drei Ländern beleuchtet, wobei die Schwerpunkte auf der Ausbildung, den Anforderungen an Lehrer*innen und den Arbeitsbedingungen liegen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Bildungssystemen Deutschlands, Finnlands und Japans, wobei insbesondere die Themen Schulpolitik, Lehrer*innen-Ausbildung, Lernkultur und PISA-Ergebnisse im Vordergrund stehen. Weitere wichtige Begriffe sind: Gesamtschule, Schulformen, Chancengleichheit, Schulgeldfreiheit, Bildungsreformen, Bildungserfolg und Vergleichende Schulpädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „PISA-Schock“ in Deutschland?
Der PISA-Schock bezeichnet die öffentliche Bestürzung nach der ersten PISA-Studie im Jahr 2001, bei der deutsche Schüler im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich abschnitten.
Warum ist das finnische Schulsystem so erfolgreich?
Finnland setzt auf eine gemeinsame Gesamtschule für alle Kinder, eine hohe Autonomie der Schulen und eine exzellente Lehrerausbildung, was regelmäßig zu Spitzenplätzen im PISA-Ranking führt.
Welche Besonderheiten hat das japanische Bildungssystem?
Japan zeichnet sich durch eine starke Lernmotivation, eine ausgeprägte Disziplin und eine hohe gesellschaftliche Wertschätzung von Bildung aus, was sich in sehr guten Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften niederschlägt.
Wie unterscheidet sich die Lehrerausbildung in diesen Ländern?
Die Arbeit vergleicht die Anforderungen und Arbeitsbedingungen von Lehrkräften. In Finnland beispielsweise ist der Lehrerberuf hoch angesehen und setzt ein forschungsorientiertes Masterstudium voraus.
Was wird in der PISA-Studie eigentlich getestet?
Geprüft werden bei 15-Jährigen die Bereiche Leseverständnis, Naturwissenschaften und Mathematik sowie Lernstrategien und soziale Kompetenzen.
- Quote paper
- Veronika Amtmann (Author), 2018, Das Bildungssystem Deutschlands im Vergleich mit den PISA-Siegerländern Finnland und Japan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463470