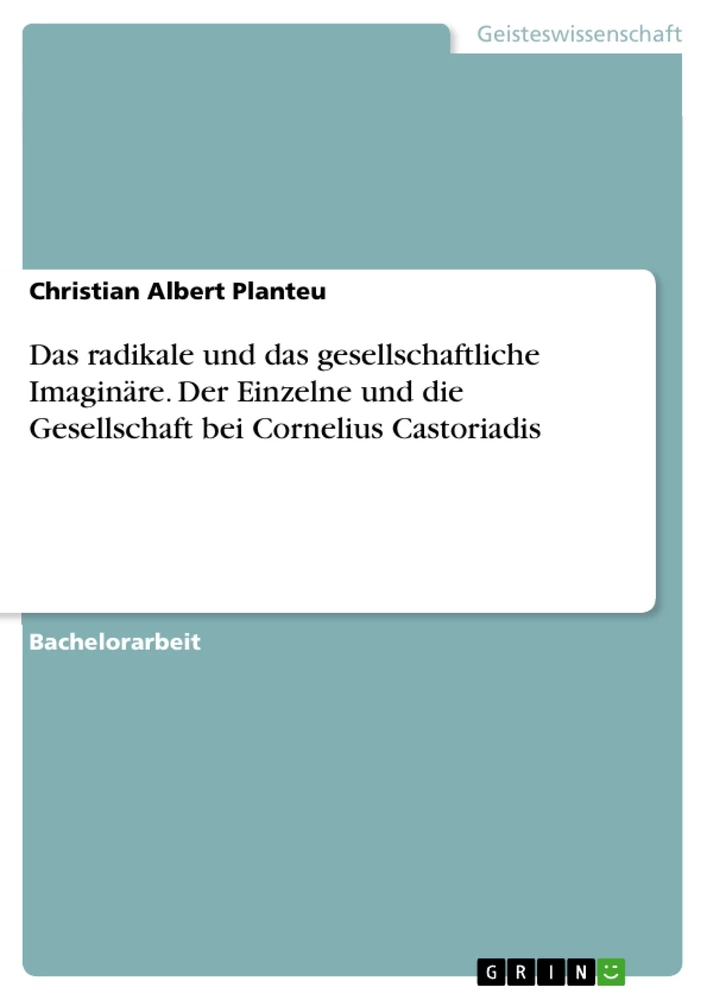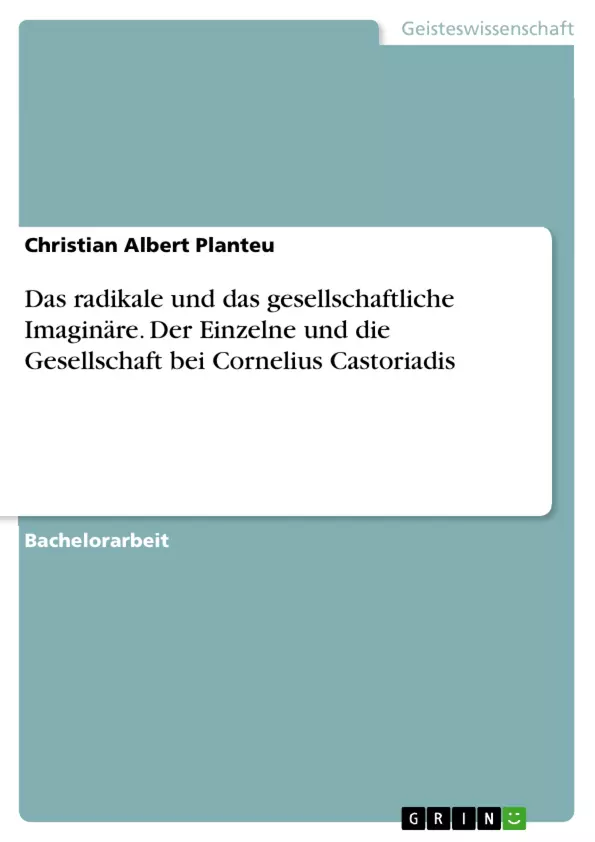Das Sein wurde in der westlichen Philosophiegeschichte immer als ein vollständig beschreibbares System bestimmter Relationen, als etwas sozusagen Dichtes aufgefasst.
Doch zugleich legt der Blick auf die Vielfalt der Weltbilder innerhalb der Weltgeschichte die Vermutung nahe, dass der Mensch selbst das zu erkennende Sein mitschöpft.
Cornelius Castoriadis entwickelte ein radikales Gegenmodell zu aller bisherigen abendländischen Philosophie und einen Ausblick auf eine neue Ontologie, die den schöpferischen Anteil im menschlichen Erkennen der Welt mitberücksichtigen sollte.
Abseits der Konzepte postmoderner Beliebigkeit konstatierte er im einzelnen Individuum und im „anonymen Kollektiv“ einer Gesamtgesellschaft eine Fähigkeit, die das Sein zugleich strukturiert und durch die geschaffene Struktur erkennt: das „Imaginäre“.
Sein Opus magnum „Gesellschaft als imaginäre Institution“ thematisiert ausführlich das Verhältnis von bisheriger Philosophie und „gesellschaftlichem Imaginären“, von Subjekt und Gesellschaft und von Heteronomie und Autonomie des Einzelnen und des Kollektivs. Es endet mit einem Ausblick auf eine mögliche autonome Handhabung des „gesellschaftlichen Imaginären“ durch den Menschen.
Dabei zerfällt das Buch in zwei große Teile: Am Beginn steht die radikale Marxismuskritik des ehemaligen Trotzkisten Castoriadis, aus der sich im Verlauf des ersten Hauptteils eine grundlegende Kritik an der bisherigen abendländischen Philosophie und ihrer „Identitäts- und Mengenlogik“ entspinnt. Der zweite Hauptteil ist in der Hauptsache geprägt durch die Auseinandersetzung mit den Theorien Freuds und durch die Frage des Verhältnisses des Einzelnen zum gesellschaftlichen Imaginären. Eine zentrale Rolle nimmt hierbei die Frage der Sozialisation des Subjektes ein.
Dem entsprechend zerfällt auch die vorliegende Arbeit in zwei Hauptteile, die sich grob gesprochen mit der Genese des Begriffes des Imaginären in „Gesellschaft als imaginäre Institution“ bzw. mit dem Komplex der Sozialisation des Einzelnen beschäftigen. An diese beiden Hauptteile schließt sich ein Kapitel über die Kompatibilität einzelner geschichtsphilosophischer Ansätze mit den Postulaten Castoriadis‘, sowie über die Wechselwirkung seiner Philosophie mit zwei sich in kritischer Nachfolge zur „Annales-Schule“ befindlichen französischen Historikern an.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Konzept des Imaginären
- 1. Castoriadis Kritik an der marxistischen Geschichtsauffassung
- a. Unzulässige Verallgemeinerungen: die Absolutsetzung der kapitalistischen Gesellschaft und der verzerrte Blick auf vorkapitalistische Gesellschaften
- b. Dialektischer Materialismus als verkappter Idealismus
- 2. Identitäts- und Mengenlogik, Einheit des Seins
- a. Widersprüche innerhalb der Identitäts- und Mengenlogik
- b. Die Institution
- 3. Das Magma und der Ausblick auf eine neue Ontologie
- III. Das Subjekt zwischen radikalem Imaginären und gesellschaftlicher Institution
- 1. Das radikale Imaginäre
- a. Der „Ursprung“: die psychische Realität, die „psychische Monade“, das Ungesonderte
- b. Erstes Aufbrechen der psychischen Monade in der „triadischen Phase“
- 2. Subjekt und gesellschaftliches Imaginäres
- a. Vom Ödipuskomplex
- b. Eine Welt von Dingen
- 3. Das gesellschaftliche Individuum
- a. Endgültige Aufgabe der Allmachtsvorstellung des Subjektes
- b. Die Verbindlichkeit des gesellschaftlichen Imaginären für das Subjekt
- c. „Reservate“ des radikalen Imaginären in der Gesellschaft und die Potenz zur Veränderung
- IV. Aus- und Rückblick von der Philosophie Castoriadis' auf Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Philosophie Cornelius Castoriadis und seinem Konzept des „Imaginären“, insbesondere im Kontext seines Hauptwerks „Gesellschaft als imaginäre Institution“. Ziel ist es, das Verhältnis zwischen individueller und gesellschaftlicher Kreativität im Hinblick auf die Gestaltung der Realität zu erforschen, wobei die Kritik an den traditionellen Denkstrukturen der Philosophie eine zentrale Rolle spielt.
- Das „Imaginäre“ als konstitutive Kraft der Gesellschaft
- Kritik an der „Identitäts- und Mengenlogik“ der traditionellen Philosophie
- Die Rolle des Subjekts im Spannungsfeld zwischen radikalem Imaginären und gesellschaftlicher Institution
- Der Einfluss des „Imaginären“ auf die Sozialisation des Einzelnen
- Die Bedeutung des „Imaginären“ für die Geschichtsphilosophie und -wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die zentrale Bedeutung des „Imaginären“ in Castoriadis' Philosophie dar. Das zweite Kapitel beleuchtet Castoriadis' Kritik an der marxistischen Geschichtsauffassung und entwickelt das Konzept des „Imaginären“ im Verhältnis zur „Identitäts- und Mengenlogik“. Das dritte Kapitel widmet sich der Frage nach der Entstehung des Subjekts im Spannungsfeld zwischen radikalem Imaginären und gesellschaftlicher Institution. Es analysiert dabei die Bedeutung des „Imaginären“ für die Sozialisation des Einzelnen und die Herausbildung der gesellschaftlichen Normen und Institutionen. Das vierte Kapitel schließlich befasst sich mit den Implikationen von Castoriadis' Philosophie für Geschichtsphilosophie und -wissenschaft.
Schlüsselwörter
Imaginäres, Gesellschaft, Institution, Subjekt, Sozialisation, Marxismuskritik, Identitäts- und Mengenlogik, Geschichtsphilosophie, Geschichtswissenschaft, Autonomie, Heteronomie, Kreativität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Cornelius Castoriadis unter dem "Imaginären"?
Das Imaginäre ist eine schöpferische Fähigkeit des Einzelnen und des Kollektivs, die das gesellschaftliche Sein zugleich strukturiert und durch diese Struktur erkennt.
Worum geht es in seinem Hauptwerk "Gesellschaft als imaginäre Institution"?
Das Buch thematisiert das Verhältnis von Subjekt und Gesellschaft, die Kritik am Marxismus sowie den Übergang von Heteronomie (Fremdbestimmung) zu Autonomie.
Was kritisiert Castoriadis an der traditionellen Philosophie?
Er kritisiert die "Identitäts- und Mengenlogik", die das Sein als ein vollständig beschreibbares, geschlossenes System von Relationen auffasst.
Welche Rolle spielt die Sozialisation des Einzelnen in seiner Theorie?
Die Arbeit untersucht, wie das Subjekt zwischen seinem "radikalen Imaginären" (psychische Realität) und der Verbindlichkeit der gesellschaftlichen Institutionen geprägt wird.
Was meint Castoriadis mit der "psychischen Monade"?
Es beschreibt den ursprünglichen, ungesonderten Zustand der psychischen Realität des Individuums vor dem Aufbrechen durch gesellschaftliche Einflüsse.
- Quote paper
- Christian Albert Planteu (Author), 2019, Das radikale und das gesellschaftliche Imaginäre. Der Einzelne und die Gesellschaft bei Cornelius Castoriadis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463620