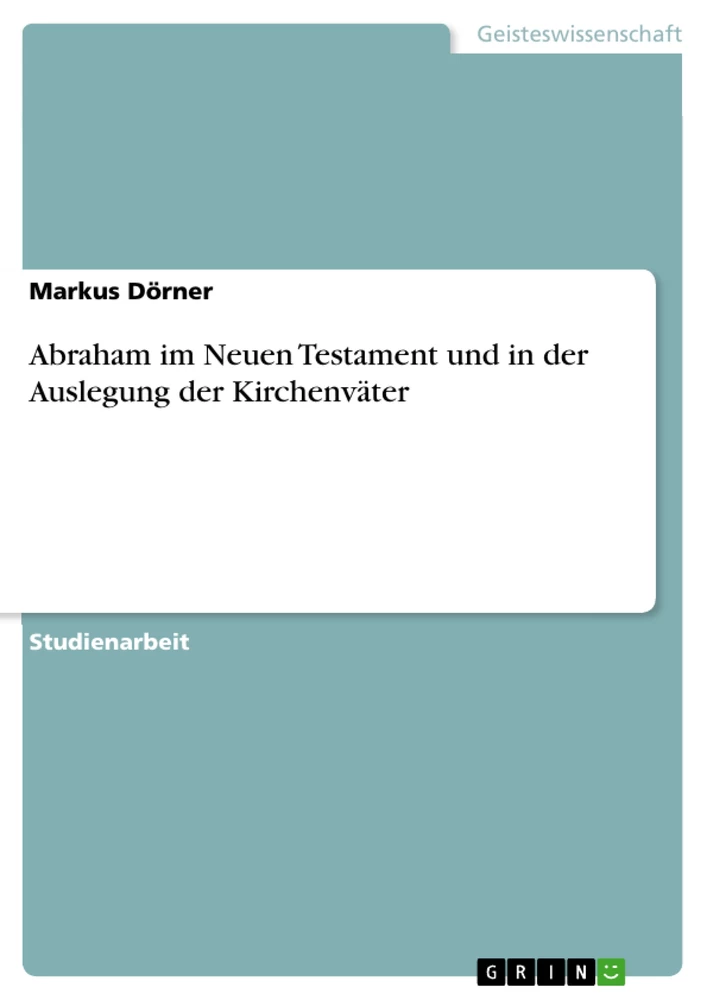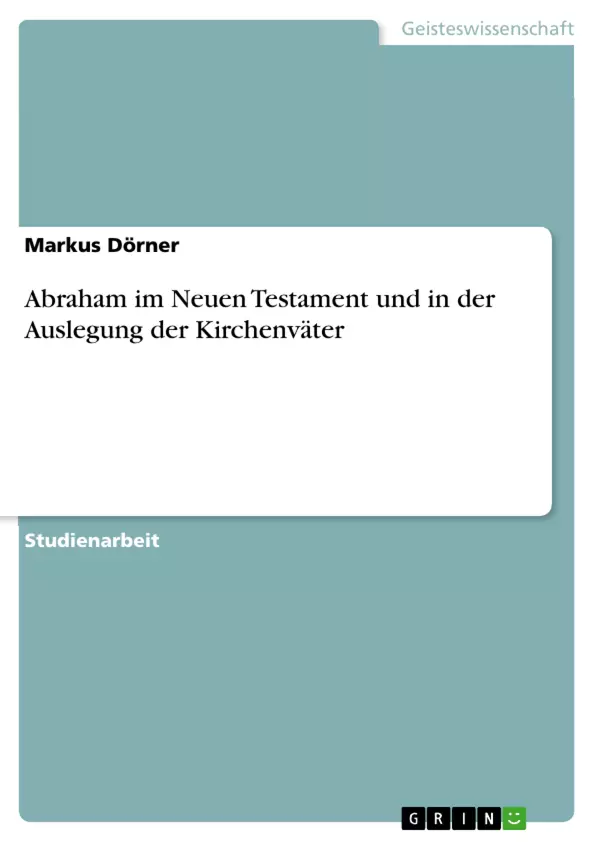Das Thema „Ruhen in Abrahams Schoß“ berührt den Menschen ungeachtet einer Vielfalt an theologischen Interpretationsmustern und einem mancherorts eingeschrittenen Glaubensrelativismus nach wie vor auf eine recht eigentümliche und tiefe Weise. Wer die Stelle Lk 16, 19- 31 liest, bekommt nichts mit von Toleranz und Gleichheit aller Menschen vor dem Gericht des Herrn. Das „Beispiel vom reichen Mann und vom armen Lazarus“, wie es die Einheitsübersetzung überschreibt und welches zum Sondergut des Autoren, Lukas, gehört, berichtet über einen reichen Mann, welcher sich für sämtliche Bedürfnisse des Alltages keine Sorgen zu machen braucht. Vor seiner Tür liegt ein armer Mann, obdachlos, mit Geschwüren am Leib übersät, mit Namen Lazarus, welcher sich von den Brosamen ernähren muß, die der reiche Mann fallen lässt. Als der Bettler stirbt, wird er von den Engeln „in Abrahams Schoß getragen.“ Der reiche Mann stirbt, wobei ihm jedoch die Freuden des Lazarus nicht zuteil werden; er darf sie nur von ferne, aus dem Feuer, sehen. Das Feuer bereitet dem reichen Mann große Qualen; zuerst bittet er um Kühlung seiner Zunge durch den Lazarus, was Abraham ablehnt. Darauf bittet der Reiche, Lazarus möge seine noch auf Erden lebenden Brüder warnen, damit sie nicht an den „Ort der Qual“ gelangen. Abraham lehnt ab; die Brüder würden sich ohnehin nicht bekehren. Das Leben des reichen Mannes wie das des Bettlers endet gleichsam als ein substantielles Gegenüber von Tag und Nacht; die Kontraste dieser beiden Leben sind übergroß. Es stellt sich die Frage, welche Mühen und Gedankenansätze, Anthropologien die Kirche in ihrer langen Geschichte investiert hat, um den Menschen einen Spiegel vorzuhalten, nach dem Gott jeden Menschen prüft, belohnt oder straft. Die These, das Christentum lehre die Gleichheit aller Menschen, ist nur bedingt gültig. Ein Mensch ist zwar in seinem absoluten Wert d. h. seiner Berufung und Bestimmung zu einem letzten, absolut wertvollen, bleibenden Ziel, welches die ewige Kindschaft und Anschauung Gottes ist, gleich wert wie jeder seiner Artgenossen. Jedoch liegt dieses letzte Ziel, dessen Erstrebung ein gelungenes Leben erst ausmacht, unterschiedlich weit weg von allen Menschen. Um das Ziel der vollen, ewigen Anschauung Gottes zu erreichen, müssen bestimmte Wege gegangen werden, von denen nicht abgeirrt werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung...
- II a Biblische Verbindungslinien zu Abraham...
- II b Biblische Verbindungslinien zu Lazarus ...
- III a Biblische Verbindungslinien zum Reich des Todes ………………………….
- III b Der reiche Mann, exegetisch- systematische Reflexion...
- III c Die Hoffnung des Betenden- was bleibt?
- IV. Literaturangaben zur Seminararbeit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lk 16, 19-31 und analysiert dessen Bedeutung in Bezug auf die Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle Abrahams im Gleichnis sowie der Frage, was vom Menschen über den irdischen Tod hinaus bleibt.
- Die Rolle Abrahams im Gleichnis von Lk 16, 19-31
- Die biblische Verbindungslinie zwischen Abraham und Lazarus
- Der Kontrast zwischen dem Leben des reichen Mannes und des armen Lazarus
- Die Bedeutung des „Reiches des Todes“ im Gleichnis
- Die Hoffnung des Betenden und die Frage nach dem Leben nach dem Tod
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema „Ruhen in Abrahams Schoß“ in den Kontext theologischer Interpretationsmuster und Glaubensrelativismus. Sie analysiert das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lk 16, 19-31, wobei der Kontrast zwischen dem Leben des reichen Mannes und dem des armen Lazarus im Vordergrund steht.
II a Biblische Verbindungslinien zu Abraham
Dieses Kapitel beleuchtet die biblische Verbindungslinie zwischen Abraham und dem Gleichnis von Lk 16, 19-31. Es analysiert die Rolle Abrahams als „Vater des Glaubens“ und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen seiner Geschichte in der Heiligen Schrift.
II b Biblische Verbindungslinien zu Lazarus
Der Abschnitt behandelt die biblische Verbindungslinie zwischen Lazarus und dem Gleichnis in Lk 16, 19-31. Es untersucht die Figur des Lazarus als Vertreter der Bedürftigen und Marginalisierten, und setzt ihn in Bezug zum „Reich des Todes“.
III a Biblische Verbindungslinien zum Reich des Todes
Dieses Kapitel untersucht die biblische Verbindungslinie zwischen dem „Reich des Todes“ und dem Gleichnis von Lk 16, 19-31. Es analysiert die Vorstellung vom Leben nach dem Tod in der Bibel, wobei der Fokus auf der Bedeutung des „Reiches des Todes“ als Ort der Qual oder der Ruhe liegt.
III b Der reiche Mann, exegetisch-systematische Reflexion
Der Abschnitt analysiert die Figur des reichen Mannes im Gleichnis von Lk 16, 19-31 aus exegetischer und systematischer Sicht. Es untersucht das Verhalten des reichen Mannes in Bezug auf seine Verantwortung gegenüber den Armen und beleuchtet seine Reaktion auf die Situation nach seinem Tod.
III c Die Hoffnung des Betenden- was bleibt?
Dieses Kapitel thematisiert die Frage nach dem Leben nach dem Tod und analysiert die Hoffnung des Betenden in Bezug auf das Gleichnis von Lk 16, 19-31. Es untersucht die Bedeutung des „Ruhen in Abrahams Schoß“ und stellt die Frage nach dem Schicksal des Menschen nach dem Tod.
Schlüsselwörter
Abraham, Lazarus, Reich des Todes, Gleichnis, Lk 16, 19-31, Leben nach dem Tod, Hoffnung, ewige Kindschaft, Gottesanschauung, relative Werte, Gemeinschaft, Gottesreich, Ungleichgewicht, Überlebenskampf, Gleichgültigkeit, Benachteiligung, Teufelskreis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ruhen in Abrahams Schoß“?
Es ist ein biblisches Bild für einen Ort der Geborgenheit und Seligkeit nach dem Tod, wie es im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus (Lukas 16) beschrieben wird.
Welche Botschaft vermittelt das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann?
Das Gleichnis warnt vor Gleichgültigkeit gegenüber den Armen und betont, dass das irdische Handeln Konsequenzen für das jenseitige Leben hat.
Warum wird Abraham als zentrale Figur im Jenseits dargestellt?
Abraham gilt als „Vater des Glaubens“. In seiner Gemeinschaft zu sein, symbolisiert im biblischen Kontext die höchste Form der göttlichen Anerkennung.
Lehrt das Christentum die absolute Gleichheit aller Menschen?
Zwar sind alle Menschen in ihrem Wert gleich, doch das Gleichnis zeigt, dass Gott den Umgang mit Verantwortung und Privilegien individuell prüft und richtet.
Was ist das „Reich des Todes“ im biblischen Sinne?
Es wird als Ort der Qual für die Unbußfertigen und als Ort der Ruhe (Abrahams Schoß) für die Gerechten beschrieben, getrennt durch eine unüberwindbare Kluft.
Kann man das Schicksal nach dem Tod noch beeinflussen?
Laut dem Gleichnis ist die Entscheidung über das jenseitige Schicksal mit dem Tod endgültig; eine Warnung an die Lebenden durch Verstorbene ist nicht vorgesehen.
- Quote paper
- Markus Dörner (Author), 2010, Abraham im Neuen Testament und in der Auslegung der Kirchenväter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463954