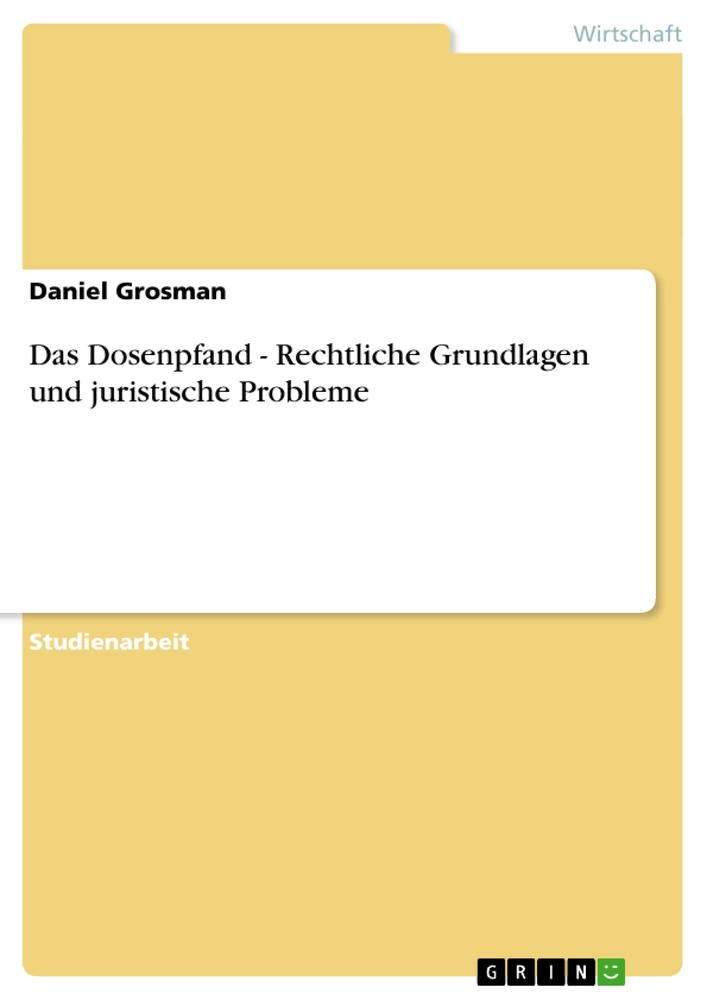„Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.“1 Als die Mitgliedstaaten der EG den sie begründenden Vertrag und damit auch diesen Artikel beschlossen, dachte wohl in der Bundesrepublik Deutschland noch niemand über ein Zwangspfand auf Einwegverpackungen nach. Tatsächlich aber umfasst die oben zitierte Norm jede Art von vorbeugenden Maßnahmen die für den Schutz der Umwelt in der Gemeinschaft nötig sind bzw. werden. Bereits im Jahre 1975 wurde daher vom EP und dem Rat der Europäischen Union die RL 75/442/EWG beschlossen, die schon damals als Priorität „die Vermeidung von Verpackungsabfall und als weitere Hauptprinzipien die Wiederverwertung der Verpackungen, die stoffliche Verwertung und die anderen Formen der Verwertung der Verpackungsabfälle“2 vorgab. Darauf folgten die RL 85/339/EWG vom 27. Juni 1985 über Verpackungen für flüssige Lebensmittel und zuletzt die RL 94/62/EG vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, die frühere Regelungen erneuerte und z.T. außer Kraft setzte. Sinn und Zweck dieser Normen war die Koordinierung und Harmonisierung der Bemühungen zum Umweltschutz unter den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft. Insbesondere mit der RL 94/62/EG sollte „das Funktionieren des Binnenmarktes und die Verhinderung von Handelshemmnissen bzw. Wettbewerbsbeschränkungen innerhalb der EU verhindert werden.“3
Auf einzelstaatlicher Ebene gab es demzufolge entsprechend viele Versuche, den Umweltschutz über Normen zu regeln. In dieser Arbeit wird der deutsche Ansatz untersucht, Getränkeeinwegverpackungen mit einem Zwangspfand zu belegen. Dabei muss zuerst das Regelungskonzept der dafür entwickelten Norm (speziell §§ 8, 9 VerpackV) untersucht werden. Im Folgenden werden die sich daraus ergebenden rechtlichen Probleme – insbesondere die Kollision der Norm mit Art. 3 GG und Art. 12 GG sowie dem Europarecht – untersucht. Außerdem werden Alternativen an- derer Staaten zum Vergleich herangezogen, um ihre Anwendbarkeit auf Deutschland zu prüfen. Eine zusammenfassende Würdigung der Ergebnisse bildet den Abschluss der Untersuchung.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungs- Abfällen
2.1. Das Regelungskonzept der §§ 6, 8, 9 VerpackV
2.1.1. § 6 VerpackV, Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen
2.1.2. § 8 Abs. I VerpackV, Begründung der Pfandpflicht
2.1.3. § 9 VerpackV, Befreiung von der Pfandpflicht und Widerruf der Befreiung
2.2. Ist die Verpackungsverordnung rechtswidrig ? – Grundlagen der VerpackV
3. Verfassungskonformität der Verpackungsverordnung
3.1. Die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. I GG)
a) Schutzbereich
b) Eingriff
c) Verhältnismäßigkeit – zulässiger Zweck
d) Verhältnismäßigkeit – Geeignetheit
e) Verhältnismäßigkeit – Erforderlichkeit
f) Verhältnismäßigkeit – Angemessenheit
3.2. Der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. I GG)
4. Die Verpackungsverordnung im Konflikt mit dem EU-Recht
4.1. Die Pfandpflicht und Art. 23 ff. EGV
4.2. Die Pfandpflicht und die EG-Richtlinie 94/62/EG
a) Betrachtung Art. 5 der Richtlinie 94/62/EG
b) Betrachtung Art. 7 der Richtlinie 94/62/EG
c) Betrachtung Art. 18 der Richtlinie 94/62/EG
5. Zusammenfassung und Ausblick
6. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip.“[1] Als die Mitgliedstaaten der EG den sie begründenden Vertrag und damit auch diesen Artikel beschlossen, dachte wohl in der Bundesrepublik Deutschland noch niemand über ein Zwangspfand auf Einwegverpackungen nach. Tatsächlich aber umfasst die oben zitierte Norm jede Art von vorbeugenden Maßnahmen die für den Schutz der Umwelt in der Gemeinschaft nötig sind bzw. werden. Bereits im Jahre 1975 wurde daher vom EP und dem Rat der Europäischen Union die RL 75/442/EWG beschlossen, die schon damals als Priorität „die Vermeidung von Verpackungsabfall und als weitere Hauptprinzipien die Wiederverwertung der Verpackungen, die stoffliche Verwertung und die anderen Formen der Verwertung der Verpackungsabfälle“[2] vorgab. Darauf folgten die RL 85/339/EWG vom 27. Juni 1985 über Verpackungen für flüssige Lebensmittel und zuletzt die RL94/62/EG vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, die frühere Regelungen erneuerte und z.T. außer Kraft setzte. Sinn und Zweck dieser Normen war die Koordinierung und Harmonisierung der Bemühungen zum Umweltschutz unter den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft. Insbesondere mit der RL94/62/EG sollte „das Funktionieren des Binnenmarktes und die Verhinderung von Handelshemmnissen bzw. Wettbewerbsbeschränkungen innerhalb der EU verhindert werden.“[3]
Auf einzelstaatlicher Ebene gab es demzufolge entsprechend viele Versuche, den Umweltschutz über Normen zu regeln. In dieser Arbeit wird der deutsche Ansatz untersucht, Getränkeeinwegverpackungen mit einem Zwangspfand zu belegen. Dabei muss zuerst das Regelungskonzept der dafür entwickelten Norm (speziell §§8,9 VerpackV) untersucht werden. Im Folgenden werden die sich daraus ergebenden rechtlichen Probleme – insbesondere die Kollision der Norm mit Art.3GG und Art.12 GG sowie dem Europarecht – untersucht. Außerdem werden Alternativen anderer Staaten zum Vergleich herangezogen, um ihre Anwendbarkeit auf Deutschland zu prüfen.
Eine zusammenfassende Würdigung der Ergebnisse bildet den Abschluss der Untersuchung.
2. Die Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen
„Pfandsysteme auf dem Getränkesektor...“[4] haben in Deutschland „...eine lange Tradition“4. Besonders ist dabei hervorzuheben, dass es sich dabei nicht um eine normierte Regelung handelt, sondern die Wirtschaft durch Eigeninitiative ein entsprechendes System aufbaute, in dem die Mehrwegflaschen gegen Abgabe eines Pfandes an den Verbraucher abgegeben werden und dieses Pfand bei Rückgabe erstattet wird. Dagegen wurden Einweggetränkeverpackungen (in Form von so genannten TetraPak`s, Weißblechdosen und Schlauchbeuteln für Milch) weder bepfandet, noch ein Rücknahmesystem aufgebaut. Zwar wurde 1988 „...die PET-Verordnung erlassen, die das In-Verkehr-Bringen von Getränken in Kunststoffverpackungen...“[5] regelte, allerdings wurde diese recht bald wieder aufgehoben und durch die VerpackV ersetzt.[6] Der Erlass dieser Verordnung basiert hauptsächlich auf der Regelung des ehem. § 14 AbfG[7], der eine Spezifizierung der Rücknahme- und Rückgabepflichten desjenigen zulässt, der die Produktverantwortung trägt[8].
Im Folgenden muss allerdings geprüft werden, ob mit dem AbfG bzw. dem KrW-/AbfG der VerpackV überhaupt eine geeignete Ermächtigungsgrundlage zugrunde liegt[9].
Um eine Würdigung der Probleme, die mit der Etablierung der VerpackV und der endgültigen Einführung der Pfandpflicht auf (ausgewählte) Getränkeverpackungen entstanden sind, vornehmen zu können, muss der relativ neue, „auf Rückverlagerung von ökologischer Produktverantwortung zielende Ansatz der Verpackungsverordnung“[10] näher betrachtet werden.
2.1. Das Regelungskonzept der §§ 6, 8, 9 VerpackV
Trotzdem die VerpackV seit 12,5 Jahren implementiert ist, ist sie auch heute immer noch eine der umstrittensten umweltpolitischen Maßnahmen[11] mit der die Umweltpolitik, entgegen der gewohnten präventiven Maßnahmen – Verboten und gefahrenzentrierten Eingriffsermächtigungen –, ungewohnte Wege beschritten hat[12]. Den Kern dieser Verordnung bildet sicherlich der § 6 mit seinen Absätzen II und III. Daneben hat der Gesetzgeber allerdings mit den §§ 8 und 9 ein kompliziertes Regelungsgeflecht[13] entwickelt, das die Begründung und Befreiung (von) der Pfandpflicht steuert.
2.1.1. § 6 VerpackV, Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen
Ziel des § 6 VerpackV ist es, „die Auswirkungen von Abfällen aus Verpackungen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern“[14] und den beschränkten Deponieraum in Deutschland und die öffentliche Abfallentsorgung zu entlasten. Dazu ordnet der §6 VerpackV die Pflicht zur Rücknahme und stofflichen Verwertung der Verpackungen bzw. deren erneute Verwendung durch den Hersteller und Vertreiber an, die gemäß § 6 VerpackV vom Endverbraucher dem Handel zurückgegeben werden. Dagegen werden allerdings diejenigen Hersteller und Vertreiber von der Rücknahmepflicht befreit, die sich an einem System beteiligen, „das flächendeckend im Einzugsgebiet des nach Abs. I verpflichteten Vertreibers eine regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe in ausreichender Weise gewährleistet...“[15] und wenn ein solches System offiziell durch die einzelnen Länder festgestellt wurde. Durch Gründung des Dualen Systems Deutschland AG (DSD) wurde ein solches System erstmals in der Bundesrepublik Deutschland bereitgestellt. Die einzelnen Getränkehersteller konnten sich nun durch Zahlung einer Lizenzgebühr (und damit Beteiligung am DSD) von Ihren Rücknahmeverpflichtungen freikaufen.
2.1.2. § 8 Abs. I VerpackV, Begründung der Pfandpflicht
Im Stufenkonzept der §§ 8 und 9 VerpackV bildet der § 8 Abs. I die erste, die Pfandpflicht begründende, Stufe, wobei ein Pfand i.H.v. 0,25 €[16] bzw. 0,50 € auf alle nach dieser Norm als Getränkeverpackung definierten und in Verkehr gebrachten Verpakkungen erhoben wird, das durch alle Vertriebsstufen von jedem Vertreiber an den nächsten bis hin zum Endverbraucher erhoben und im Wege der Rückgabe auch wieder erstattet wird (Mehrphasenpfand).
2.1.3. § 9 VerpackV, Befreiung von der Pfandpflicht und Widerruf der Befreiung
Diese Norm regelt die Möglichkeit zur Befreiung von der Pfandpflicht, nach dem die Pfandpflicht auf solche Verpackungen keine Anwendung findet, „für die sich der Hersteller oder Vertreiber an einem System nach §6Abs. III beteiligt“[17] (zweite Stufe). Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, sondern die Befreiungsregelung wird aufgehoben (die Pfandpflicht lebt somit wieder auf – nach Regelung des § 9 Abs. II S.2 6 Monate nach Bekanntgabe des zweiten Erhebungsergebnisses – dritte Stufe), wenn die von der Bundesregierung festgestellte Mehrwegquote den Wert von 72 % für alle Massengetränke in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unterschreitet[18]. Das Aufleben der Pfandpflicht gilt in diesem Fall allerdings nur für solche Getränkeverpakkungen, bei denen der festgestellte Mehrweganteil des Jahres 1991 unterschritten wurde. Letztlich können aber auch diese Getränkeverpackungen wieder von der Pfandpflicht befreit werden – der Regelung des § 9 Abs. IV genügt dazu das Wiedererreichen der Mehrwegquoten aus 1991, wonach „die zuständige Behörde auf Antrag oder von Amts wegen eine erneute Feststellung nach § 6 Abs. III zu treffen“[19] hat.
2.2. Ist die Verpackungsverordnung rechtswidrig ? – Grundlagen der VerpackV
Das Problem einer fehlenden Ermächtigungsgrundlage für die VerpackV wird in der Literatur häufig diskutiert und war bereits auch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen von Gegnern der Pfandpflicht (hauptsächlich Brauereien und anderen Getränkeherstellern, Herstellern von Einweggetränkeverpackungen und z.T. auch Vertreiber) und dem Gesetzgeber, wobei u.a. die Rechtmäßigkeit der VerpackV in Frage gestellt wurde.
Gemäß Art. 80 GG hat der Gesetzgeber beim Erlass von Verordnungsermächtigungen „Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung“ ausdrücklich zu bestimmen. „Die VerpackV stützt sich auf die gesetzliche Ermächtigung des (ehem.) §14AbfG.“[20] Insofern müssen die im § 1 a AbfG[21] formulierten Ziele auch Voraussetzung und Zielstellung für die konkretisierende Rechtsverordnung (VerpackV) sein, die gestützt auf § 14 AbfG bzw. § 24 KrW-/AbfG erlassen wurde. Die daraus ableitbare Funktion der Verordnung muss demzufolge die Sicherung der Rückgabe der betroffenen Erzeugnisse (Getränkeeinwegverpackungen) sein, mit dem auch der Schutz der bereits vorhandenen Mehrwegsysteme verbunden sein muss.[22]
Eine (pfandbefreite) Möglichkeit der Rückgabe von Einweggetränkeverpackungen erlaubt die Regelung des §6Abs. III VerpackV, der im Hinblick auf die Gründung des DSD seine endgültige Fassung erhielt. Diese Regelung würde zwar eine Rückgabe der betroffenen Verpackungen ohne Bepfandung erlauben, allerdings sieht das System des „Grünen Punktes“ nicht die eigentlich mit der VerpackV geregelte Rückgabe der Getränkeeinwegverpackungen an den Hersteller bzw. Vertreiber vor, sondern zielt auf die kollektive Sammelung und Verwertung sämtlicher in Umlauf befindlichen Verpackungen ab.[23] Offensichtlich kann auf diese Weise weder der Rücklauf der entsprechenden Verpackungen noch der Erhalt der vorhandenen Mehrwegsysteme gesichert werden, wie es der o.g. Zweck der VerpackV ist.
Anders sieht das allerdings das VG Düsseldorf, dass in seiner Entscheidung vom 3.9.2002 den Schutz der bestehenden Mehrwegsysteme den §§ 8 und 9 VerpackV nicht zuerkennt und seinerseits davon ausgeht, dass das vorgesehene Pflichtpfand ausschließlich zur Sicherung der Rückgabe von Einweggetränkeverpackungen zu verwenden ist.[24] Dies ist bei näherer Betrachtung der Pfandpflicht und ihres Zieles nicht nachvollziehbar und wird auch vom BVerwG widerlegt.[25] Das auferlegte Pfand soll den Verbraucher in der Tat vordergründig dazu bewegen, die erworbenen Getränkeverpackungen beim Händler zurückzugeben.
Die Ansicht, die Pfandpflicht diene ausschließlich der Sicherung der Rückgabe von Einweggetränkeverpackungen (wie dies das VG Düsseldorf sieht), wird auch nach wörtlicher und teleologischer Auslegung der der VerpackV zugrundeliegenden Norm nicht gestützt.
Aus dem Wortsinn des § 24 KrW-/AbfG ergibt sich, wie bereits erwähnt, dass eine Pfandpflicht dazu dienen muss, die Rückgabe der betroffenen Erzeugnisse zu sichern. Trotz alledem müssen die Pfand- und Rücknahmepflichten auch die übergeordneten Ziele des §§ 1 und 22 KrW-/AbfG umsetzen – dies wird sogar im Urteil des VG Düsseldorf ausdrücklich erwähnt[26]. Dies sind u.a. nach Wortlaut des §22Abs. II Nr. 1 KrW-/AbfG u.a. „die Entwicklung, Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die mehrfach verwendbar, technisch langlebig...sind“. Das bedeutet im Klartext der Aufbau und auch die Sicherung bestehender Mehrwegsysteme, wie das bereits vom OVG Berlin festgestellt wurde[27]. Man kann also folgern, dass die Pfandregelung der §§ 8, 9 VerpackV als Instrument zur Förderung der Mehrwegquote durch den Wortlaut der gesetzlichen Ermächtigung des §24Abs.I KrW-/AbfG gedeckt ist, da sie dem Ziel des Gesetzes durch Sicherung der Rückgabe der Getränkeverpackungen entspricht.[28]
Auch eine teleologische Auslegung des KrW-/AbfG unterstützt die Annahme, dass es der VerpackV als gültige Ermächtigungsgrundlage voransteht. Das Ziel des
KrW-/AbfG (und auch das des „alten“ AbfG) „entspricht der „3-V-Philosophie“: Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen“[29]. Besonders im Vordergrund steht dabei nach einhelliger Auffassung die Vermeidung[30] und erst in zweiter Linie die Verwertung von Abfällen, was auch in den das Gesetz konkretisierenden Rechtsverordnungen umgesetzt werden muss. Dies kann auch nicht anders ausgelegt werden, da es im § 4 Abs. I KrW-/AbfG eindeutig heißt: „Abfälle sind in erste Linie zu vermeiden (...) in zweiter Linie stofflich zu verwerten oder zur Gewinnung von Energie zu nutzen (...).“ Deshalb kann die Regelung des § 6 Abs. III VerpackV den Gesetzgeber nicht ausreichend zufrieden stellen, da das daraufhin implementierte System des DSD ausschließlich die (kollektive) Verwertung der eingesammelten Abfälle als Prämisse hat. Trotz der genannten Vorbehalte wurde diese Regelung eingeführt, sicherlich im Hinblick auf die bereits bestehenden, durch die Wirtschaft eingeführten, Mehrwegsysteme, die bereits eine hohe Rücklaufquote der Getränkeverpackungen (nämlich 1991 etwa 72 % aller betroffen Verpackungen) gewährleisteten. Daneben ist der Aufbau eines neuen Rücknahmesystems für Einwegverpackungen mit hohen monetären Belastungen verbunden, wie dies auch wiederholt von der Wirtschaft betont wurde. Es ist dem Gesetzgeber allerdings auch weiterhin vorbehalten, zusätzliche Steuerungsinstrumente zu entwickeln[31], die die Abfallvermeidung fördern, besonders wenn dies durch die in der Wirtschaft entwickelten Systeme nicht mehr gesichert ist, was sich an der rückläufigen Entwicklung der Mehrwegquoten der vergangenen Jahre deutlich ablesen lässt[32]. Im Hinblick auf die bereits weiter oben erwähnte Produktverantwortung der Hersteller und den konsequenten Verweis auf Entwicklung, Herstellung und Inverkehrbringen von mehrfach verwendbaren Produkten durch das KrW-/AbfG kann dies auch nur Ziel der VerpackV und der mit ihr eingeführten Pfandpflicht sein, zumal das übermäßige Inverkehrbringen von Einwegverpackungen der gewollten Produktverantwortung der Hersteller widersprechen würde[33].
[...]
[1] Art. 174 Abs. I EG-Vertrag
[2] aus Präambel der Richtlinie 94/62/EG
[3] dies sind wesentliche Ziele, wie sie in der Richtlinie 94/62/EG benannt sind
[4] Arndt/Fischer, BB 2001, S. 1
[5] Arndt/Fischer, BB 2001, S. 1
[6] Die ursprüngliche VerpackV stammt vom 12.06.1991, wurde jedoch am 21.08.1998 umfassend novelliert bzw.
am 28.08.2000 nochmals geändert.
[7] nach Novellierung im § 24 KrW-/AbfG geregelt
[8] näher hierzu § 22 KrW-/AbfG
[9] siehe Punkt 2.2. dieser Arbeit
[10] di Fabio, NVwZ 1995, S.1
[11] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1420
[12] Vgl. di Fabio, NVwZ 1995, S. 1
[13] Arndt/Fischer, BB 2001, S. 1
[14] § 1 VerpackV
[15] § 6 Abs. III S.1 VerpackV
[16] Für Verpackungen mit einem Volumen bis 1,5 l gilt ein Pfand i.H.v. 0,25 €, für größere Verpackungen ein Pfand i.H.v. 0,50 €.
[17] § 9 Abs. I VerpackV
[18] § 9 Abs. II VerpackV; Die Verkündung des Nacherhebungsergebnisses durch die Bundesregierung erfolgte am 2.7.2002, wodurch eine Pfandpflicht nach der Norm zum Januar 2003 begründet wurde. Dabei unterschritt die festgestellte Mehrwegquote (63,81 %) deutlich den als Vergleich herangezogenen Wert des Jahres 1991.
[19] § 9 Abs. IV VerpackV
[20] di Fabio, NVwZ 1995, S. 2; Das AbfG trat in der der VerpackV von 1991 zugrunde liegenden Form am 27.08.1986 in Kraft, wurde jedoch durch das KrW-/AbfG vom 24.09.1994 abgelöst bzw. novelliert.
[21] Vgl. § 1 KrW-/AbfG
[22] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1421
[23] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1422; Ziel der VerpackV ist wie o.a. die Rückgabe der Verpackung an den Verursacher bzw. die Übertragung der Produktverantwortung auf den Hersteller.
[24] VG Düsseldorf, Urt. v. 3.9.2002 – AZ 17 K 1907/02
[25] BVerwG, Urt. v. 16.01.2003 – AZ 7 C 31/02
[26] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1422und VG Düsseldorf, Urt. v. 3.9.2002
[27] ZUR 2002, 294 f.
[28] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1422
[29] di Fabio, NVwZ 1995, S. 3
[30] z.B. Koch/Reese, NVwZ 2002, S. 1424
[31] § 24 KrW-/AbfG
[32] dabei wird natürlich indiziert, dass der Gebrauch mehrfach verwendbarer Erzeugnisse hierbei ein zentraler Weg zur Abfallvermeidung ist, der auch entsprechend geschützt werden muss, wie dies auch im Aufsatz von Koch/Reese, NVwZ 2002 dargelegt wird
[33] Vgl. Koch/Reese, NVwZ 2002 S. 1423
Häufig gestellte Fragen
Was sind die rechtlichen Grundlagen für das Dosenpfand in Deutschland?
Die rechtliche Basis bildet die Verpackungsverordnung (VerpackV), insbesondere die §§ 8 und 9, die auf dem Abfallgesetz (AbfG) bzw. dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beruhen.
Warum wurde die Pfandpflicht auf Einwegverpackungen eingeführt?
Ziel war es, die Umweltbelastung durch Verpackungsabfälle zu verringern und die Mehrwegquote bei Getränkeverpackungen zu schützen. Wenn die Mehrwegquote unter 72 % sank, lebte die Pfandpflicht für Einwegverpackungen wieder auf.
Gegen welche Grundrechte könnte das Zwangspfand verstoßen?
Diskutiert wird vor allem eine mögliche Kollision mit der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 GG), da bestimmte Marktteilnehmer durch die Regelung stärker belastet werden als andere.
Wie verhält sich das deutsche Dosenpfand zum EU-Recht?
Es besteht ein potenzieller Konflikt mit dem freien Warenverkehr innerhalb der EU (Art. 23 ff. EGV) und der EU-Verpackungsrichtlinie 94/62/EG, da nationale Pfandsysteme Handelshemmnisse im Binnenmarkt darstellen können.
Was ist das Duale System Deutschland (DSD)?
Das DSD wurde geschaffen, um Herstellern eine flächendeckende Rücknahme von Verkaufsverpackungen zu ermöglichen. Durch Beteiligung an diesem System (Lizenzgebühren) konnten sich Unternehmen ursprünglich von individuellen Rücknahmepflichten befreien.
- Quote paper
- Daniel Grosman (Author), 2004, Das Dosenpfand - Rechtliche Grundlagen und juristische Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46423