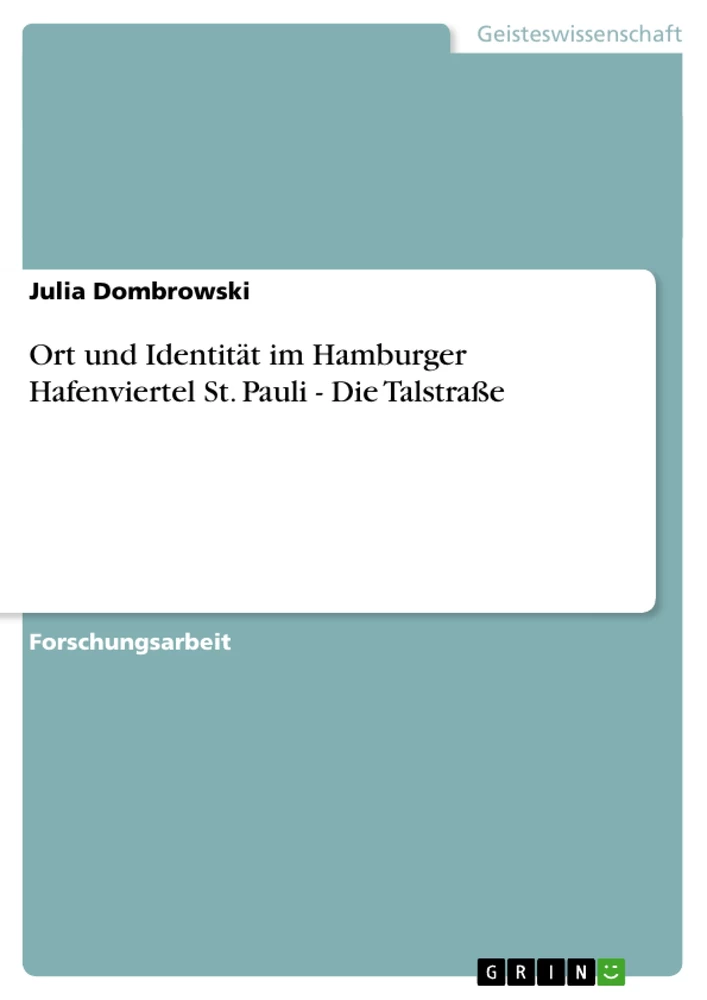St. Pauli genießt den Ruf eines Amüsierviertels, der Prostitution, der Armut und der Gefahr, aber auch der Heterogenität, Toleranz und Vielfalt. Der Begriff St. Pauli wird selten ohne Wertung genannt. Mit dem Viertel wird einerseits sozialer Abstieg, aber auch Lebensqualität verbunden.
"Ort und Identität im Hamburger Hafenviertel St. Pauli - Die Talstraße" ist der sehr persönlich gehaltene Bericht eines ethnologischen Feldforschungspraktikums für die Universität Hamburg. Ich führte es im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft im September/Oktober 2002 und Februar/März 2003 in dem Hamburger Hafenviertel St. Pauli durch. Der Text, fertiggestellt im August 2003, stellt zum einen den Forschungsprozess einer kleinrahmigen, ethnologischen Feldstudie aus studentischer Sicht dar, zum anderen gibt die Verbindungen von Ort und Identität am Beispiel einer Straße auf dem Hamburger Kiez wieder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I - Die Vorbereitungen
- I.1. Vorbereitungen: St. Pauli statt Amazonas - Von Tagträumen zum Feldforschungspraktikum
- I.2. Vorgedanken zur Forschung in der eigenen Stadt
- I.3. Die St. Pauli AG
- I.4. Thema und Themenfindungsprozess
- I.4.1. Zur Wahl der InformantInnen – Anmerkungen zur Talstraße
- I.5. Zur Auswahl der Methoden und Vorgehensweisen
- I.6. Arbeitsbegriffe im Rahmen des Feldforschungspraktikums
- Teil II – St. Pauli: Wohnviertel, Amüsiermeile und ethnologisches Forschungsfeld
- II.1. Zur Geschichte St. Paulis
- II.2. Die Straße als Forschungsschwerpunkt
- II.3. Zwei Wahrnehmungsspaziergänge durch die Talstraße
- II.4. Das Problem, InformantInnen zu finden
- II.4.1. Der „indirekte“ Weg
- II.4.2. Der „direkte“ Weg
- II.4.3. Bürokratie und Feldforschung
- II.5. Zur Auswahl der InformantInnen
- II.5. 1. InformantInnenaufstellung
- II.5.2. Nicht aufgeführte InformantInnen
- Teil III Auswertung
- III.1. Materialaufstellung
- III.2. Die Durchführung der Methoden: Vorgehen, Resultatbeispiele und Reflexion
- III.2.1. Interviews
- III.2.1.1. Grand-Tour Interviews
- III.2.1.2. Leitfragengestützte Interviews
- III.2.5. Mental Maps
- III.2.3. Atlas ti
- III.2.4. Schlagwortsortierungen
- III.2.6. Teilnehmende Beobachtung
- III.2.7. Wahrnehmungsspaziergänge
- Teil IV - Forschungsergebnisse
- IV.1. Warum St. Pauli? - „,...hier ist keine heile Welt!“
- IV.2. Eigenschaften St. Paulis und der PaulianerInnen: Der Titel „Paulianer“
- IV.3. Selbst- und Fremdzuschreibungen in Konflikt: Ruf und Mythos St. Paulis
- IV.3.1. Der Mythos in Hinblick auf Prostitution & Gefahr: Realität und Klischees
- IV.4. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold -Erwünschtes Verhalten auf St. Pauli
- IV.5. Der Unterschied als Gemeinsamkeit - Oberfläche und Untertöne St. Paulis
- IV.6. Zur Datenauswertung und dem Berichtschreiben - Reflexion
- Forschen in der eigenen Stadt - Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit ist ein Bericht über ein Feldforschungspraktikum, das im Hamburger Hafenviertel St. Pauli durchgeführt wurde. Das Ziel der Forschung war es, die Zusammenhänge von Raum und Identität im Viertel zu untersuchen und zu analysieren, wie sich die Wahrnehmung und Identität der Bewohner mit dem spezifischen Raum von St. Pauli verbindet.
- Die Verbindung zwischen Raum und Identität im Hamburger Hafenviertel St. Pauli
- Die Wahrnehmung von St. Pauli durch die Bewohner und deren Identifikation mit dem Viertel
- Die Rolle von Ort und Geschichte in der Gestaltung der Identität der Bewohner
- Der Mythos von St. Pauli und seine Auswirkungen auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Die Analyse von St. Pauli als ein ethnologisches Forschungsfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Feldforschungspraktikum im Hamburger Hafenviertel St. Pauli vor und beschreibt das Forschungsziel, die Zusammenhänge von Raum und Identität im Viertel zu untersuchen. Die Arbeit verortet sich in der Tradition der Community Studies und betrachtet St. Pauli als ein marginalisiertes Gebiet mit einer besonderen Identität.
- Teil I - Die Vorbereitungen: Dieser Teil beschreibt die Vorbereitungen für das Feldforschungspraktikum, die Wahl des Themas, die Auswahl der InformantInnen und die Methoden, die für die Forschung eingesetzt wurden. Er beschreibt auch die Herausforderungen, die mit der Feldforschung in der eigenen Stadt verbunden sind.
- Teil II – St. Pauli: Wohnviertel, Amüsiermeile und ethnologisches Forschungsfeld: Dieser Teil befasst sich mit der Geschichte von St. Pauli, der Besonderheit der Talstraße als Forschungsschwerpunkt und der Suche nach InformantInnen. Es werden die Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Kontakt mit den Bewohnern und der Durchführung von Interviews in St. Pauli beleuchtet.
- Teil III Auswertung: Dieser Teil beschreibt die Auswertung des gesammelten Materials und die Anwendung verschiedener Methoden wie Interviews, Mental Maps und Schlagwortsortierungen. Er beleuchtet die Herausforderungen und Reflexionen im Rahmen der Auswertung und Interpretation des Materials.
- Teil IV - Forschungsergebnisse: Dieser Teil stellt die wichtigsten Forschungsergebnisse vor und untersucht verschiedene Aspekte wie die Wahrnehmung von St. Pauli, die Eigenschaften der PaulianerInnen, die Selbst- und Fremdzuschreibungen und den Mythos von St. Pauli. Es werden auch die Herausforderungen der Berichterstellung und die Reflexionen über die Forschungsergebnisse diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Raum und Identität, St. Pauli als ethnologisches Forschungsfeld, Community Studies, marginalisierte Gebiete, Selbst- und Fremdzuschreibungen, Mythos, Wahrnehmung, Interviewmethoden, Mental Maps, Schlagwortsortierungen, Auswertung und Reflexion. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Zusammenspiels von Raum und Identität im Hamburger Hafenviertel St. Pauli und stellt die besonderen Herausforderungen der Feldforschung in der eigenen Stadt in den Vordergrund.
- Quote paper
- Julia Dombrowski (Author), 2004, Ort und Identität im Hamburger Hafenviertel St. Pauli - Die Talstraße, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46471