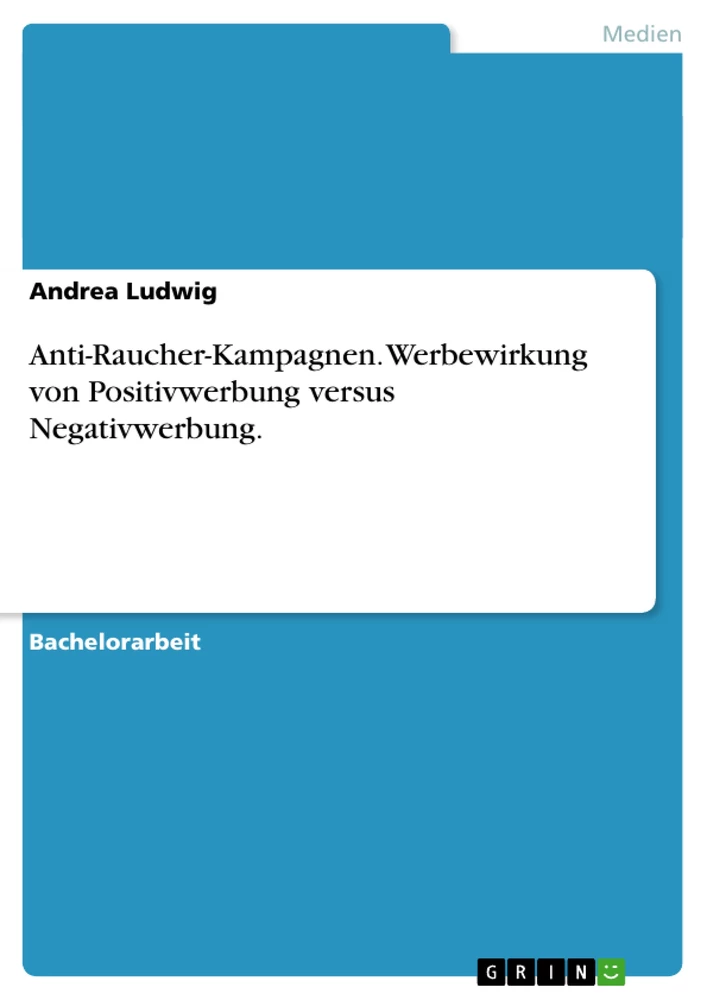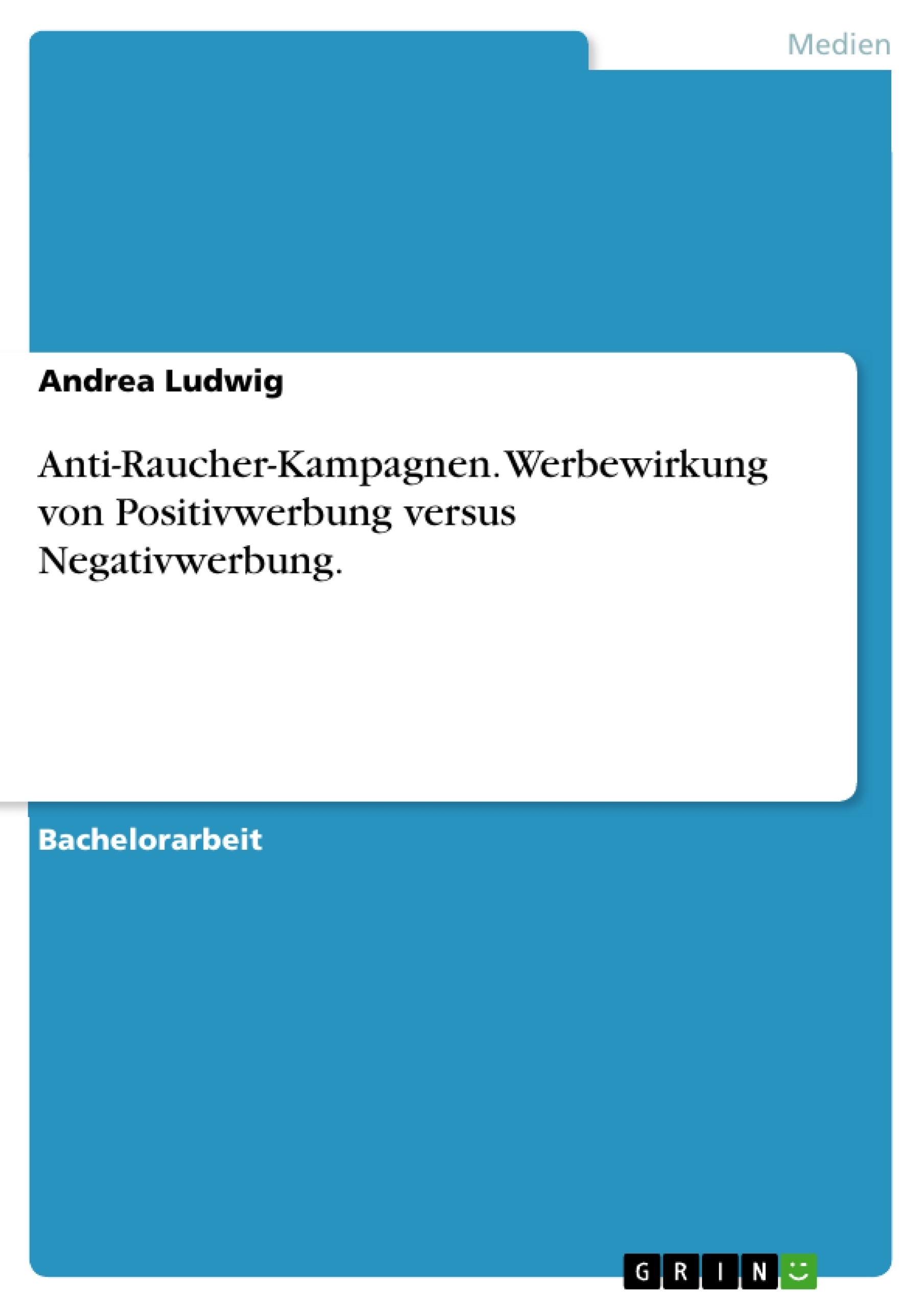Wann beginnen Menschen umzudenken? Trotz steigender gesundheitlicher Auswirkungen des Rauchens, sinkt die Zahl der RaucherInnen nicht ab. Die Politik beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit diesem Thema und setzt Anti-Raucher-Kampagnen als Maßnahme ein, um RaucherInnen von ihrem Laster zu entwöhnen. Die Strategien differieren und trotz aufwändiger Forschungen sind sich PolitikerInnen nicht einig. Die letzte europäische Maßnahme wurde in Form von Warnungen auf den Zigarettenpackungen umgesetzt. In einigen Ländern werden sogar Schockbilder aufgedruckt. Muss Werbung schocken um Aufmerksamkeit und Effizient zu erzielen oder sollte man mit positiven Attributen überzeugen? Genau diese Frage soll innerhalb dieses Buches erläutert werden, wobei mit einigen Überraschungen zu rechnen ist!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN UND GRUNDLAGEN DER ARBEIT
- 1.1. Werbung
- 1.2. Werbung als Kommunikation
- 1.3. Werbepsychologie
- 1.4. Emotionale Werbung
- 1.5. Positivwerbung
- 1.6. Negativwerbung
- 1.7. Werbewirkung
- 1.8. Bildkommunikation und Werbung
- 1.9. Werbewirkungsmodelle
- 1.10. Werbetechniken
- 1.11. Wahrnehmung und Stimulus-Kategorien
- 2. KOMMUNIKATIONSMODELLE DER WERBUNG
- 2.1. S-O-R-Konzept
- 2.2. Überredungskommunikation nach der Hovland-Gruppe
- 2.3. Furchterregende Appelle
- 2.4. Schutzmotivationstheorie von Rogers
- 2.5. Dissonanztheorie nach Festinger
- 2.6. Reaktanz
- 2.7. Immunität
- 2.8. „Parallel response paradigm“ von Leventhal
- 3. WIRKUNG VON NEGATIVWERBUNG
- 4. EINSTELLUNGEN UND VERHALTENSWEISEN
- 4.1. Die 3-Komponenten-Konzeption nach Thomas
- 4.2. Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten
- 5. RAUCHMOTIVE
- 5.1. Aktivierung als Motivation
- 5.2. Allgemeine Motive
- 5.3. Besondere Motive Jugendlicher
- 6. BEISPIEL EINER POSITIVEN ANTI-RAUCHER-KAMPAGNE DER EU „FEEL FREE TO SAY NO“
- 7. UNTERSUCHUNGSABLAUF
- 7.1. Forschungsinteresse
- 7.2. Hypothesen
- 7.3. Methode – Leitfadeninterview
- 7.4. Verwendetes Material
- 7.5. Kurzbeschreibung des verwendeten Materials mit theoretischer Eingliederung
- 8. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
- 8.1. Generalisierte Auswertung
- 8.2. Einzelanalyse
- 8.3. Interpretation der Ergebnisse und theoretische Rückschlüsse
- 8.4. Unterschiede zwischen Warnaufschriften und -bildern
- 8.5. Ergebnisse in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen
- 9. ZUSAMMENFASSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN UND RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Werbewirkung von Positiv- und Negativwerbung am Beispiel von Anti-Raucher-Kampagnen. Ziel ist es, die Effektivität verschiedener Werbeansätze im Kampf gegen das Rauchen zu analysieren und die Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten zu identifizieren.
- Wirkungsweise von Positiv- und Negativwerbung
- Einfluss von emotionalen Appellen (z.B. Angstappelle) auf das Konsumentenverhalten
- Analyse von Kommunikationsmodellen im Kontext der Werbung
- Rolle von Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit dem Rauchen
- Bewertung verschiedener Anti-Raucher-Kampagnen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die hohe Zahl tabakbedingter Todesfälle in der EU und die enormen Kosten, die diese verursachen. Sie führt verschiedene Anti-Raucher-Kampagnen der EU an und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Effektivität von Positiv- und Negativwerbung im Kampf gegen das Rauchen. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz des Themas und führt in die Problematik der Wirkungsweise verschiedener Werbeformen ein.
1. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN UND GRUNDLAGEN DER ARBEIT: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit fest. Es definiert zentrale Begriffe wie Werbung, Werbepsychologie, Positiv- und Negativwerbung, Werbewirkung und Werbewirkungsmodelle. Es dient als Basis für die spätere Analyse und bietet eine systematische Übersicht über die relevanten Konzepte der Werbewirkungsforschung.
2. KOMMUNIKATIONSMODELLE DER WERBUNG: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Kommunikationsmodelle, die relevant für das Verständnis der Werbewirkung sind. Es erklärt Modelle wie das S-O-R-Konzept, Überredungskommunikation, die Schutzmotivationstheorie und die Dissonanztheorie. Die Darstellung dieser Modelle liefert ein analytisches Instrumentarium zur Bewertung der Effektivität verschiedener Werbemaßnahmen.
3. WIRKUNG VON NEGATIVWERBUNG: Dieses Kapitel analysiert speziell die Wirkung von Negativwerbung, insbesondere im Kontext von Gesundheitskampagnen. Es untersucht, wie negative Botschaften und Schockappelle die Einstellungen und das Verhalten der Konsumenten beeinflussen. Die Analyse dieses Kapitels liefert wichtige Erkenntnisse über die potenziellen Stärken und Schwächen von Negativwerbung.
4. EINSTELLUNGEN UND VERHALTENSWEISEN: Dieses Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen im Kontext des Rauchens. Es untersucht die drei Komponenten-Konzeption nach Thomas und analysiert, wie Einstellungen das Verhalten beeinflussen und umgekehrt. Die Erkenntnisse dieses Kapitels bilden eine wichtige Brücke zwischen den theoretischen Grundlagen und der empirischen Untersuchung.
5. RAUCHMOTIVE: Das Kapitel beschreibt verschiedene Motive für das Rauchen, sowohl allgemeine als auch solche, die speziell Jugendliche betreffen. Es wird die Rolle der Aktivierung als Motivationsfaktor erläutert und analysiert, welche Faktoren das Konsumverhalten beeinflussen. Dies dient der besseren Kontextualisierung der Werbewirkung im Bereich der Raucherprävention.
6. BEISPIEL EINER POSITIVEN ANTI-RAUCHER-KAMPAGNE DER EU „FEEL FREE TO SAY NO“: Dieses Kapitel analysiert eine spezifische Anti-Raucher-Kampagne und beleuchtet deren Ansatz, Strategien und mögliche Erfolge. Die detaillierte Betrachtung dieser Kampagne dient als Fallbeispiel und ermöglicht einen konkreten Vergleich mit den im theoretischen Teil dargestellten Modellen und Konzepten.
Schlüsselwörter
Positivwerbung, Negativwerbung, Werbewirkung, Anti-Raucher-Kampagnen, Kommunikationsmodelle, Werbepsychologie, Einstellungen, Verhalten, Rauchmotive, Gesundheitskommunikation, Angstappelle, Schutzmotivationstheorie, Dissonanztheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wirkung von Positiv- und Negativwerbung in Anti-Raucher-Kampagnen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Werbewirkung von Positiv- und Negativwerbung im Kampf gegen das Rauchen. Sie analysiert die Effektivität verschiedener Werbestrategien und identifiziert Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirkungsweise von Positiv- und Negativwerbung, den Einfluss emotionaler Appelle (wie Angstappelle), verschiedene Kommunikationsmodelle in der Werbung, die Rolle von Einstellungen und Verhaltensweisen beim Rauchen, und die Bewertung verschiedener Anti-Raucher-Kampagnen. Die theoretischen Grundlagen umfassen Werbepsychologie, Werbewirkungsmodelle und relevante Theorien wie die Schutzmotivationstheorie und die Dissonanztheorie.
Welche Kommunikationsmodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und erklärt verschiedene Kommunikationsmodelle, darunter das S-O-R-Konzept, die Überredungskommunikation nach Hovland, furchterregende Appelle, die Schutzmotivationstheorie von Rogers, die Dissonanztheorie nach Festinger, Reaktanz, Immunität und das „Parallel response paradigm“ von Leventhal. Diese Modelle dienen der Analyse der Werbewirkung.
Wie wird die Wirkung von Negativwerbung analysiert?
Die Arbeit analysiert speziell die Wirkung von Negativwerbung in Gesundheitskampagnen, untersucht den Einfluss negativer Botschaften und Schockappelle auf Einstellungen und Verhalten und bewertet die potenziellen Stärken und Schwächen dieser Methode.
Welchen Zusammenhang besteht zwischen Einstellungen und Verhalten?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen im Kontext des Rauchens, unter Berücksichtigung der Drei-Komponenten-Konzeption nach Thomas, um zu analysieren, wie Einstellungen das Verhalten beeinflussen und umgekehrt.
Welche Rauchmotive werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Rauchmotive, sowohl allgemeine als auch spezifische Motive von Jugendlichen, und erläutert die Rolle der Aktivierung als Motivationsfaktor. Dies dient dem besseren Verständnis des Konsumverhaltens im Kontext der Raucherprävention.
Welche Anti-Raucher-Kampagne wird als Beispiel analysiert?
Die Arbeit analysiert die EU-Kampagne „Feel Free to Say No“ als Beispiel für eine positive Anti-Raucher-Kampagne. Die Analyse umfasst den Ansatz, die Strategien und die möglichen Erfolge der Kampagne.
Wie ist der Untersuchungsablauf gestaltet?
Der Untersuchungsablauf umfasst die Definition des Forschungsinteresses, die Formulierung von Hypothesen, die Durchführung von Leitfadeninterviews, die Beschreibung des verwendeten Materials und dessen theoretische Einordnung, die Auswertung der Ergebnisse (generalisiert und im Detail) und die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Positivwerbung, Negativwerbung, Werbewirkung, Anti-Raucher-Kampagnen, Kommunikationsmodelle, Werbepsychologie, Einstellungen, Verhalten, Rauchmotive, Gesundheitskommunikation, Angstappelle, Schutzmotivationstheorie, Dissonanztheorie.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das HTML beinhaltet ein ausführliches Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln.
- Citation du texte
- Bakk. Andrea Ludwig (Auteur), 2005, Anti-Raucher-Kampagnen. Werbewirkung von Positivwerbung versus Negativwerbung., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46478