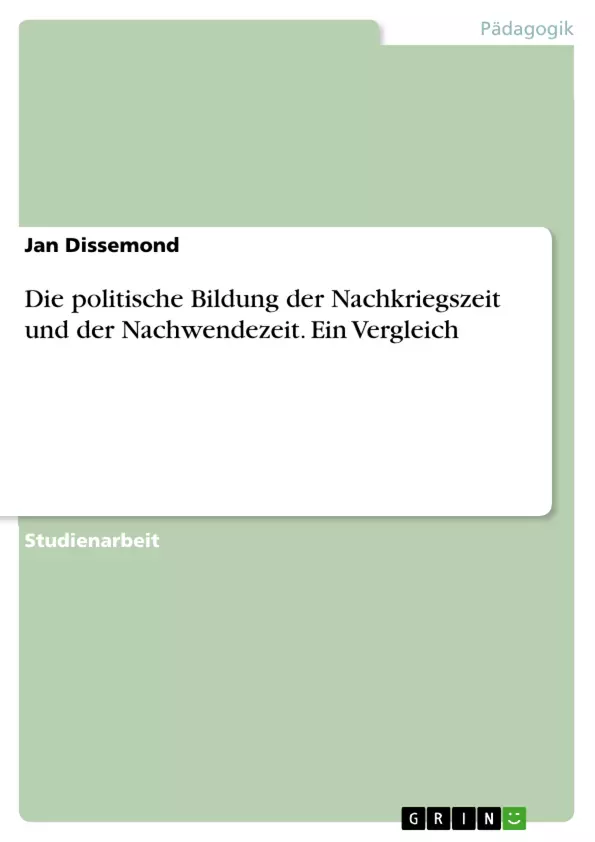Diese Arbeit beschäftigt sich mit der politischen Bildung zur Zeit der Nachkriegszeit sowie der Nachwendezeit. Dabei soll in einer vergleichenden Gegenüberstellung der gesellschaftlichen und schulischen Umstände sowie der zu dieser Zeit stattfindenden politischen Bildung, eine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit politische Bildung einen Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung sowie Umerziehung leisten sollte und kann.
Um sich der Thematik der politischen Bildung anzunähern beginnt die Arbeit mit einem einleitenden Überblick. Dieser bezieht sich mit Schwerpunkt auf die aktuellen Herausforderungen und Ansprüche der politischen Bildung im Schulalltag. Das nachfolgende Kapitel widmet sich der Nachkriegszeit. Zunächst wird die gesellschaftliche Ausgangslage der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben und auf die schulische Situation jener Zeit eingegangen. Damit soll gezeigt werden, unter welchen Gegebenheiten politische Bildung stattfand.
Daraufhin widmet sich die Arbeit der politischen Bildung auf Grundlage der vorangegangenen gesellschaftlichen und schulischen Hintergründe. Hier wird primär auf den amerikanischen Einfluss eingegangen sowie auf den politischen Diskurs von deutscher Seite. Im sich anschließenden Kapitel wird die Nachwendezeit nach gleicher Vorgehensweise analysiert, um eine adäquate Vergleichbarkeit der beiden Epochenzäsuren gewährleisten zu können. Es folgt ein abschließendes Resümee, das eine kritische Auseinandersetzung mit der politischen Bildung generell sowie nach den beiden Epochenzäsuren beinhaltet.
Die andauernde Sensibilität des Diskurses um politische Bildung liegt nicht zuletzt daran, dass in der jüngeren deutschen Geschichte Bespiele für "Fehlformen" der politischen Bildung als Unterrichtsprinzip existieren. Ein klarer Widerspruch zu den, im Beutelsbacher Konsens festgelegten, Richtlinien für politische Bildung geschah in den Unterrichten der Nationalsozialisten sowie in der DDR. In diesen Regimen fand eine künstliche Politisierung der Fächer, eine Indienstnahme des Unterrichts für sachfremde Zwecke sowie eine politische Indoktrination statt. Besonders interessant ist, wie die politische Bildung mit diesen "Fehlformen" in der unmittelbaren Retrospektive umgegangen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. POLITISCHE BILDUNG: EINE EINFÜHRUNG....
- 3. NACHKRIEGSZEIT.
- 3.1 GESELLSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE
- 3.2 SCHULISCHE AUSGANGSLAGE.
- 3.3 POLITISCHE BILDUNG.
- 4. NACHWENDEZEIT
- 4.1 GESELLSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE
- 4.2 SCHULISCHE AUSGANGSLAGE.
- 4.3 POLITISCHE BILDUNG.
- 5. RESÜMEE.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der politischen Bildung in Deutschland, insbesondere im Vergleich der Nachkriegszeit und der Nachwendezeit. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der gesellschaftlichen und schulischen Ausgangslagen sowie der politischen Bildungskonzepte, die in diesen Epochen prägend waren. Die Arbeit strebt danach, herauszufinden, inwieweit politische Bildung zur Vergangenheitsbewältigung und Umerziehung beigetragen hat und welchen Stellenwert sie in beiden Zeitabschnitten einnahm.
- Die Entwicklung der politischen Bildung in Deutschland
- Gesellschaftliche und schulische Ausgangslagen in der Nachkriegszeit und der Nachwendezeit
- Politische Bildungskonzepte in beiden Epochen
- Die Rolle der politischen Bildung bei der Vergangenheitsbewältigung und Umerziehung
- Der Beitrag der politischen Bildung zur Demokratiebildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine einführende Betrachtung der politischen Bildung und ihrer aktuellen Herausforderungen im Schulalltag. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Nachkriegszeit und analysiert die gesellschaftliche und schulische Ausgangslage sowie die damalige politische Bildung, wobei der amerikanische Einfluss und der politische Diskurs in Deutschland im Vordergrund stehen.
Das dritte Kapitel behandelt die Nachwendezeit mit vergleichbarer Methodik. Es beleuchtet die gesellschaftliche und schulische Ausgangslage nach der Wende und untersucht die politische Bildung im Kontext dieser neuen Rahmenbedingungen. Im vierten Kapitel erfolgt ein Resümee, das die politische Bildung in beiden Epochen kritisch beleuchtet und ihren Beitrag zur (Um)Erziehung zur Demokratie in den Mittelpunkt stellt.
Schlüsselwörter
Politische Bildung, Nachkriegszeit, Nachwendezeit, Vergangenheitsbewältigung, Umerziehung, Demokratiebildung, gesellschaftliche Ausgangslage, schulische Ausgangslage, politische Bildungskonzepte, amerikanischer Einfluss, Beutelsbacher Konsens.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die politische Bildung nach 1945 von der nach 1989?
Nach 1945 stand die "Re-education" unter alliiertem Einfluss im Fokus, während nach 1989 die Transformation des DDR-Bildungssystems und die Bewältigung der sozialistischen Indoktrination zentral waren.
Was ist der Beutelsbacher Konsens?
Der Konsens legt drei Grundprinzipien für die politische Bildung fest: das Überwältigungsverbot (keine Indoktrination), die Beachtung kontroverser Themen und die Befähigung der Schüler zur Analyse eigener Interessen.
Welche Rolle spielte der amerikanische Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg?
Die USA trieben Programme zur Demokratisierung voran, um die deutsche Bevölkerung nach der NS-Zeit zu politisch mündigen Bürgern umzuerziehen.
Was sind "Fehlformen" der politischen Bildung?
Darunter versteht man die künstliche Politisierung und Indoktrination in totalitären Regimen wie dem Nationalsozialismus oder der DDR, wo Unterricht für sachfremde Zwecke instrumentalisiert wurde.
Kann politische Bildung zur Vergangenheitsbewältigung beitragen?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass sie ein wesentliches Instrument ist, um totalitäre Strukturen aufzuarbeiten und ein stabiles demokratisches Bewusstsein in Umbruchzeiten zu schaffen.
- Citation du texte
- Jan Dissemond (Auteur), 2019, Die politische Bildung der Nachkriegszeit und der Nachwendezeit. Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465035