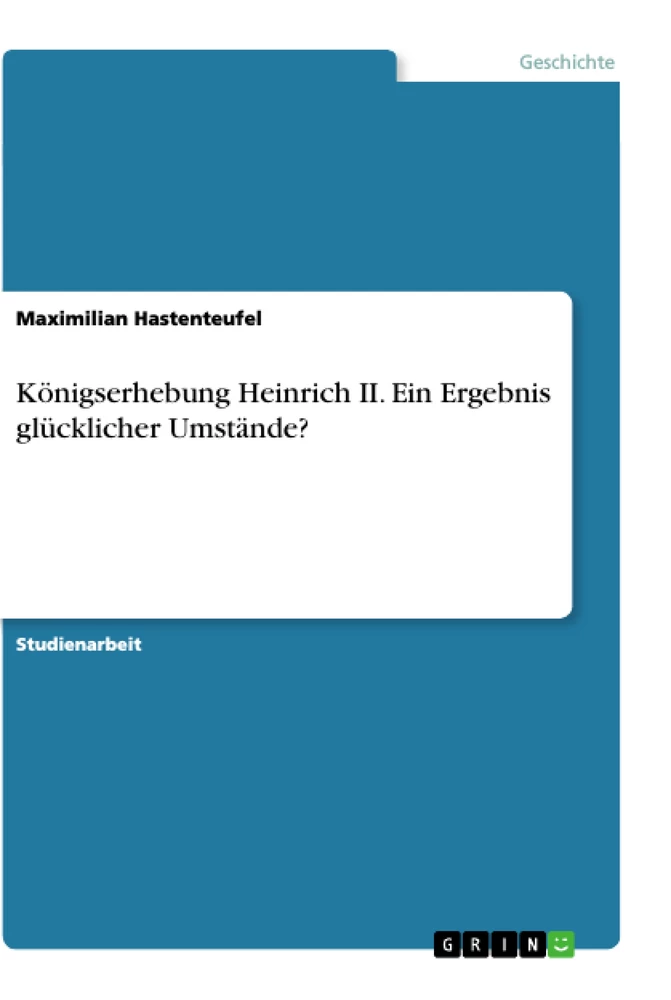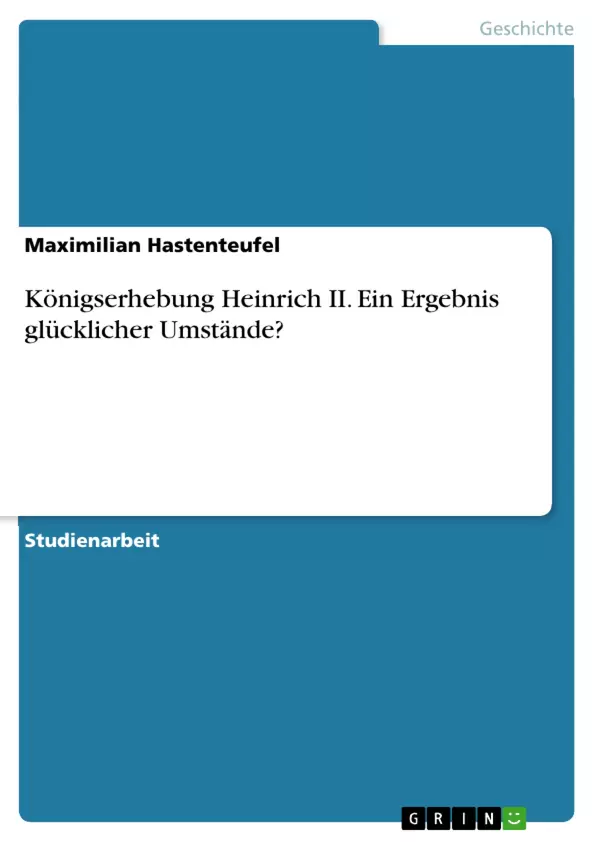Heinrich II. herrschte von 1002 bis 1024 als König des Ostfrankenreichs und von 1014 bis 1024 als römisch-deutscher Kaiser. Er regierte ein Reich, welches von der Nordsee bis zum Mittelmeer reichte, aber differenzierter nicht sein konnte. In meiner Hausarbeit werde ich mich allerdings nur mit der Königserhebung Heinrichs II. befassen. Zeitlich möchte ich mich auf die Ereignisse zwischen dem Tod Ottos III. und dem Krönungsumritt bewegen, mit einer räumlichen Fokussierung auf das Ostfränkische Reich. Ich werde untersuchen inwiefern die Königserhebung Heinrichs II. als Ergebnis glücklicher Umstände gesehen werden kann, oder wieviel in diesem Zusammenhang durchs Heinrichs Aktionen selbst erreicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Chronik Thietmars von Merseburg
- Die Situation nach dem Tod Ottos III.
- Die anderen Thronanwärter
- Otto von Kärnten
- Ekkehard von Meißen
- Hermann von Schwaben
- Faktoren für die Thronerhebung Heinrichs II.
- Durchsetzungsfähigkeit Heinrichs II.
- Zersplitterte Opposition
- Heinrich als Herzog von Bayern
- Kirche als Machtbasis
- Verwandtschaftsverhältnisse
- Kein festgelegtes Thronrecht
- Schlussteil
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Königserhebung Heinrichs II. im Jahr 1002, indem sie die Ereignisse zwischen dem Tod Ottos III. und dem Krönungsumritt betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ostfränkischen Reich und analysiert, inwieweit die Königserhebung von Heinrich II. als Ergebnis glücklicher Umstände oder als Resultat seiner eigenen Aktionen angesehen werden kann. Die Arbeit beleuchtet dabei die Bedeutung der „glücklichen Umstände“ im Sinne eines günstigen Zufalls und untersucht, inwiefern diese den Erfolg Heinrichs II. beeinflusst haben.
- Die Situation nach dem Tod Ottos III. und die Unsicherheit der Thronfolge
- Die verschiedenen Thronanwärter und ihre Chancen und Nachteile
- Faktoren, die bei der Königserhebung Heinrichs II. eine Rolle spielten
- Die Rolle der Kirche und der Verwandtschaftsverhältnisse bei der Thronfolge
- Die Bedeutung der Chronik Thietmars von Merseburg für das Verständnis der Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik und die Zielsetzung der Hausarbeit vor. Sie beleuchtet den Zeitraum, die geografische Begrenzung und die zentrale Frage nach der Rolle des Zufalls und von Heinrichs II. eigenen Aktionen bei seiner Königserhebung.
Hauptteil
Die Chronik Thietmars von Merseburg
Dieser Abschnitt analysiert die Bedeutung der Chronik Thietmars von Merseburg für das Verständnis der Ereignisse. Es werden verschiedene Deutungen der Chronik im Hinblick auf die Memoria als Motiv und die persönliche Beziehung Thietmars zu Heinrich II. betrachtet.
Die Situation nach dem Tod Ottos III.
Dieser Abschnitt beschreibt die Situation im Ostfränkischen Reich nach dem Tod Ottos III. und die Unsicherheit der Thronfolge. Es wird auf die Reaktion des Reiches, die Rolle Erzbischof Heriberts von Köln und die ersten Schritte Heinrichs II. nach dem Tod Ottos III. eingegangen.
Die anderen Thronanwärter
Dieser Abschnitt stellt die anderen Thronanwärter, Otto von Kärnten, Ekkehard von Meißen und Hermann von Schwaben, vor und beleuchtet deren Chancen und Nachteile in Bezug auf die Thronfolge.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Königserhebung Heinrichs II. und untersucht die Bedeutung der „glücklichen Umstände“ und die Rolle Heinrichs II. bei seiner Thronbesteigung. Die Arbeit beleuchtet wichtige Themen wie die Chronik Thietmars von Merseburg, die Situation nach dem Tod Ottos III., die verschiedenen Thronanwärter und die Faktoren, die zur Königserhebung Heinrichs II. beitrugen.
- Citation du texte
- Maximilian Hastenteufel (Auteur), 2018, Königserhebung Heinrich II. Ein Ergebnis glücklicher Umstände?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465397