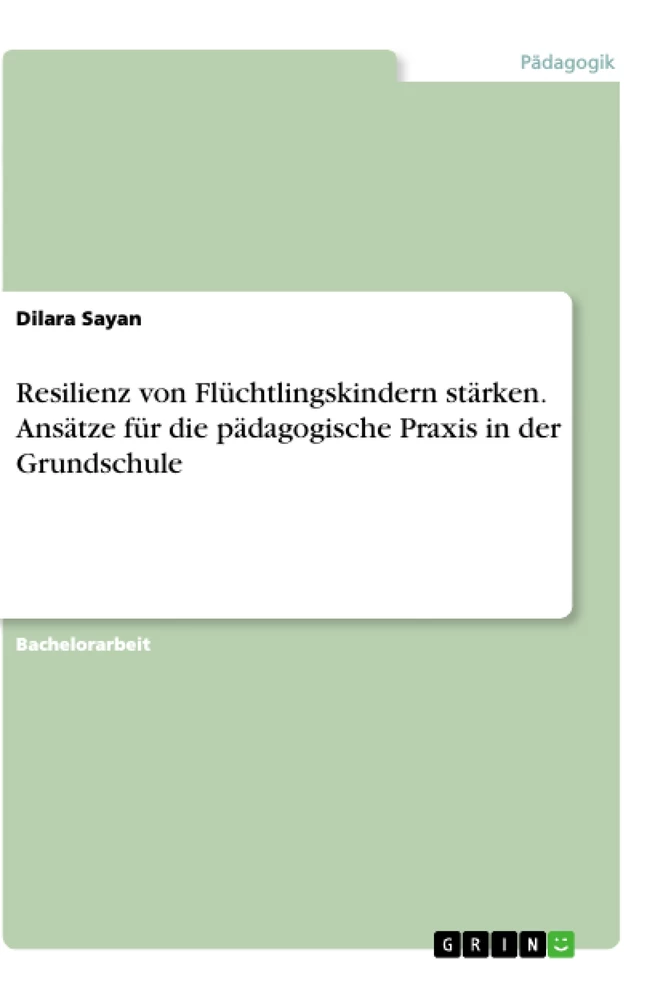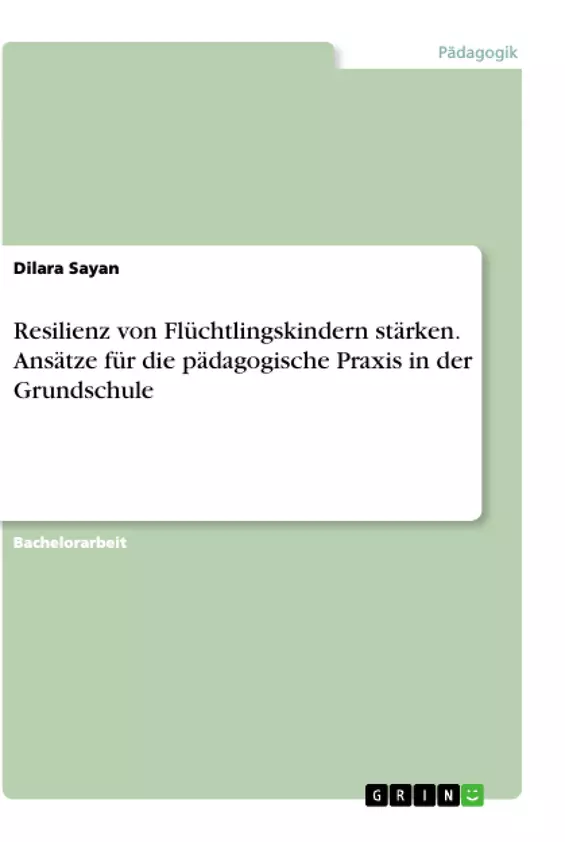In der Schweiz können Menschen Schutz finden, die durch Krieg, Verfolgung oder aus anderen Gründen aus ihrem Heimatland fliehen müssen.
Ein grosser Teil der Geflüchteten besteht aus Kindern und Jugendlichen. So hat das Staatssekretariat für Migration SEM bekannt gegeben, dass zum Beispiel in den Monaten Oktober bis Dezember 2015 ein Drittel aller in die Schweiz geflüchteten Menschen unter 18 Jahre alt war. Diese müssen in der Schweiz beschult werden. Die Integration von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund stellt Schulen vor bestimmte Herausforderungen. Besonders die Arbeit mit Flüchtlingskindern erfordert Sensibilität und Kenntnisse bei den Lehrpersonen sowie die Bereitstellung von Ressourcen. Die schweizerischen Schulen können auf einige Erfahrung mit der Arbeit mit zugewanderten Kindern zurückblicken und haben Kompetenzen entwickelt, wie sie mit der Vielfalt umgehen können, die sich in den Klassen. Auch in Bezug auf Flüchtlingskinder sind sie bereit, ihnen «die bestmögliche Unterstützung und Förderung zu geben» (profilQ 2016, S. 1). Die kantonalen Schulbehörden unterstützen die Lehrkräfte.
Doch wie stellt sich die Lage aus Sicht der Lehrpersonen und pädagogisch Tätigen dar? Bisher liegen kaum Forschungsergebnisse darüber vor, wie sich die Förderung von Flüchtlingskindern für Pädagoginnen und Pädagogen tatsächlich im Schulalltag gestaltet. Die Perspektive der Lehr- und Pädagogikkräfte wird in dieser Arbeit daher im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung und anhand von ExpertInneninterviews sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Erfahrungen mit der Förderung von Flüchtlingskindern im Unterricht gemacht werden. Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie aus Sicht der Professionellen in der Schule die Resilienz von Flüchtlingskindern gestärkt werden kann. Forschungsinteresse und Ziel der Arbeit sind, aus den Beobachtungen Hinweise für die pädagogische Praxis in der Primarschule zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Theorieteil I – Bedeutung und Entwicklung von Resilienz
- 2.1 Kindliche Entwicklung, Vulnerabilität und Coping
- 2.2 Resilienz
- 2.3 Traumatisierte Flüchtlingskinder
- 3 Theorieteil II – Flüchtlingskinder in der Schweiz
- 3.1 Asylverfahren: Zahlen und Unterbringung
- 3.2 Schulsituation
- 4 Theorieteil III – Resilienzförderung durch Lehrpersonen
- 4.1 Beziehungsarbeit
- 4.2 Massnahmen und Förderprogramme in Schulen
- 4.3 Didaktische Möglichkeiten
- 4.4 Traumapädagogik im Rahmen von Schule
- 4.5 Gewaltprävention, Klassendynamik & Beziehungen
- 5 Empiriel - Die qualitative Untersuchung
- 5.1 Beschreibung und Begründung der Methode
- 5.2 Durchführung der Interviews
- 5.2.1 Interview 1: Regelklassenlehrerin
- 5.2.2 Interview 2: Traumapädagogin und Heil- & Sonderpädagoge
- 5.2.3 Interview 3: Primarlehrerin, Berufsanfängerin
- 6 Empirie II - Ergebnisse
- 6.1 Darstellung und Kategorienbildung
- 6.2 Interpretation und Diskussion
- 6.2.1 Sicht auf die Fachkräfte
- 6.2.2 Fachliche Themen
- 6.2.3 Rahmenbedingungen
- 6.2.4 Zusammenführung: Befragung & derzeitige Massnahmen
- 6.3 Grenzen und offene Fragen
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie aus Sicht der Professionellen in der Schule die Resilienz von Flüchtlingskindern gestärkt werden kann. Ziel ist es, aus den Beobachtungen Hinweise für die pädagogische Praxis in der Primarschule zu gewinnen. Die Arbeit untersucht insbesondere die Erfahrungen von Lehrkräften im Umgang mit Flüchtlingskindern und die Möglichkeiten, die Resilienz dieser Kinder zu fördern.
- Resilienz von Flüchtlingskindern
- Erfahrungen von Lehrkräften im Umgang mit Flüchtlingskindern
- Förderung der Resilienz von Flüchtlingskindern
- Pädagogische Ansätze für die Primarschule
- Qualitative Untersuchung durch ExpertInneninterviews
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die aktuelle Situation von Flüchtlingskindern in der Schweiz. Sie erläutert die Relevanz der Thematik und den Fokus auf die Perspektive von pädagogischen Fachkräften.
Der Theorieteil I beleuchtet die Bedeutung und Entwicklung von Resilienz und stellt die Situation von traumatisierten Flüchtlingskindern dar.
Der Theorieteil II widmet sich der Situation von Flüchtlingskindern in der Schweiz, indem er das Asylverfahren und die Schulsituation beleuchtet.
Der Theorieteil III befasst sich mit der Resilienzförderung durch Lehrpersonen, indem er verschiedene Ansätze und Massnahmen sowie didaktische Möglichkeiten beleuchtet.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die qualitative Untersuchung anhand von ExpertInneninterviews und stellt die Ergebnisse der Befragung dar.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Resilienz, Flüchtlingskinder, Pädagogische Praxis, Primarschule, Lehrkräfte, Traumapädagogik und Qualitative Forschung. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Förderung der Resilienz von Flüchtlingskindern durch Lehrpersonen in der Primarschule.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Resilienz bei Flüchtlingskindern?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, trotz belastender Erlebnisse wie Krieg oder Flucht eine gesunde Entwicklung zu nehmen.
Wie können Lehrpersonen die Resilienz von Flüchtlingskindern stärken?
Durch intensive Beziehungsarbeit, die Schaffung eines sicheren Lernumfelds und den Einsatz traumapädagogischer Ansätze im Schulalltag.
Welche Rolle spielt die Traumapädagogik in der Grundschule?
Sie hilft Lehrkräften, Verhaltensweisen traumatisierter Kinder besser zu verstehen und stabilisierende Maßnahmen in den Unterricht zu integrieren.
Vor welchen Herausforderungen stehen Schweizer Schulen bei der Integration?
Herausforderungen sind unter anderem Sprachbarrieren, die psychische Belastung der Kinder durch das Asylverfahren und die Bereitstellung ausreichender Ressourcen für die Förderung.
Was sind didaktische Möglichkeiten zur Förderung dieser Kinder?
Dazu gehören Förderprogramme zur Gewaltprävention, die Stärkung der Klassendynamik und individualisierte Lernangebote, die auf die Vorerfahrungen der Kinder Rücksicht nehmen.
- Quote paper
- Dilara Sayan (Author), 2016, Resilienz von Flüchtlingskindern stärken. Ansätze für die pädagogische Praxis in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465475