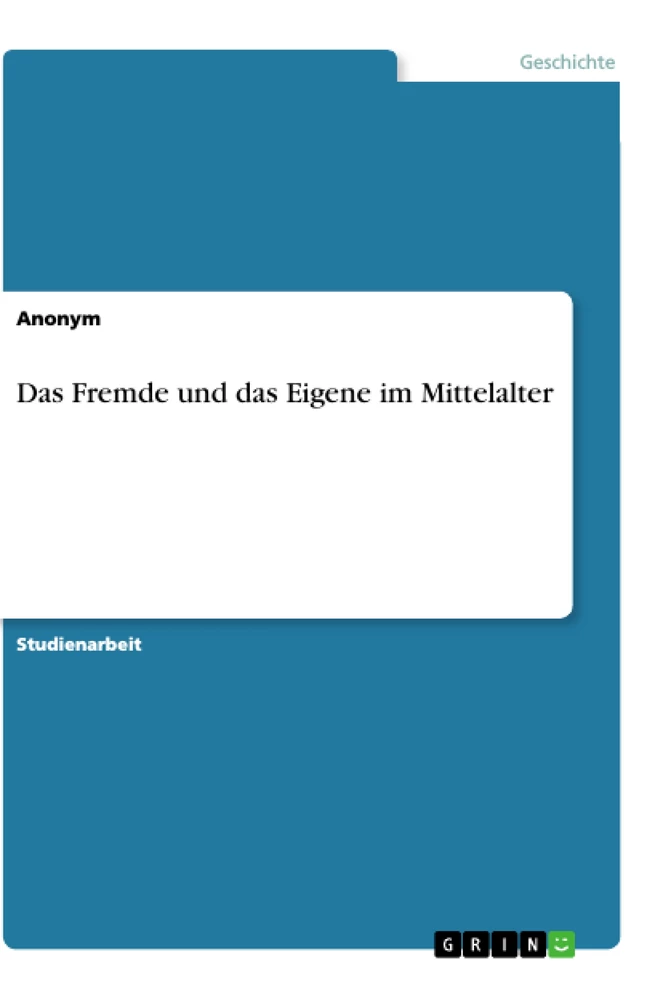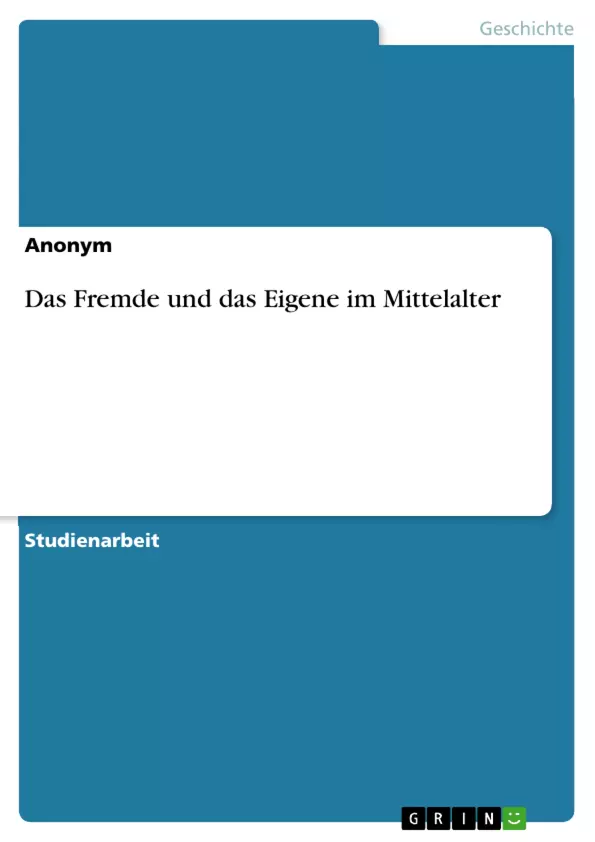In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Studien in verschiedenen Disziplinen mit dem Thema des Fremden und des Eigenen beschäftigt. Diese Arbeit wird zwar häufig unter dem Begriff der Fremdheitsforschung zusammengefasst, zeichnet sich aber vor allem durch eine große Inkonsistenz aus, was nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass sich unterschiedliche Wissenschaften mit unterschiedlichen Traditionen und kognitiven Interessen dem Thema widmen. Die Untersuchungen unterscheiden sich auch innerhalb der einzelnen Disziplinen, sowohl hinsichtlich ihrer methodischen Ansätze als auch hinsichtlich der Verwendung von Schlüsselbegriffen wie Fremdheit. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Fremden und dem Eigenen im Mittelalter. Das erste Kapitel befasst sich mit der Begrifflichkeit der Alterität. Das zweite Kapitel befasst sich mit der ethnozentrischen Weltsicht, wie sie das Fremde und das Eigene gesehen haben. Das letzte Kapitel befasst sich mit der inneren kulturellen Alterität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Begrifflichkeit der Alterität
- II. Die ethnozentrische Weltsicht
- III. Die innere kulturelle Alterität
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von „Fremd“ und „Eigen“ im Mittelalter. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven und Definitionen dieser Begriffe in verschiedenen Kontexten und analysiert, wie diese Konzepte die kulturelle und gesellschaftliche Identität des Mittelalters prägten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die aus dem Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen im Mittelalter resultierten.
- Begriffsbestimmung von Fremdheit und Eigenheit im Mittelalter
- Die ethnozentrische Weltsicht und ihre Auswirkung auf die Wahrnehmung des Fremden
- Die Rolle der Religion (Christentum) in der Konstruktion von Fremdheit und Eigenheit
- Darstellung des Fremden in Literatur und Geschichtsschreibung
- Innere kulturelle Alterität und die Herausforderungen der Selbstfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Fremdheitsforschung ein und hebt die Inkonsistenz bestehender Studien hervor. Sie betont die unterschiedlichen methodischen Ansätze und die divergierende Verwendung von Schlüsselbegriffen wie „Fremdheit“ in verschiedenen Disziplinen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Untersuchung des Konzepts von „Fremd“ und „Eigen“ im Mittelalter, wobei die einzelnen Kapitel die Begrifflichkeit, die ethnozentrische Weltsicht und die innere kulturelle Alterität thematisieren. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende Analyse, indem sie die Notwendigkeit einer präzisen Definition von „Fremdheit“ und die komplexen Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Thema im Kontext des Mittelalters herausstellt.
I. Die Begrifflichkeit der Alterität: Dieses Kapitel befasst sich mit der präzisen Definition des Begriffspaares „Fremd“ und „Eigen“. Es kritisiert die bisherige unzureichende Auseinandersetzung mit dieser Thematik und greift auf die Ansätze von Harbsmeier zurück, um eine systematische Klärung anzustreben. Das Kapitel betont, dass nicht jede Abweichung vom Bekannten als kulturelle Differenz zu verstehen ist. Es beleuchtet die fundamentale Antithese von Eigenem und Fremdem, die von der Antike bis ins Mittelalter bestand und die ständige Spannung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt beschreibt. Die Bedeutung kultureller Kontakte für die Selbstfindung der Gesellschaft wird hervorgehoben, wobei die Polarität von Eigenem und Fremdem als ein unverzichtbares Grundmuster kollektiver Identitätsbildung dargestellt wird. Die Rolle des Christentums mit seinem universellen Anspruch und der damit verbundenen Beurteilung fremder Kulturen anhand christlich-abendländischer Maßstäbe wird angesprochen.
II. Die ethnozentrische Weltsicht: Dieses Kapitel untersucht die ethnozentrische Weltsicht des Mittelalters und deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Fremdem und Eigenem. Es analysiert die Darstellung des Fremden in Literatur und Geschichtsschreibung und beleuchtet die Verwendung von Gegenbildern zur Definition des Selbstbildes. Der jeweilige Machtanspruch bestimmt dabei die Bewertung des Fremden, ob als Priorität oder Feindbild. Das Kapitel veranschaulicht dies anhand der von Volker Rittner beschriebenen positiven und negativen Syndrome, die weit entfernte Beziehungen kennzeichnen: das positive Syndrom, das ferne Länder als Paradiese idealisiert (z.B. fernöstliche Gewürze), und das negative Syndrom, das sie als Orte der Gefahr und des Barbarischen darstellt (z.B. die Mythologie von Gog und Magog). Der Kontrast zwischen dem Vertrauten und dem Unbekannten, der lebensfeindlichen Natur des Raumes außerhalb des Vertrauten, wird ebenfalls erörtert.
III. Die innere kulturelle Alterität: Dieses Kapitel (nur der Titel ist gegeben, der Inhalt fehlt im Ausgangstext) würde sich voraussichtlich mit den internen kulturellen Differenzen innerhalb des mittelalterlichen Europas befassen und zeigen wie diese Differenzen zur Konstruktion von Fremdheit und Eigenheit beitrugen. Mögliche Aspekte könnten soziale Schichtung, regionale Unterschiede oder Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen sein.
Schlüsselwörter
Fremdheit, Eigenheit, Mittelalter, ethnozentrische Weltsicht, kulturelle Alterität, Identität, Christentum, Literatur, Geschichtsschreibung, Gegenbilder, Machtanspruch, Kulturkontakte, Selbstfindung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Fremdheit und Eigenheit im Mittelalter
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Konzepte von „Fremd“ und „Eigen“ im Mittelalter. Er analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und Definitionen dieser Begriffe in verschiedenen Kontexten und untersucht deren Einfluss auf die kulturelle und gesellschaftliche Identität des Mittelalters. Ein Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten, die aus dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen im Mittelalter resultierten.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel (I. Die Begrifflichkeit der Alterität, II. Die ethnozentrische Weltsicht, III. Die innere kulturelle Alterität) und eine Zusammenfassung. Das dritte Kapitel ist im vorliegenden Auszug jedoch unvollständig.
Was ist das Ziel des Textes?
Der Text zielt darauf ab, die Konzepte von „Fremdheit“ und „Eigenheit“ im Mittelalter zu untersuchen und die Inkonsistenzen bestehender Studien zu dieser Thematik aufzuzeigen. Er strebt eine systematische Klärung der Begrifflichkeiten an und analysiert die Auswirkungen der ethnozentrischen Weltsicht auf die Wahrnehmung des Fremden. Weiterhin beleuchtet er die Rolle der Religion und die Darstellung des Fremden in Literatur und Geschichtsschreibung.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Fremdheit, Eigenheit, Mittelalter, ethnozentrische Weltsicht, kulturelle Alterität, Identität, Christentum, Literatur, Geschichtsschreibung, Gegenbilder, Machtanspruch, Kulturkontakte und Selbstfindung.
Wie definiert der Text „Fremdheit“ und „Eigenheit“?
Der Text kritisiert die unzureichende Auseinandersetzung mit der Definition von „Fremd“ und „Eigen“ in bisherigen Studien. Er greift auf Ansätze von Harbsmeier zurück, um eine systematische Klärung anzustreben. Es wird betont, dass nicht jede Abweichung vom Bekannten als kulturelle Differenz zu verstehen ist und die Polarität von Eigenem und Fremdem als Grundmuster kollektiver Identitätsbildung dient.
Welche Rolle spielt die ethnozentrische Weltsicht?
Der Text analysiert die ethnozentrische Weltsicht des Mittelalters und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Fremden. Er untersucht die Darstellung des Fremden in Literatur und Geschichtsschreibung und zeigt, wie der Machtanspruch die Bewertung des Fremden beeinflusst (positive und negative Syndrome nach Volker Rittner).
Welche Rolle spielt das Christentum?
Der Text thematisiert die Rolle des Christentums mit seinem universellen Anspruch und der damit verbundenen Beurteilung fremder Kulturen anhand christlich-abendländischer Maßstäbe. Es wird untersucht, wie der christliche Glaube zur Konstruktion von Fremdheit und Eigenheit beitrug.
Was wird im Kapitel „Innere kulturelle Alterität“ behandelt (soweit im Auszug ersichtlich)?
Das Kapitel „Innere kulturelle Alterität“ ist im vorliegenden Auszug unvollständig. Es soll sich voraussichtlich mit den internen kulturellen Differenzen innerhalb des mittelalterlichen Europas befassen und zeigen, wie diese Differenzen zur Konstruktion von Fremdheit und Eigenheit beitrugen (z.B. soziale Schichtung, regionale Unterschiede oder Konflikte zwischen Gruppen).
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für Personen gedacht, die sich akademisch mit dem Thema Fremdheit und Eigenheit im Mittelalter auseinandersetzen möchten. Er ist auf eine strukturierte und professionelle Analyse ausgerichtet.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Das Fremde und das Eigene im Mittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465979