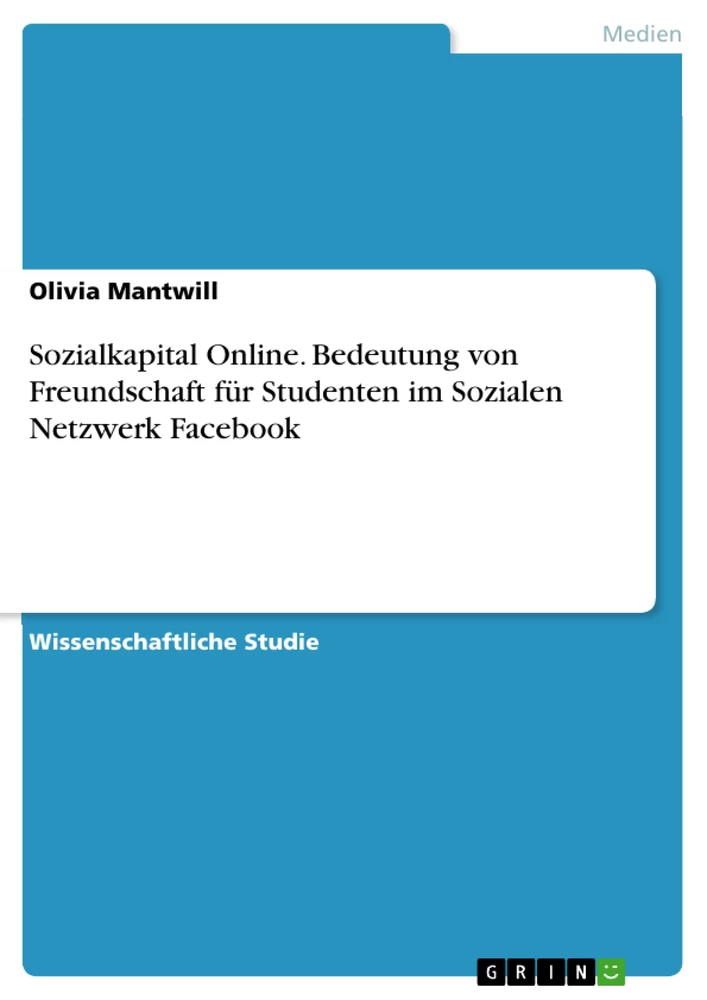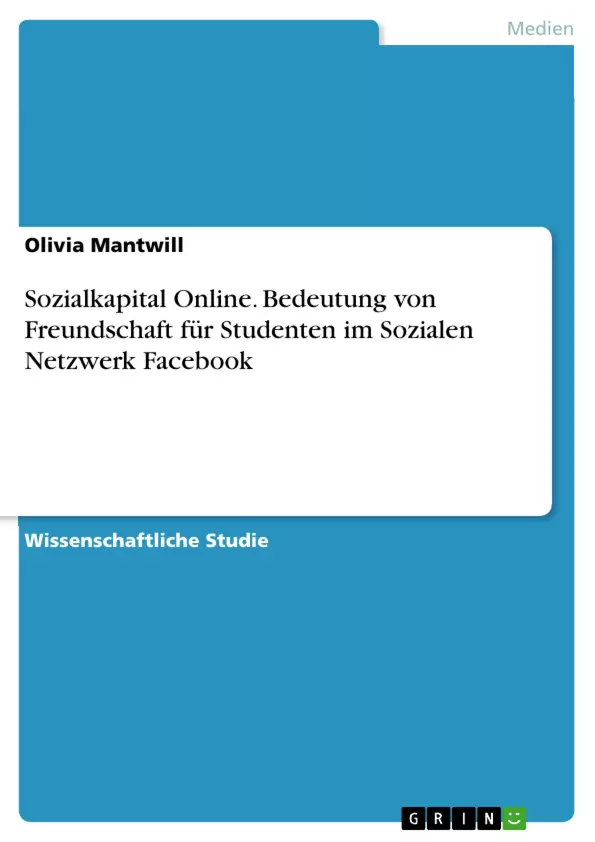Die Forschungsfrage dieser Arbeit wurde in einer Gruppe von vier Studenten aufbauend auf einer Anfangsfrage erarbeitet und im Laufe des Forschungsprozesses immer wieder überarbeitet, um anschließend jeweils ein Interview anhand des Interviewleitfadens zu führen. Daraufhin wurden die Interviews miteinander abgeglichen und parallel zueinander ausgewertet. Die Vorgehensweise dabei beruht auf der Grounded Theory. Diese generelle Vorgehensweise wird in dieser Arbeit dem individuellen Forschungsprozess angepasst und es wird dargelegt, warum jeweils wie vorgegeben oder anders vorgegangen wurde. Das Ziel dieser Arbeit ist es also, das Vorgehen der Grounded Theory anhand ihrer Anwendung an der Forschungsfrage „Sozialkapital Online: Bedeutung von Freundschaft für Studenten im Sozialen Netzwerk Facebook“ zu erläutern und kritisch zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Wie Facebook und Freundschaft zusammenhängen
- Angepasste Vorgehensweise der Grounded Theory
- Sample
- Erhebungsmethode und -durchführung
- Transkription
- Auswertung
- Globalauswertung
- Offenes Codieren
- Axiales Codieren
- Vorläufige Ergebnisse des Forschungsprozesses
- Reflexion des Vorgehens
- Literaturverzeichnis
- Anlagen
- Leitfaden
- Transkribiertes Interview und Notation
- Vorläufige anteilige Forschungsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Freundschaft für Studenten im sozialen Netzwerk Facebook. Sie untersucht, wie Studenten Facebook und Freundschaft zueinander in Beziehung setzen und welche Bedeutung Facebook für ihre Freundschaftsbeziehungen hat. Die Arbeit verfolgt dabei einen qualitativen Ansatz und nutzt die Grounded Theory als methodische Grundlage.
- Bedeutung von Freundschaft für Studenten im Kontext von Facebook
- Untersuchung der Definition von Freundschaft und Facebook-Freundschaft durch Studenten
- Analyse der Rolle von Facebook für die Pflege und Gestaltung von Freundschaftsbeziehungen
- Anwendung der Grounded Theory als Methode zur Erforschung des Themas
- Reflexion der Stärken und Schwächen der Grounded Theory in der Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die zunehmende Nutzung von Facebook und die verschiedenen Beweggründe dafür, darunter die Informationsschöpfung, die Terminplanung und die Pflege von Facebook-Freundschaften. Es wird auch auf die Unterschiede in der Interpretation des Begriffs "Freunde" hingewiesen und die Forschungsfrage der Arbeit eingeführt.
- Das zweite Kapitel beschreibt die Anwendung der Grounded Theory als methodische Grundlage für die Untersuchung. Es werden die einzelnen Schritte der Grounded Theory erläutert, von der Festlegung des Samplings über die Erhebungsmethode und Transkription bis hin zur Auswertung. Die Kapitel erläutert auch die Besonderheiten der Grounded Theory als Methode, die sich durch Offenheit, Prozesshaftigkeit und Kommunikation auszeichnet.
- Das Kapitel "Sample" erläutert die Auswahl der Befragten und die Kriterien für die Auswahl der Stichprobe. Es wird die deduktive Stichprobenziehung beschrieben, die eine bewusste Auswahl der Teilnehmer beinhaltet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Social Media, Facebook, Freundschaft, qualitative Forschungsmethoden, Grounded Theory, Studenten, Sozialkapital, Online-Kommunikation und die Bedeutung von Freundschaftsbeziehungen in digitalisierten Lebenswelten. Die Studie basiert auf einem qualitativen Ansatz und untersucht die subjektiven Perspektiven von Studenten im Hinblick auf ihre Nutzung von Facebook und die damit verbundenen Freundschaftsbeziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Studie zum Thema Facebook?
Die Studie erforscht die Bedeutung von Freundschaft für Studenten im Kontext des sozialen Netzwerks Facebook und wie diese online gepflegt wird.
Welche Forschungsmethode wurde angewendet?
Es wurde die Grounded Theory genutzt, ein qualitativer Forschungsansatz zur Generierung von Theorien aus empirischen Daten.
Was bedeutet „offenes Codieren“ in der Grounded Theory?
Es ist der erste Schritt der Auswertung, bei dem Daten aufgebrochen und mit Begriffen (Codes) versehen werden, um Kategorien zu bilden.
Wie unterscheiden Studenten zwischen „echten“ Freunden und Facebook-Freunden?
Die Arbeit analysiert die subjektiven Interpretationen der Nutzer, wobei Facebook oft eher zur Information und Terminplanung als für tiefe emotionale Bindungen genutzt wird.
Was ist das Ziel der Reflexion des Vorgehens?
Das Ziel ist es, die Stärken und Schwächen der Grounded Theory bei der Anwendung auf die spezifische Forschungsfrage kritisch zu hinterfragen.
- Quote paper
- Olivia Mantwill (Author), 2016, Sozialkapital Online. Bedeutung von Freundschaft für Studenten im Sozialen Netzwerk Facebook, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/466044