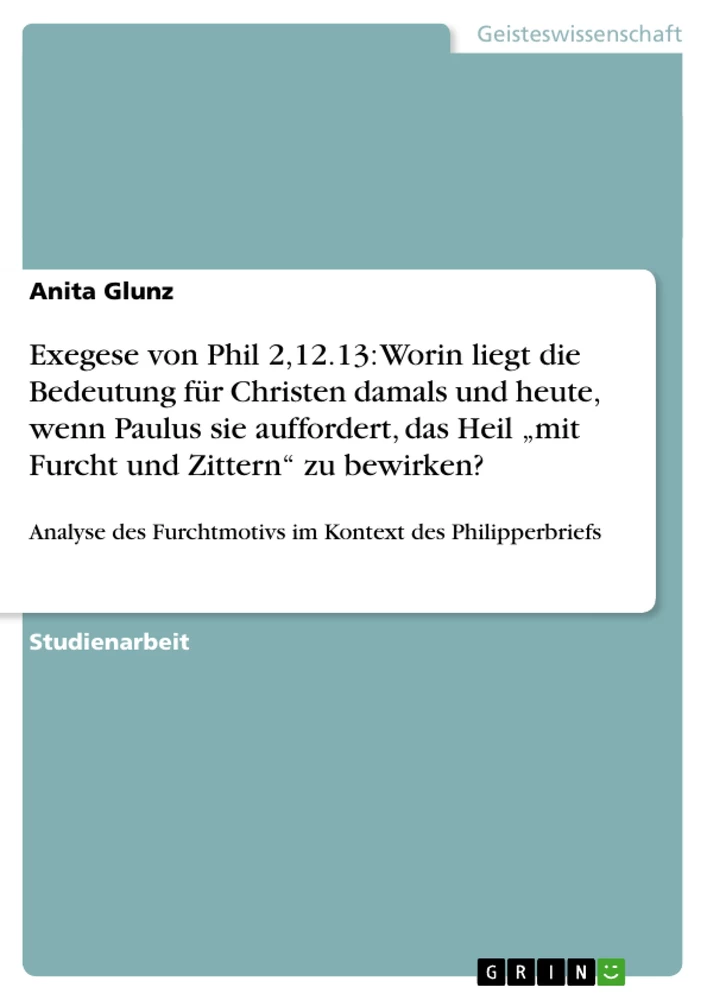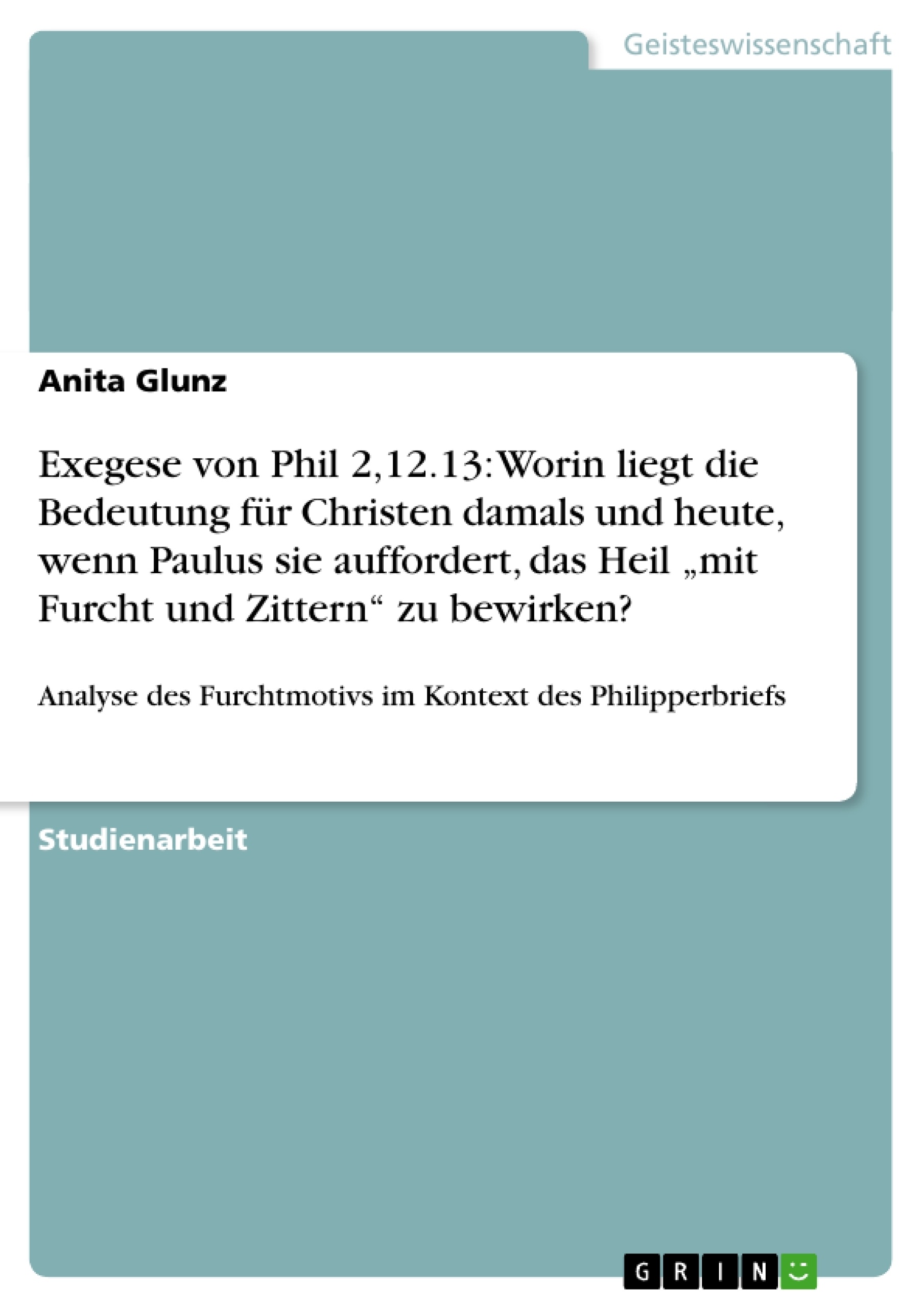Der Begriff der „Furcht“, der heutzutage fast immer gleichbedeutend mit dem Terminus „Angst“ verwendet wird, hat in jüngster Zeit durch die Auswirkungen des wachsenden Terrorismus in unserer Welt eine neue, noch größere Intensität in seiner negativen Konnotation erhalten. Furcht resultiert aus den existentiellen Bedrohungen der Menschheit. Als Konsequenz aus dieser Gegebenheit hat sich die heutige Gesellschaft zum Ziel gesetzt, mögliche Gefahrenquellen in der Welt zu bekämpfen, um somit ein „furchtfreies“ Leben der Weltbevölkerung zu erwirken. Bei solch einer Interpretation der Furcht, die den früher geläufigen Sinn von Furcht als Ehrfurcht, Respekt ausblendet, werden formelhafte Wendungen, wie „schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furch und Zittern“ (Phil 2,12) aus dem Brief des Paulus an die Philipper als unangebracht empfunden. Die Verknüpfung von Furcht mit dem Glauben an Jesus Christus und das Heil des Menschen kann demzufolge nur ein Widerspruch per se bedeuten, wenn das Charakteristikum der negativen Komponente der Furcht in der Vorstellung der Menschen dominiert und sie daher negiert wird. In der Tat scheint es aus diesem Blickwinkel überraschend, dass Paulus die Botschaft des Evangeliums, d.h. der Hoffnung, mit dem Begriff der „Furcht“ kombiniert. In dieser Hinsicht möchte ich eruieren, wie Paulus diese Wendung im Zusammenhang seiner Korrespondenz mit der Gemeinde in Philippi deutet. Um einem angemessenen Verständnis der paulinischen Aussage, die auf den ersten Blick widersprüchlichen Charakter hat, näher zu kommen, soll das Motiv der Furcht in der Bibel genauer analysiert werden, um es im Kontext des Philipperbriefs ansichtig werden zu lassen. Zunächst wird der Inhalt und die Entstehungssituation des Briefes behandelt werden, bevor ich die Stelle Phil 2,12.13 mit den Methoden der historisch‑kritischen Exegese detaillierter untersuchen möchte, um den Ausdruck „mit Furcht und Zittern“ in Bezug auf den voranstehenden Christushymnus und den folgenden Vers zu interpretieren. Die Erörterung der Fragestellung, ob die Furcht also den Weg zum Heil darstellt oder inwiefern sie im Glauben und für das Heil eine Rolle spielt, soll als Konklusion den Abschluss der Untersuchung des Furchtmotivs im Philipperbreif bilden. Das Fazit im fünften Kapitel der Arbeit konstituiert schließlich ein neues Verständnis von der Relation zwischen Furcht und Glauben im Neuen Testament, das auch noch heutigen Christen seine Validität bewahrheitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Brief des Paulus an die Philipper
- 3. Historisch-kritische Exegese von Phil 2,12.13
- 3.1 Textkritik und Textanalyse
- 3.2 Literarkritik
- 3.3 Formkritik
- 3.4 Redaktionskritik
- 3.5 Motivgeschichte
- 4. Gesamtinterpretation der Stelle Phil 2,12.13
- 4.1 Modifikation des Furchtmotivs durch Paulus
- 4.2 Bezug zum Christushymnus Phil 2,6-11
- 5. Ist also die Furcht der Weg zum Heil?
- 5.1 Resümee
- 6. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des Furchtmotivs im Philipperbrief des Paulus, insbesondere den Vers Phil 2,12.13, und dessen Bedeutung für Christen damals und heute. Sie analysiert den Kontext der Aussage im Philipperbrief und beleuchtet die Beziehung zwischen Furcht und Glaube im Neuen Testament.
- Die Bedeutung von „Furcht und Zittern“ (Phil 2,12.13) im Kontext des Philipperbriefs.
- Die historische und gesellschaftliche Situation der Gemeinde in Philippi.
- Die Interpretation von Phil 2,12.13 unter Anwendung historisch-kritischer Exegese.
- Der Vergleich der paulinischen Verwendung von „Furcht“ mit dem modernen Verständnis von Angst.
- Die Beziehung zwischen Furcht und Heil im Neuen Testament.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von „mit Furcht und Zittern“ (Phil 2,12) im Kontext der heutigen und damaligen christlichen Lebenswelt. Sie verdeutlicht den scheinbaren Widerspruch zwischen der Botschaft der Hoffnung (Evangelium) und der Verwendung des Begriffs „Furcht“. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse des Furchtmotivs in der Bibel, die Untersuchung des Philipperbriefs und die exegetische Interpretation von Phil 2,12.13 umfasst. Das Ziel ist ein neues Verständnis der Beziehung zwischen Furcht und Glaube im Neuen Testament zu entwickeln, welches auch für heutige Christen relevant ist.
2. Der Brief des Paulus an die Philipper: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Kontext des Philipperbriefs. Es beschreibt die Stadt Philippi, ihre Bedeutung als römische Kolonie und die Zusammensetzung der dortigen Gemeinde aus römischen Veteranen und Sklaven. Die besondere Situation der Gemeinde, bestehend aus überwiegend Nichtjuden mit nur rudimentären Kenntnissen des Alten Testaments, erklärt einige Eigenheiten des Briefes, wie den eigentümlichen Wortlaut und die geringe Rekurrenz auf jüdische Traditionen. Das Kapitel beschreibt auch die Beziehung zwischen Paulus und den Philippern, die durch finanzielle Unterstützung und gemeinsames Erleben von Verfolgung gekennzeichnet ist. Es wird auf den Abfassungsort des Briefes eingegangen und der thematische Aufbau des Briefes wird zusammengefasst, wobei auf die verschiedenen Abschnitte und deren Inhalte eingegangen wird.
3. Historisch-kritische Exegese von Phil 2,12.13: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten exegetischen Analyse von Phil 2,12.13 mithilfe der historisch-kritischen Methode. Es beinhaltet die Textkritik und Textanalyse, Literarkritik, Formkritik, Redaktionskritik und Motivgeschichte. Durch diese verschiedenen Ansätze wird der Vers in seinem literarischen, sprachlichen und historischen Kontext eingeordnet, um sein Verständnis zu präzisieren. Die einzelnen Unterkapitel untersuchen den Vers unter unterschiedlichen Gesichtspunkten und tragen zur Gesamtinterpretation bei.
4. Gesamtinterpretation der Stelle Phil 2,12.13: In diesem Kapitel wird eine umfassende Interpretation von Phil 2,12.13 präsentiert. Es verbindet die Ergebnisse der vorherigen historisch-kritischen Analyse mit dem Kontext des gesamten Philipperbriefs, insbesondere dem vorangehenden Christushymnus (Phil 2,6-11) und den folgenden Versen. Die Interpretation beleuchtet wie Paulus das Furchtmotiv modifiziert und in den Kontext des Heilsgeschehens einordnet. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Furcht im Kontext des Glaubens und arbeitet heraus, wie die scheinbar widersprüchliche Verbindung von "Furcht und Zittern" mit dem Streben nach dem Heil zu verstehen ist.
5. Ist also die Furcht der Weg zum Heil?: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beantwortet die zentrale Forschungsfrage. Es beleuchtet, inwiefern Furcht eine Rolle im Glauben und für das Heil spielt. Das Resümee bietet eine synthetische Betrachtung der Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln, um ein umfassendes Bild der Beziehung zwischen Furcht und Glaube im Kontext des Neuen Testaments zu liefern und zu demonstrieren, wie das Verständnis dieser Beziehung für Christen heute relevant ist.
Schlüsselwörter
Philipperbrief, Paulus, Furcht, Angst, Glaube, Heil, Exegese, Phil 2,12.13, Christushymnus, historisch-kritische Methode, Neues Testament, Motivgeschichte, Gemeinde Philippi.
Häufig gestellte Fragen zum Philipperbrief und dem Furchtmotiv (Phil 2,12-13)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Furchtmotiv im Philipperbrief des Paulus, insbesondere Vers 2,12-13. Sie analysiert den Kontext, die Bedeutung von „Furcht und Zittern“ für Christen damals und heute, und beleuchtet die Beziehung zwischen Furcht und Glaube im Neuen Testament.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die historisch-kritische Exegese, die Textkritik, Literarkritik, Formkritik, Redaktionskritik und Motivgeschichte. Sie analysiert den Vers Phil 2,12-13 in seinem literarischen, sprachlichen und historischen Kontext, um dessen Bedeutung zu präzisieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von „Furcht und Zittern“ (Phil 2,12-13) im Kontext des Philipperbriefs, die historische und gesellschaftliche Situation der Gemeinde in Philippi, die Interpretation von Phil 2,12-13 mithilfe der historisch-kritischen Exegese, einen Vergleich der paulinischen Verwendung von „Furcht“ mit dem modernen Verständnis von Angst und die Beziehung zwischen Furcht und Heil im Neuen Testament.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Der Brief des Paulus an die Philipper, Historisch-kritische Exegese von Phil 2,12-13, Gesamtinterpretation der Stelle Phil 2,12-13, Ist also die Furcht der Weg zum Heil? und Bibliographie. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Forschungsfrage, beginnend mit einer Einführung in die Thematik und endend mit einer zusammenfassenden Antwort auf die zentrale Forschungsfrage.
Welche Schlüsselergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte exegetische Analyse von Phil 2,12-13, interpretiert den Vers im Kontext des gesamten Philipperbriefs, insbesondere des Christushymnus (Phil 2,6-11), und untersucht die Beziehung zwischen Furcht, Glaube und Heil im Neuen Testament. Sie bietet ein neues Verständnis der scheinbar widersprüchlichen Verbindung von „Furcht und Zittern“ mit dem Streben nach Heil.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Theologiestudenten, Bibelausleger und alle, die sich für die Interpretation des Neuen Testaments und die Bedeutung des Glaubens im Kontext von Furcht und Angst interessieren. Sie bietet neue Erkenntnisse zur Interpretation von Phil 2,12-13 und zur Beziehung zwischen Furcht und Glaube im Neuen Testament, die auch für heutige Christen relevant ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Philipperbrief, Paulus, Furcht, Angst, Glaube, Heil, Exegese, Phil 2,12.13, Christushymnus, historisch-kritische Methode, Neues Testament, Motivgeschichte, Gemeinde Philippi.
- Quote paper
- Anita Glunz (Author), 2004, Exegese von Phil 2,12.13: Worin liegt die Bedeutung für Christen damals und heute, wenn Paulus sie auffordert, das Heil „mit Furcht und Zittern“ zu bewirken?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46612