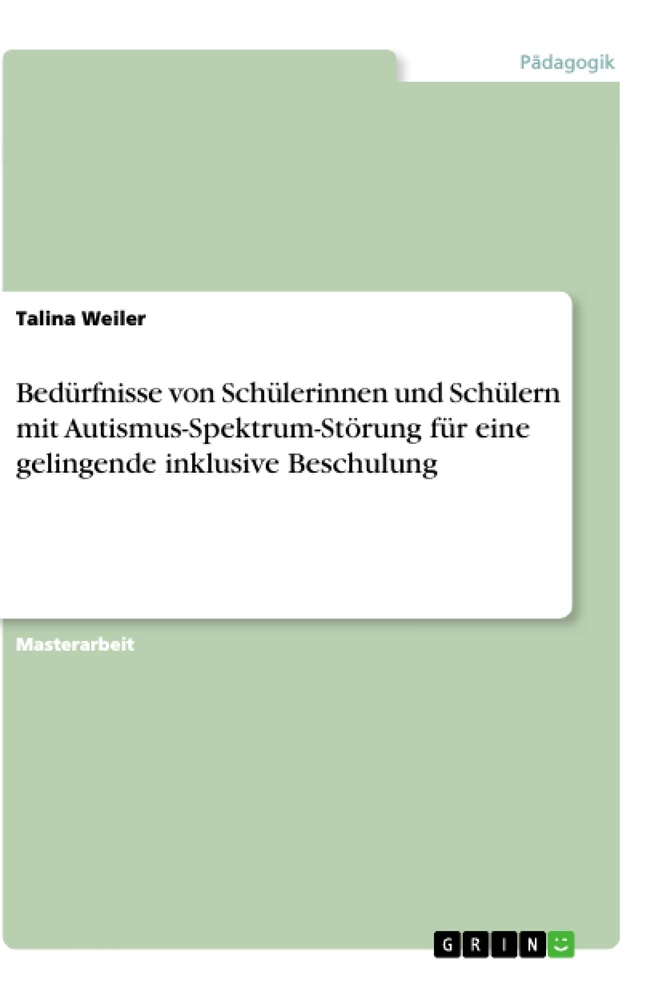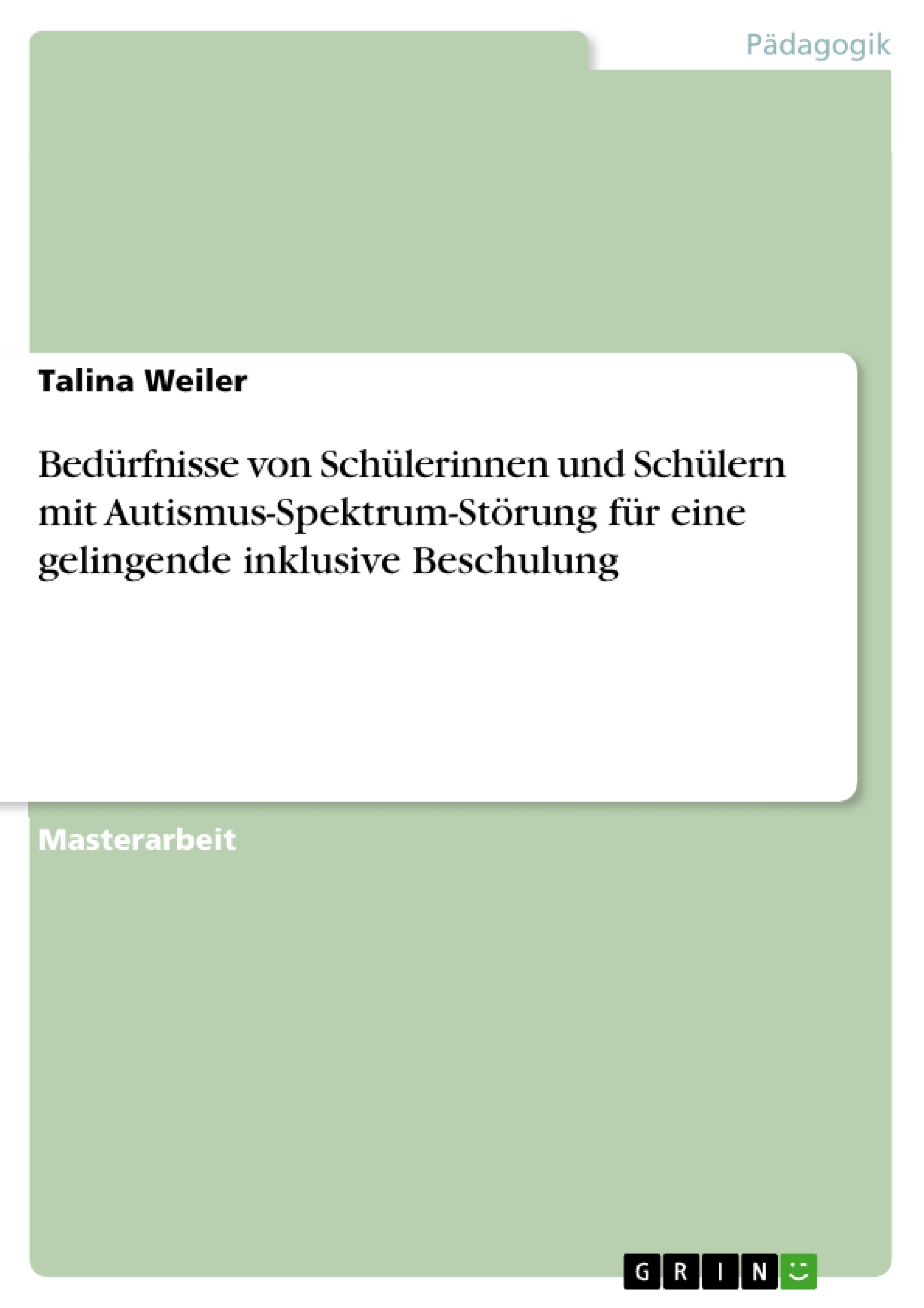Bislang in der Forschung vernachlässigt wurden die Schüler und Schülerinnen (SuS) mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ihre Bedürfnisse. Da am Gymnasium vor allem SuS mit Autismus-Spektrums-Störung inklusiv beschult werden, sollen diese in den Fokus dieser Arbeit gestellt werden. Mit Hilfe problemzentrierter und leitfadengestützter Interviews sollen drei autistische SuS befragt werden, um herausfinden, wie schulische Inklusion für sie funktionieren kann und wo eventuell Verbesserungsbedarf besteht.
Auf Grund der Aktualität der Thematik beschäftigt sich vorliegende Arbeit folglich mit der zentralen Fragestellung nach den Bedürfnissen von SuS mit Autismus-Spektrum-Störung, so dass ein Ausgangspunkt für eine gelingende inklusive Beschulung geschaffen werden kann.
Das erste Kapitel der Arbeit ist den definitorischen Grundlagen gewidmet. Diese sollen das Fundament der Arbeit bilden. Hierzu wird zunächst eine grundlegende Definition von Inklusion gegeben. Diese beinhaltet die begriffliche Definition von Inklusion. Im Zuge dessen wird auch die UN-Behindertenrechtskonvention2 thematisiert, da diese als Grundsteinlegung für die Inklusionsentwicklungen betrachtet werden kann. Im Anschluss daran soll auch eine Definition von inklusiver Bildung gegeben werden, da diese einen Hauptaspekt der Arbeit bildet. Die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit sollen mit der Definition von Autismus-Spektrum-Störung beendet werden. Hierzu werden nach einer begrifflichen Definition und der Einordnung nach ICD-10 auch einige der häufigsten Störungsbilder bzw. Ausprägungen wie z.B. der Asperger-Autismus oder der frühkindliche Autismus näher betrachtet. Folgend soll sich im Rahmen der Arbeit mit SuS im Autismus-Spektrum befasst werden, da auf diesem Personenkreis das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt. Hierzu werden charakteristische Merkmale sowie Herausforderungen im Schulalltag, schulische und institutionelle Rahmenbedingungen und die schulische Inklusion thematisiert.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Evaluation der leitfadengestützten Schülerinterviews. Vorbereitend wird dafür der aktuelle Forschungsstand dargestellt, die Forschungsfrage formuliert und das methodische Vorgehen beschrieben, bevor eine Darstellung der Ergebnisse stattfindet. Diese werden im Anschluss in Diskussion gestellt und kritisch analysiert sowie reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 1.1 Inklusion
- 1.1.1 Begriffsdefinition
- 1.1.2 UN-Behindertenrechtskonvention
- 1.1.3 Inklusive Bildung und Didaktik
- 1.2 Autismus-Spektrum-Störung
- 1.2.1 Begriffsdefinition
- 1.2.2 Krankheitsbild nach ICD-10
- 1.2.3 Frühkindlicher Autismus
- 1.2.4 Asperger-Autismus
- 1.2.5 Atypischer Autismus
- 2. Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung
- 2.1 Charakteristische Merkmale und Herausforderungen im Schulalltag
- 2.2 Rahmenbedingungen
- 2.3 Schulische Inklusion bei Autismus-Spektrum-Störung
- 3. Empirischer Forschungsstand
- 4. Forschungsfrage
- 5. Methodik
- 5.1 Problemzentriertes und leitfadengestütztes Interview
- 5.2 Leitfaden
- 5.3 Interviewtranskription
- 5.4 Auswertung nach Kuckartz
- 5.4.1 Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
- 5.4.1.1 Initiierende Textarbeit
- 5.4.1.2 Kategoriensystem
- 5.4.1.3 Codierung
- 5.4.2 Gütekriterien
- 5.4.2.1 Interne Studiengüte
- 5.4.2.2 Externe Studiengüte
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Zusammenfassung der Interviews
- 6.1.1 Interview 1
- 6.1.2 Interview 2
- 6.2 Das Kategoriensystem
- 6.3 Kategorienbezogene Auswertung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie inklusive Beschulung für Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung gelingen kann. Ziel ist es, die Bedürfnisse dieser Schülergruppe zu erforschen und einen Ausgangspunkt für eine erfolgreiche inklusive Integration in den Schulalltag zu schaffen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Inklusion“ im Bildungsbereich
- Analyse der Besonderheiten und Herausforderungen von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung
- Entwicklung eines kategorialen Systems zur Analyse der Bedürfnisse von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung im Kontext inklusiver Beschulung
- Empirische Untersuchung der Bedarfe durch qualitative Interviews mit Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung
- Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf die Gestaltung von inklusiven Lernumgebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der Arbeit. Sie verdeutlicht, wie die Inklusionsdebatte sowohl von der UN-Behindertenrechtskonvention als auch von der schulrechtlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen geprägt wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung und skizziert den Aufbau der Forschungsarbeit.
Kapitel 1 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit und definiert Inklusion sowie die UN-Behindertenrechtskonvention. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung inklusiver Bildung im Kontext von Autismus-Spektrum-Störung. Das Kapitel definiert die Störung und beleuchtet verschiedene Ausprägungen wie Frühkindlicher Autismus und Asperger-Autismus.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der spezifischen Situation von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung im Schulalltag. Es werden charakteristische Merkmale und Herausforderungen der Inklusion beschrieben, sowie die institutionellen Rahmenbedingungen und die Bedeutung der schulischen Inklusion für diese Schülergruppe beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert den empirischen Forschungsstand zum Thema Autismus-Spektrum-Störung und inklusive Beschulung. Die Arbeit untersucht, welche Erkenntnisse über die Bedürfnisse von Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung bereits vorhanden sind und welche Forschungslücken sich in diesem Bereich auftun.
Kapitel 4 stellt die Forschungsfrage und skizziert das Ziel der Arbeit. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Bedürfnisse Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung für eine gelingende inklusive Beschulung haben.
Kapitel 5 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden problemzentrierte und leitfadengestützte Interviews mit Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung durchgeführt. Die Kapitel erläutert den Aufbau des Leitfadens, die Interviewtranskription und die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Die Gütekriterien der Studie werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung. Die Zusammenfassung der Interviews, das Kategoriensystem und die kategorienbezogene Auswertung liefern wichtige Erkenntnisse über die Bedürfnisse dieser Schülergruppe im Kontext der inklusiven Beschulung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themenfelder Inklusion, Autismus-Spektrum-Störung, inklusive Beschulung, Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, qualitative Forschung, Leitfadengestütztes Interview, Inhaltsanalyse, Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung im schulischen Kontext und zielt darauf ab, die Bedürfnisse dieser Schülergruppe für eine gelingende inklusive Beschulung zu identifizieren.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Bedürfnisse von Schülern mit Autismus bei der Inklusion?
Schüler mit Autismus benötigen oft klare Strukturen, reizarme Umgebungen und individuelle Unterstützung, um erfolgreich am inklusiven Unterricht teilnehmen zu können.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention für die Schule?
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist der Grundstein für die Entwicklung inklusiver Bildungssysteme und verpflichtet Schulen, allen Kindern den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen.
Was ist der Unterschied zwischen Asperger-Autismus und frühkindlichem Autismus?
Frühkindlicher Autismus zeigt sich meist vor dem dritten Lebensjahr durch Verzögerungen in der Sprachentwicklung, während beim Asperger-Syndrom oft keine sprachliche Verzögerung, aber Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion vorliegen.
Wie wird inklusive Beschulung empirisch untersucht?
Häufig werden qualitative Methoden wie problemzentrierte und leitfadengestützte Interviews eingesetzt, um die Perspektiven der betroffenen Schüler direkt zu erfassen.
Was versteht man unter qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz?
Es handelt sich um eine Methode zur systematischen Auswertung von Texten, bei der Kategorien gebildet werden, um komplexe Interviewdaten strukturiert zu analysieren.
Welche Herausforderungen gibt es für Autisten im Schulalltag?
Herausforderungen liegen oft in der sozialen Kommunikation, dem Verständnis nonverbaler Signale und dem Umgang mit unvorhersehbaren Veränderungen im Tagesablauf.
- Quote paper
- Talina Weiler (Author), 2019, Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung für eine gelingende inklusive Beschulung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/466384