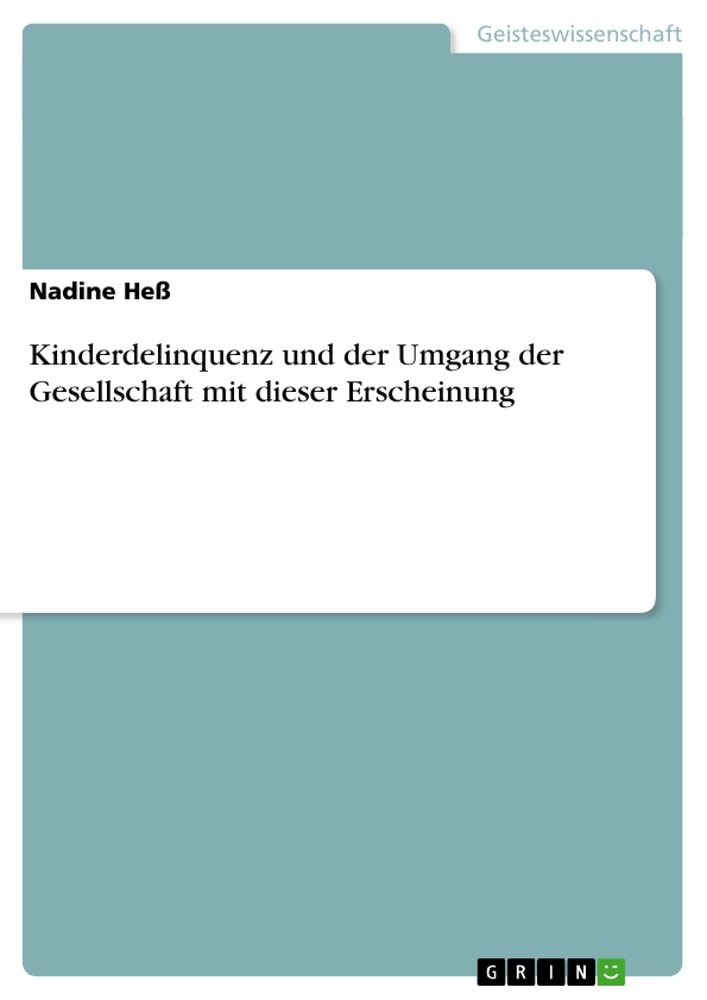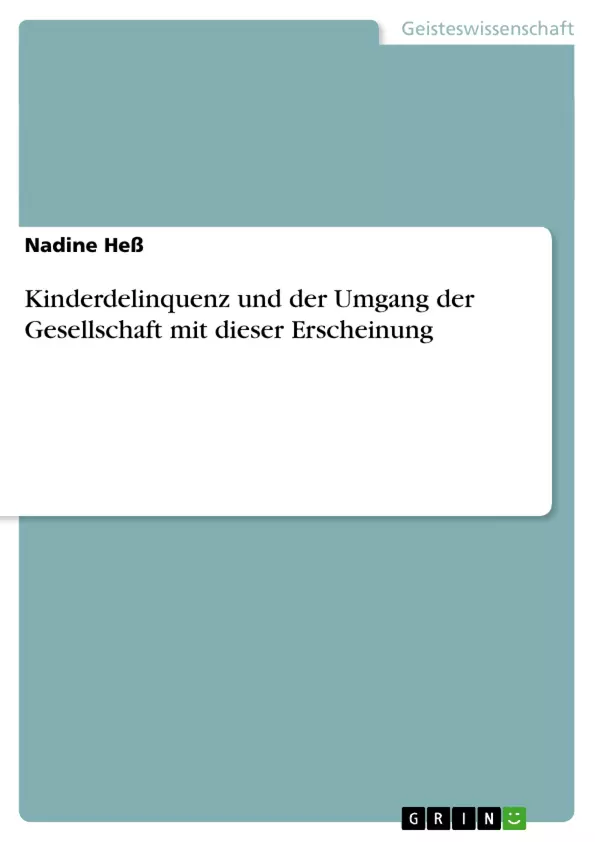Das öffentliche Interesse an Kindern unter 14 Jahren, die durch ihr Verhalten in Konflikte mit dem Gesetz geraten und demzufolge auch mit der Gesellschaft, hat in letzter Zeit deutlich zugenommen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass nach der ‚Polizeilichen Kriminalstatistik’ (PKS) seit den 90er Jahren verübte Taten von Kindern unter 14 Jahren gehäuft nachgewiesen wurden. Von großer Bedeutung ist es jedoch zu wissen, dass es sich bei den meisten dieser Taten um kleine Delikte handelt, die zudem nur einmalig begangen werden oder zeitlich begrenzt auftreten. Dies besagt folglich, dass delinquentes Verhalten bei Kindern keineswegs ein Anzeichen für eine ‚kriminelle Karriere’ im Erwachsenenalter darstellt. Über die eigentlichen Hintergründe, wie Familiensituation, Schulsituation und Freunde der auffälligen Kinder ist nur wenig bekannt. Meist werden besonders dramatische Fälle verallgemeinert. Doch dies stellt für die betroffenen Familien keinerlei Hilfe dar.
Von Kinderdelinquenz spricht man, wenn Kinder, die als noch nicht strafmündig gelten, Straftaten oder Delikte begehen, für die sie aufgrund ihres Alters nicht verantwortlich gemacht werden können. Der Begriff Delinquenz umfasst des Weiteren auch die Verletzung von Normen und Regeln, die als nicht strafbar gelten. Im Vergleich zu dem Begriff Kriminalität ist der der Delinquenz umfangreicher anzusehen (vgl. Hoops u.a. 2000, S.7ff). Darauf werde ich im Weiteren nochmals näher eingehen. Die Ausprägungen delinquenten Verhaltens können die unterschiedlichsten Ursachen haben. Bei Aussagen dahingehend müssen demzufolge vielerlei Faktoren beachtet werden, zu denen nicht nur ganz individuelle, sondern auch gesellschaftliche und ökonomische zählen. Ebenso hinterlassen auf das Verhalten folgende Reaktionen und Konsequenzen der Umgebung des Kindes ihre Wirkungen. Bei delinquenten Verhalten von Kindern unter 14 Jahren wurde durch verschiedene Forschungsergebnisse deutlich, dass hier der Einfluss der Familie eine sehr bedeutende Rolle spielt. Entscheidend wirken sich hierbei die Beziehungen untereinander und die Richtlinien, die von den Eltern vorgegeben werden auf das Verhalten der Kinder aus. Haben diese bereits abweichendes Verhalten gezeigt, kann der weitere Verlauf davon abhängig sein, wie die Familie mit dieser Situation umgeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinderdelinquenz und der Umgang der Gesellschaft mit dieser Erscheinung
- Begriffsbestimmungen: Delinquenz vs. Kriminalität
- Offiziell registrierte Delinquenz: Die Polizeiliche Kriminalstatistik
- Wissenschaftliche Erkenntnisse zu delinquentem Verhalten
- Theoretische Erklärungsansätze kindlicher Delinquenz
- Sozialisationstheorien
- Lerntheorien
- Kontrolltheorien
- Zur Differenzierung zwischen verfestigter und episodenhafter Delinquenz
- Etikettierungstheorien
- Kritische Betrachtung der Erklärungsansätze
- Differenzierung des abweichenden Verhaltens nach Geschlecht
- Veröffentlichungen von Kinderdelinquenz in den Massenmedien - Übertreibung oder Realität?
- Was gibt es für Möglichkeiten delinquentem Verhalten entgegenzuwirken?
- Zusammenfassung
- Abschließende Betrachtung zur Kinderdelinquenz
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Kinderdelinquenz und untersucht den Umgang der Gesellschaft mit diesem Phänomen. Sie analysiert die Ursachen und Hintergründe für delinquentes Verhalten von Kindern unter 14 Jahren und beleuchtet die Rolle von Familie, Schule und Gesellschaft. Darüber hinaus werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Kinderdelinquenz vorgestellt und kritisch betrachtet. Die Arbeit untersucht auch die Darstellung von Kinderdelinquenz in den Medien und mögliche Strategien zur Prävention.
- Begriffsbestimmungen und Abgrenzung von Delinquenz und Kriminalität
- Die Rolle der Polizeilichen Kriminalstatistik und ihre Aussagekraft
- Theoretische Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten
- Der Einfluss von Familie, Schule und Gesellschaft auf Kinderdelinquenz
- Die Rolle der Medien in der Darstellung von Kinderdelinquenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Aufmerksamkeit für Kinderdelinquenz in der Gesellschaft und verdeutlicht die Bedeutung des Themas. Sie stellt die Problematik von Verallgemeinerungen und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise heraus.
Das Kapitel 2.1 klärt die Begriffe Delinquenz und Kriminalität und zeigt ihre Unterschiede auf. Kapitel 2.2 analysiert die Polizeiliche Kriminalstatistik, ihre Aussagekraft und ihre Grenzen. Kapitel 2.3 beleuchtet wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema delinquentes Verhalten und stellt verschiedene theoretische Erklärungsansätze vor.
Kapitel 2.4.1-2.4.5 behandelt verschiedene Theorien zur Erklärung von Kinderdelinquenz, darunter Sozialisationstheorien, Lerntheorien, Kontrolltheorien und Etikettierungstheorien. Kapitel 2.5 analysiert die verschiedenen Ansätze kritisch und zeigt ihre Stärken und Schwächen auf. Kapitel 2.6 untersucht delinquentes Verhalten im Kontext der Geschlechter.
Kapitel 2.7 analysiert die Darstellung von Kinderdelinquenz in den Massenmedien und hinterfragt die Frage, ob es sich um Übertreibungen oder um die Realität handelt. Kapitel 2.8 stellt Möglichkeiten zur Prävention von delinquentem Verhalten vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Kinderdelinquenz, Kriminalität, Jugendkriminalität, Sozialisation, Familie, Schule, Gesellschaft, Medien, Prävention, theoretische Erklärungsansätze, Polizeilichen Kriminalstatistik, wissenschaftliche Erkenntnisse, abweichendes Verhalten und Normenverletzung. Diese Begriffe stehen im Mittelpunkt der Analyse und spiegeln die wichtigsten Themenfelder der Arbeit wider.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Delinquenz und Kriminalität?
Delinquenz ist ein weiter gefasster Begriff, der auch Verstöße gegen soziale Normen und Regeln umfasst, während Kriminalität sich auf strafrechtlich verfolgbare Taten bezieht.
Sind straffällige Kinder automatisch kriminelle Erwachsene?
Nein. Die meisten Delikte von Kindern unter 14 Jahren sind Bagatelltaten, die episodenhaft auftreten und kein sicheres Anzeichen für eine spätere kriminelle Karriere sind.
Welchen Einfluss hat die Familie auf Kinderdelinquenz?
Die familiären Beziehungen und die von den Eltern vorgegebenen Erziehungsrichtlinien spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Bewältigung von abweichendem Verhalten.
Was besagt die Etikettierungstheorie?
Sie besagt, dass die Reaktion der Gesellschaft (das „Abstempeln“ als kriminell) dazu führen kann, dass ein Kind diese Rolle annimmt und sich weiter delinquent verhält.
Wie stellen Medien Kinderdelinquenz dar?
Medien neigen oft dazu, dramatische Einzelfälle zu verallgemeinern, was ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Kriminalitätsstatistik erzeugt und Ängste in der Bevölkerung schürt.
- Citar trabajo
- Nadine Heß (Autor), 2005, Kinderdelinquenz und der Umgang der Gesellschaft mit dieser Erscheinung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46697