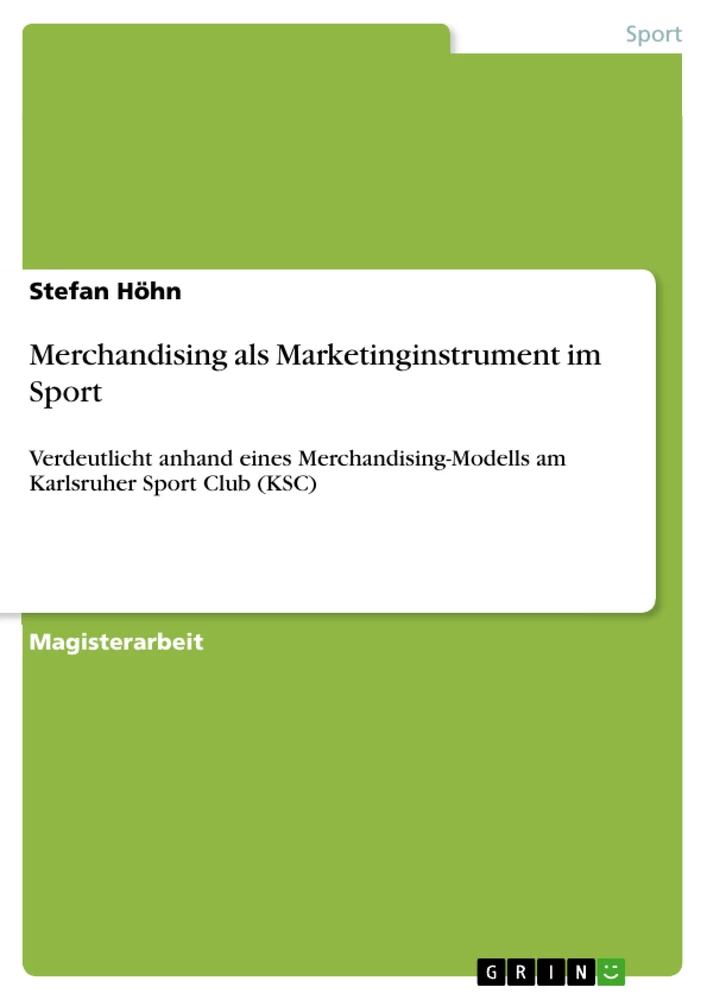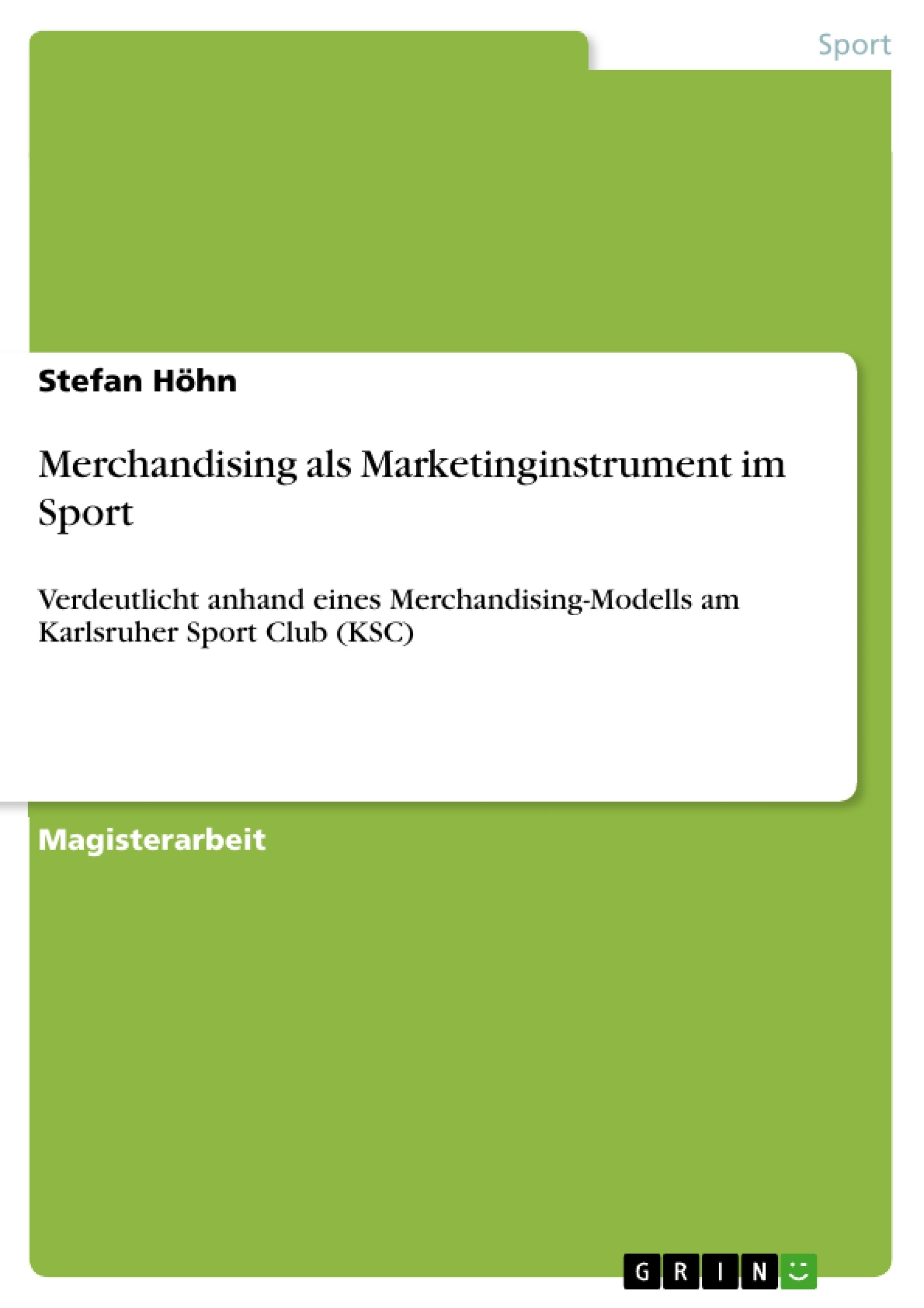Lange ist es her… 1997 gewann der FC Schalke 04 den Europacup. Bei der Siegerehrung streiften die Spieler ein Europacup T-Shirt über. Nur drei Tage später gewann der FC Bayern München die Deutsche Fußballmeisterschaft. Kurz nach dem Schlusspfiff trugen die Spieler T-Shirts und Caps mit Schriftzügen und dem Logo des „Meisters“. Insbesondere weil diese Anlässe im Blickfang der Öffentlichkeit standen, um jene „Fanartikel“ den Millionen von potentiellen Käufern live zu präsentieren. Dies waren noch die Auftaktzeiten der Merchandisingentwicklung. Mittlerweile bauen viele Vereinsmanager auf lukrative Einnahmen aus dem Merchandising.
Die wesentliche Problemstellung, die dieses Buch zu Grunde legt, geht auf ein fortwährendes ökonomisches Problem der professionellen Sportarten zurück. Zunehmend stellt die Sicherstellung von Geld eine Belastung im Spitzensport dar. Erhebliche Aufwendungen und Investitionen sind Voraussetzungen, um die Konkurrenzfähigkeit international oder in der Liga zu gewährleisten. Infolgedessen ist das Management dauernd gefordert, liquide Mittel sicherzustellen. Die Kommerzialisierung des Sports soll eine adäquate Lösung darstellen, indem das Produkt „Sport“ durch Veräußerung seiner Güter und Dienstleistungen über den Markt zusätzliche Geldmittel erwirtschaftet.
Im besonderen Maße entdecken die Verantwortlichen der telegenen Sportarten ihren Wert für zahlungswillige "Dritte" und somit ihre Vermarktungsmöglichkeiten. Wirtschaftsunternehmen nutzen die positiven Attribute und vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten des Sports, begünstigt durch das allgemeine öffentliche Interesse und intensiviert durch die mediale Verbreitung, mit Identifikations- und Werbestrategien. Längst haben sich komplexe Vermarktungsstrategien und ein gegenseitiges Verwertungsnetz aus Sport, Medien und Wirtschaft entwickelt. Daraus entwachsen fortwährend neue Einnahmeplattformen. Die vielfältigen Werbemöglichkeiten, insbesondere Sponsoring, die Überlassung von Rechten aus TV, Hörfunk, Internet und das Merchandising, sind für die Sportorganisationen unerlässlich.
Das vorliegende Buch beleuchtet diesen Markt und stellt dabei das Produkt Sport und dessen Vermarktungsgeflechte heraus; vor dem Hintergrund einer fundierten und ganzheitlichen Beleuchtung des Merchandisings. Somit bietet dieses Buch, über eine umfassende Grundlage hinaus, detailliertes und informelles Wissen zum Sport-Merchandising, aus dem sich dem Leser Hilfestellungen und Anwendungsbeispiele eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- 1. Erörterung der Problemstellung
- 2. Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit
- II. MERCHANDISING ALS MARKETINGINSTRUMENT
- 1. Begriffsbestimmung Merchandising
- 1.1. Definitionen des klassischen Merchandisings
- 1.2. Weitere Definitionen und Kennzeichen des Merchandisings
- 1.3. Definition Sport-Merchandising
- 2. Marketing bei Profit-Sportvereinen
- 2.1. Marketing
- 2.2. Marketing im Sport
- 2.2.1. Begriffsbestimmung - Sportmarketing
- 2.2.2. Professionalisierungstendenzen der Sportvereine
- 2.3. Marketing-Management
- 2.3.1. Marketingkonzeption
- 2.3.2. Marketinginstrumente
- 2.3.2.1. Produktpolitik im Sport
- 2.3.2.2. Kommunikationspolitik im Sport
- 3. Merchandising im Sport
- 3.1. Der Merchandisingmarkt
- 3.1.1. Merchandising/Licensing-Branchen (Property Types)
- 3.1.2. Einteilung nach Produktkategorien
- 3.2. Aspekte des Sportmerchandisingmarktes
- 3.2.1. Taxierte Umsatzamplituden als Richtwerte
- 3.2.2. Fanartikelsortiment
- 3.3. Komponenten des Transferpotentials
- 3.4. Merchandisingstrukturen der Sportvereine
- 3.4.1. Merchandisingstrukturen durch „Licensing“
- 3.4.2. Merchandisingstrukturen durch „Eigenregie“
- 3.5. Zielsetzungen des Merchandisings
- 3.6. Strategische Merchandisingformen
- 4. Zuordnung des Merchandisings in die Marketinginstrumente
- III. FALLBEISPIEL: MERCHANDISING-MODELL, DARGESTELLT AM FUSSBALLVEREIN KARLSRUHER SPORT-CLUB (KSC)
- 1. Intention des Fallbeispiels
- 2. Der Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e.V.
- 2.1. KSC als Dienstleistungsunternehmen
- 2.2. Rahmenbedingungen für das Merchandising
- 3. Merchandising-Modell
- 3.1. Strategisches Merchandising
- 3.1.1. Merchandisingziele beim KSC
- 3.1.2. Merchandisingstrategien beim KSC
- 3.2. Operatives Merchandising
- 3.2.1. Merchandisingsortiment beim KSC
- 3.2.2. Vertriebsformen beim KSC
- 3.2.3. Preispolitische Aspekte beim KSC
- 3.2.4. Kommunikative Formen zur Absetzung der Merchandisingartikel beim KSC
- IV. RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Merchandising als Marketinginstrument und positioniert es anhand eines konzipierten Modells am Karlsruher Sport Club (KSC). Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Merchandising im Sportmarketing zu verdeutlichen und ein praxisrelevantes Modell zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung von Merchandising und Sport-Merchandising
- Marketingstrategien im professionellen Sport
- Analyse des Merchandisingmarktes und seiner Strukturen
- Entwicklung eines Merchandising-Modells für den KSC
- Positionierung von Merchandising innerhalb des Marketing-Mix
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Problemstellung, die sich aus der zunehmenden Bedeutung von Merchandising im professionellen Sport ergibt. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert die Vorgehensweise.
II. Merchandising als Marketinginstrument: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Begriffsbestimmung von Merchandising, differenziert zwischen klassischem und Sport-Merchandising und beleuchtet den Kontext des Sportmarketings. Es analysiert Marketingstrategien im professionellen Sport, einschließlich der Produkt- und Kommunikationspolitik, und ordnet Merchandising als wichtiges Instrument in den Marketing-Mix ein. Der Merchandisingmarkt wird detailliert untersucht, inklusive Umsatzzahlen, Produktkategorien, und verschiedenen Merchandisingstrukturen (Licensing vs. Eigenregie).
III. Fallbeispiel: Merchandising-Modell, dargestellt am Fussballverein Karlsruher Sport-Club (KSC): Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Merchandising-Modell für den KSC. Es beschreibt den Verein, seine Rahmenbedingungen und entwickelt ein strategisches und operatives Merchandising-Konzept, das Ziele, Strategien, Sortiment, Vertriebswege, Preispolitik und Kommunikation umfasst. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der im zweiten Kapitel erörterten theoretischen Grundlagen.
Schlüsselwörter
Merchandising, Sportmarketing, Marketinginstrumente, Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Sport-Merchandising, Licensing, Eigenregie, Marketing-Mix, Fallbeispiel KSC, Professioneller Sportverein.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Merchandising als Marketinginstrument am Beispiel des Karlsruher SC
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht Merchandising als Marketinginstrument im professionellen Sport und entwickelt ein praxisrelevantes Merchandising-Modell am Beispiel des Karlsruher SC (KSC).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Merchandising und Sport-Merchandising, Marketingstrategien im professionellen Sport, die Analyse des Merchandisingmarktes und seiner Strukturen (einschließlich Umsatzzahlen, Produktkategorien und Merchandisingstrukturen wie Licensing und Eigenregie), die Entwicklung eines Merchandising-Modells für den KSC und die Positionierung von Merchandising innerhalb des Marketing-Mix.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Merchandising als Marketinginstrument, Fallbeispiel KSC und Resümee. Die Einleitung führt in die Thematik ein und definiert die Zielsetzung. Kapitel II liefert eine umfassende Begriffsbestimmung von Merchandising und analysiert den Merchandisingmarkt. Kapitel III präsentiert ein konkretes Merchandising-Modell für den KSC, inklusive strategischer und operativer Aspekte (Ziele, Strategien, Sortiment, Vertrieb, Preispolitik und Kommunikation). Das Resümee fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Analyse von Merchandising im Sportmarketing, differenziert zwischen verschiedenen Merchandisingformen und -strukturen und entwickelt ein konkretes, praxisorientiertes Merchandising-Modell für den KSC. Sie verdeutlicht die Bedeutung von Merchandising als wichtiges Marketinginstrument für professionelle Sportvereine.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Merchandising, Sportmarketing, Marketinginstrumente, Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Sport-Merchandising, Licensing, Eigenregie, Marketing-Mix, Fallbeispiel KSC, Professioneller Sportverein.
Welche Methodik wurde verwendet?
Die Arbeit verwendet eine kombinierte Methodik aus Literaturrecherche, Markt- und Branchenanalyse und der Entwicklung eines praxisorientierten Modells am Beispiel des KSC. Die Vorgehensweise ist in der Einleitung detaillierter beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende des Sportmanagements, Marketings und verwandter Disziplinen, sowie für Praktiker im Sportmarketing und Mitarbeiter von Sportvereinen, die sich mit Merchandisingstrategien auseinandersetzen.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieser Auszug dient lediglich als Zusammenfassung.
- Citation du texte
- Mag. SpOec. Univ. Stefan Höhn (Auteur), 1998, Merchandising als Marketinginstrument im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46722