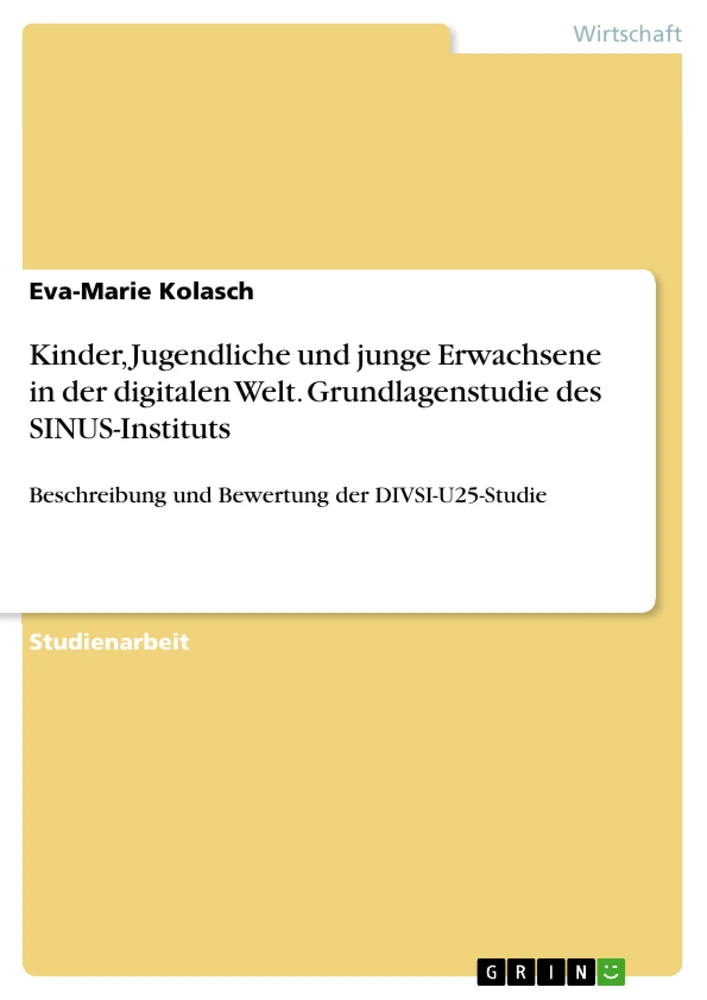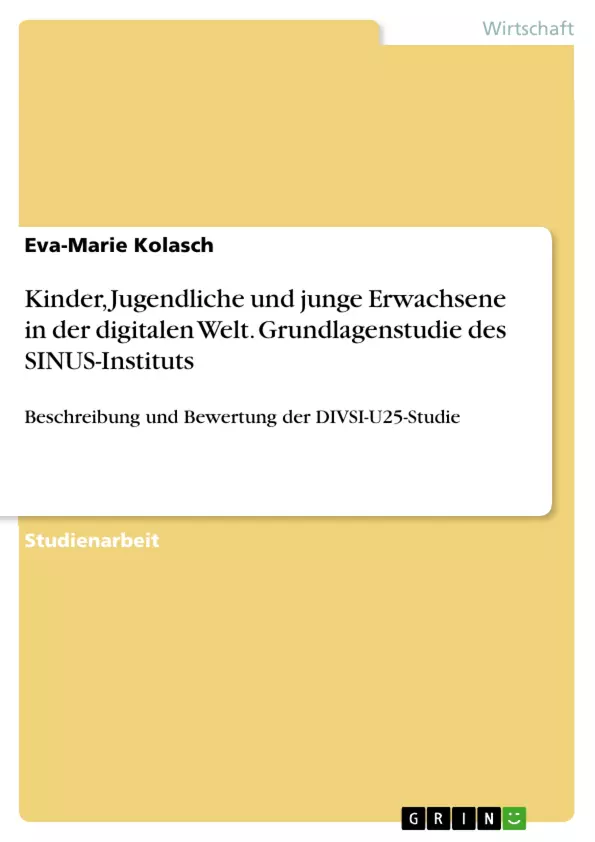Das Ziel der vorliegenden Seminararbeit besteht darin, herauszufinden, ob die Ergebnisse der DIVSI-U25-
Studie tatsächlich wissenschaftlich fundiert sind, was nur der Fall ist, wenn die Forscher sich an anerkannte Methoden der empirischen Forschung gehalten haben.
Daher lautet das Thema wie folgt: Beschreibung des Forschungsaufbaus der DIVSI-U25- Studie und Darstellung der Vorgehensweise der Forscher während der Forschung sowie Bewertung ihrer Arbeitsweise. Zunächst wird im Hauptteil dieser Arbeit erklärt werden, wie die DIVSI Forschung aufgebaut wurde und wie die Forscher vorgegangen sind, um Antworten auf ihre Leitfrage nach dem Verhalten von jungen Menschen im Internet zu erhalten. Dadurch wird dem Leser/der Leserin dieses Textes einen Überblick über die Forschung gegeben. Danach wird der Forschungsaufbau und die Arbeitsweise der Forscher im Hinblick auf die Methoden empirischer Forschung analysiert werden.
Im letzten Schritt, welcher das Fazit dieser Seminararbeit bildet, wird bewertet werden, ob die U25-Studie nun aussagekräftig ist oder nicht und warum. Als Ausgangspunkt meiner Arbeit wurde der Forschungsbericht der DIVSI U25-Studie und Peter Atteslanders „Methoden der empirischen Sozialforschung“ von 1995 als literarische Quellen herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Beschreibung des Forschungsaufbaus und der Vorgehensweise der Forscher
- 2.2. Analyse des Forschungsaufbaus und der Vorgehensweise der Forscher
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
- 5. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel der DIVSI-U25-Studie bestand darin, das Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der digitalen Welt wissenschaftlich zu untersuchen. Die Studie konzentrierte sich auf die Analyse der digitalen Lebenswelten dieser Zielgruppe, um ein umfassendes Verständnis ihrer Mediennutzung, ihrer Einstellung zur Privatsphäre, ihrem Umgang mit Inhalten und ihrem Vertrauen und Sicherheitsempfinden im Internet zu gewinnen.
- Mediennutzung im Alltag
- Privatsphäre und Identität im Internet
- Tauschen und Teilen von Inhalten
- Vertrauen und Sicherheit im Internet
- Rechtliche Aspekte der digitalen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der DIVSI-U25-Studie ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung des Verhaltens junger Menschen im Internet. Es wird hervorgehoben, dass die Studie eine wissenschaftlich fundierte Analyse liefern soll, um bestehende Meinungen und Vorurteile zu hinterfragen.
2.1. Beschreibung des Forschungsaufbaus und der Vorgehensweise der Forscher
Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau und die Vorgehensweise der DIVSI-U25-Studie. Es werden die zentralen Themenbereiche der Studie erläutert, wie z. B. Mediennutzung, Privatsphäre, Inhalte und Vertrauen im Internet. Es wird ein zweistufiges Erhebungsverfahren beschrieben, welches qualitative und quantitative Methoden kombiniert. Die qualitative Leitstudie umfasste non-direktive Interviews mit Gruppen von jungen Menschen unterschiedlichen Alters und Milieus. Die quantitative Online-Studie ermöglichte die Erhebung von Daten über einen längeren Zeitraum und umfasste moderierte Online-Chats.
2.2. Analyse des Forschungsaufbaus und der Vorgehensweise der Forscher
Dieser Abschnitt analysiert den Forschungsaufbau und die Vorgehensweise der Forscher im Hinblick auf die Methoden der empirischen Forschung. Es wird untersucht, ob die gewählten Methoden geeignet sind, um die Forschungsfragen zu beantworten und ob die Ergebnisse der Studie valide und reliabel sind.
Schlüsselwörter
Die DIVSI-U25-Studie beschäftigt sich mit der digitalen Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere mit ihrer Mediennutzung, ihrem Umgang mit Privatsphäre und Inhalten, ihrem Vertrauen und Sicherheitsempfinden im Internet sowie rechtlichen Aspekten der digitalen Welt. Zentrale Themen sind empirische Forschung, qualitative und quantitative Methoden, Interviewtechniken, Online-Studien, Datenanalyse und Validierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der DIVSI-U25-Studie?
Die Studie untersucht wissenschaftlich fundiert das Internetverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland.
Welche methodischen Ansätze wurden in der Studie kombiniert?
Es wurde ein zweistufiges Verfahren verwendet, das qualitative Methoden (Interviews) und quantitative Methoden (Online-Studien/Chats) kombiniert.
Welche Themenbereiche der digitalen Welt werden analysiert?
Schwerpunkte sind Mediennutzung im Alltag, Privatsphäre, Sicherheitsempfinden, das Teilen von Inhalten und rechtliche Aspekte.
Welche Rolle spielt Peter Atteslander in dieser Seminararbeit?
Sein Werk „Methoden der empirischen Sozialforschung“ dient als theoretische Grundlage, um die wissenschaftliche Validität der U25-Studie zu bewerten.
Wie wurden die Probanden für die qualitative Leitstudie ausgewählt?
Die Forscher führten non-direktive Interviews mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und sozialen Milieus durch.
- Quote paper
- Eva-Marie Kolasch (Author), 2014, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt. Grundlagenstudie des SINUS-Instituts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468253