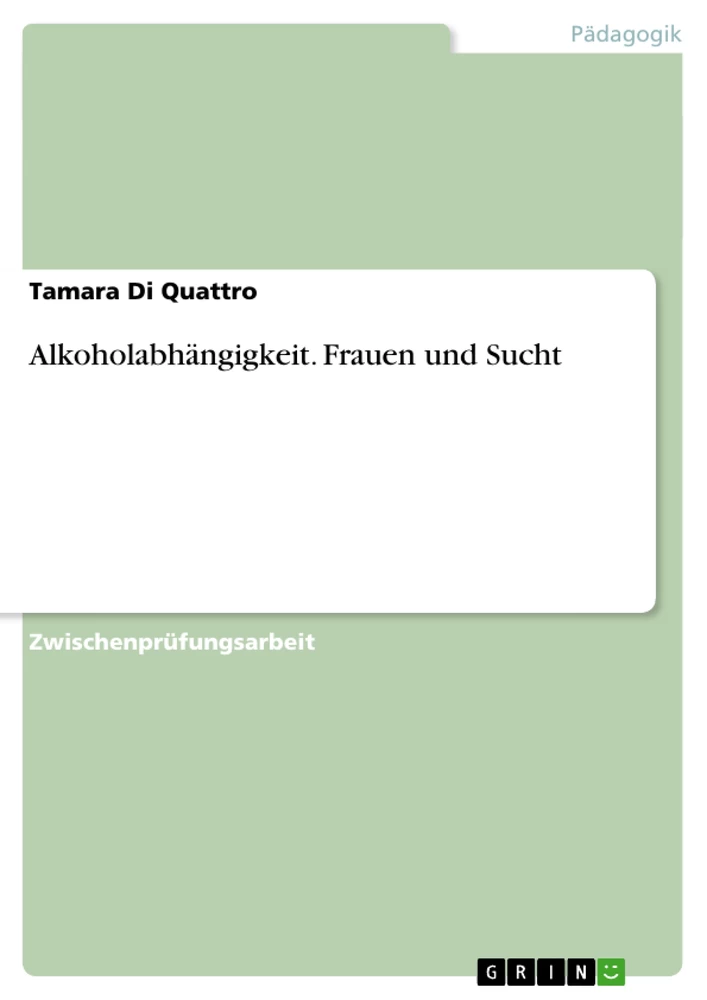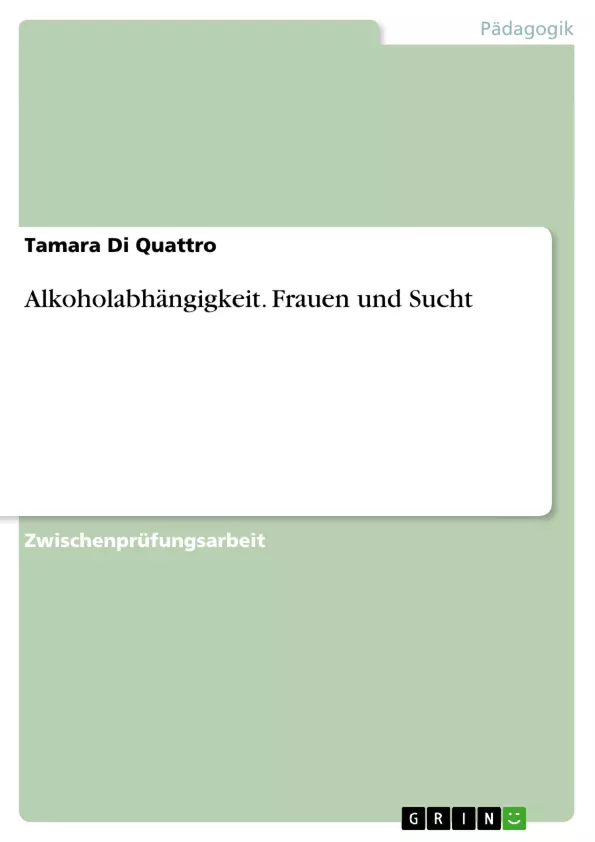Heute haben cirka 10 Millionen Deutsche Alkoholprobleme. Davon sind ein Drittel (3,3 Millionen) Frauen. Alkoholabhängig und/oder medikamentenabhängig sind in Deutschland schätzungsweise 1,4 Millionen Frauen. Dazu kommen etliche Frauen mit Essstörungen. Dies alles mit steigender Tendenz und einer nicht greifbaren Dunkelziffer. Bei den meist lange Zeit versteckten Suchtformen fallen Frauen dabei kaum „aus der Rolle“, und selbst in den größten Notzeiten verhalten sie sich angepasst und unauffällig. Meistens gelingt es ihnen über einen sehr langen Zeitraum die Fassade eines ′normalen Lebens′ aufrecht zu erhalten.
Um 1900 war der Anteil trinkender Frauen sehr gering. In den 50er Jahren trank die deutsche Frau höchstens mal auf Familienfeiern oder gemeinsam mit anderen beim Kaffeekranz. Das ′deutsche Fräulein′ trank nur, wenn ein Mann sie ausführte, aber dann auch immer in Maßen, weil in der Einladung zu einem alkoholischen Getränk auch immer der Versuch einer Verführung mitschwang. Voreheliche Kontakte entehrten die Frau in den Augen der Gesellschaft.
Auch sind es mittlerweile immer mehr Frauen, die trinken. Das Verhältnis alkoholabhängiger Frauen und Männer wurde lange Zeit auf 1:10 geschätzt. Seit den 70er Jahren ist das Verhältnis 1:4 mit einer Tendenz zum Verhältnis 1:3. Dies führt dazu, dass sich die Forschung verstärkt dem Thema Frauen und Sucht widmet. Seit den 70er Jahren wird vermutet, dass Frauen in dem Maße das Trinkverhalten von Männern annehmen, wie ihre Emanzipation heran schreitet und sie sich in Lebensstilen und Berufen bewegen, die denen der Männer ähnlich sind. Das heißt mit der Wandlung und Erweiterung des weiblichen Rollenverständnisses und des Rollenbildes hat sich auch das Trinkverhalten von Frauen geändert. Alkohol scheint zur Emanzipation dazuzugehören. Frauen sind heute zunehmend mehr außer Haus, fahren Auto, sind berufstätig, gehen häufiger aus, treffen sich mit Kolleginnen und Kollegen in Kneipen, fahren öfter in den Urlaub und unternehmen häufiger Kurztrips. Frauen geraten damit zunehmend in Situationen, in denen Alkohol nicht nur toleriert wird, sondern fast schon selbstverständlich dazugehört. Die zunehmende Selbständigkeit hat Frauen mehr Spielraum und mehr Möglichkeiten gegeben, das früher nur Männern vorbehaltene Verhalten zu übernehmen. Bei jüngeren Generationen sind kaum noch Unterschiede im Trinkverhalten von Männern und Frauen festzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alkohol - allgemeine Gesichtspunkte
- Wann ist man abhängig? - Definition der WHO
- Gesundheitliche Risiken
- Soziale Folgen der Alkoholabhängigkeit
- „Leichte Mädchen“ und „schlechte Mütter“ - trinkende Frauen in den Augen der Gesellschaft
- Körperliche Beeinträchtigungen und Wirkung des Alkohols auf die Psyche
- Erkenntnisse aus der Suchtforschung zu...
- ...dem Familienstand
- ...der Schule und dem Beruf
- ...den Kindheitserfahrungen und der Beziehung zu den Eltern
- ...der Partnerschaft und Sexualität
- Was führt Frauen in die Alkoholabhängigkeit? - Häufige Lebensumstände und Verhaltensmuster alkoholabhängiger Frauen
- Gesellschaftliche Einflüsse: Sucht als Ausdruck mangelnder Emanzipation
- Unglückliche Partnerschaft - angepasste Frauen
- Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern: Männergewalt und Selbstwertgefühl der Frau
- A) Frauen trinken, weil sie geschlagen werden
- B) Frauen werden geschlagen, weil sie trinken
- Die Sucht, gebraucht zu werden (Co-Abhängige Frauen)
- Sucht entsteht im Kinderzimmer - familiäre Ursachen
- Welche Defizite in der Familie begünstigen die Entstehung einer Abhängigkeit?
- Die Bedeutung frühkindlicher Erfahrungen - Urvertrauen, Subjektivität und Autonomie
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Sozialisationsprozess und ihre Bedeutung für eine Suchtentstehung
- Welche Rolle spielen Adoleszenzerfahrungen für das spätere weibliche Selbstbild?
- FAZIT: Welche Risikofaktoren bzw. protektive Faktoren lassen sich daraus ableiten?
- Therapie
- Motive von Männern und Frauen
- Motivation
- Welche Hilfsangebote für Suchtkranke gibt es?
- Was leisten die Beratungsstellen?
- Aufgaben und Ziele in der frauenspezifischen Suchtarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Frauen und Sucht, wobei der Fokus auf die Alkoholabhängigkeit gelegt wird. Ziel ist es, die Ursachen, Ausprägungen und Folgen der Alkoholabhängigkeit bei Frauen zu beleuchten und dabei die gesellschaftlichen, psychologischen und sozialen Aspekte zu berücksichtigen.
- Die Entstehung von Alkoholabhängigkeit bei Frauen und die Rolle von gesellschaftlichen Einflüssen
- Die Bedeutung von Kindheitserfahrungen und dem Sozialisationsprozess für die Entwicklung einer Sucht
- Die Rolle von Partnerschaft, Gewalt und Selbstwertgefühl im Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit
- Spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse von Frauen in der Suchttherapie
- Aktuelle Erkenntnisse der Suchtforschung und deren Relevanz für die Unterstützung von Frauen mit Alkoholproblemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die steigende Anzahl von Frauen mit Alkoholproblemen sowie den Wandel des weiblichen Trinkverhaltens im Laufe der Zeit. Kapitel 2 definiert den Begriff der Alkoholabhängigkeit nach der WHO und geht auf die gesundheitlichen und sozialen Folgen des Alkoholkonsums ein. Es werden zudem die stereotypen Vorstellungen von trinkenden Frauen in der Gesellschaft thematisiert.
Kapitel 3 präsentiert Erkenntnisse aus der Suchtforschung, die auf die Lebensumstände und Erfahrungen von Frauen mit Alkoholabhängigkeit eingehen. Es werden verschiedene Aspekte wie Familienstand, Schule und Beruf, Kindheitserfahrungen und die Beziehung zu den Eltern sowie Partnerschaft und Sexualität beleuchtet.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Ursachen für Alkoholabhängigkeit bei Frauen. Hierbei werden sowohl gesellschaftliche Einflüsse wie die mangelnde Emanzipation, unglückliche Partnerschaften und Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern als auch die Rolle von co-abhängigen Frauen analysiert.
Kapitel 5 untersucht die familiären Ursachen für die Entstehung von Sucht, insbesondere die Bedeutung frühkindlicher Erfahrungen und die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Sozialisationsprozess.
Das Fazit des Kapitels 5 leitet aus den vorangegangenen Ausführungen Risikofaktoren und protektive Faktoren ab, die die Entstehung von Alkoholabhängigkeit bei Frauen beeinflussen können.
Kapitel 6 widmet sich der Therapie von Alkoholabhängigkeit. Es wird auf die unterschiedlichen Motive von Männern und Frauen in der Therapie eingegangen und die Bedeutung der Motivation für den Therapieerfolg hervorgehoben. Zudem werden verschiedene Hilfsangebote für Suchtkranke und die spezifischen Aufgaben und Ziele der frauenspezifischen Suchtarbeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Alkoholabhängigkeit, Frauen, Sucht, Emanzipation, Gesellschaft, Kindheitserfahrungen, Partnerschaft, Gewalt, Selbstwertgefühl, Therapie, Motivation, frauenspezifische Suchtarbeit, Risikofaktoren, protektive Faktoren.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Frauen sind in Deutschland schätzungsweise alkoholabhängig?
Schätzungsweise 1,4 Millionen Frauen in Deutschland sind alkohol- und/oder medikamentenabhängig, wobei die Dunkelziffer als hoch eingeschätzt wird.
Welchen Einfluss hat die Emanzipation auf das Trinkverhalten von Frauen?
Die Forschung vermutet, dass Frauen männliche Trinkmuster in dem Maße übernehmen, wie sie sich in ähnlichen Lebensstilen und Berufen wie Männer bewegen.
Warum bleibt die Sucht bei Frauen oft lange unentdeckt?
Frauen verhalten sich bei Suchtproblemen oft angepasst und unauffällig, um die Fassade eines „normalen Lebens“ und gesellschaftliche Rollenerwartungen aufrechtzuerhalten.
Welche familiären Ursachen können eine Abhängigkeit begünstigen?
Defizite im Urvertrauen, traumatische Kindheitserfahrungen sowie problematische Beziehungen zu den Eltern spielen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Sucht.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewalt in der Partnerschaft und Sucht?
Ja, die Arbeit untersucht die Wechselwirkung: Frauen trinken oft als Reaktion auf erlebte Gewalt, oder Gewalt eskaliert aufgrund des Alkoholkonsums.
Was sind die Ziele frauenspezifischer Suchtarbeit?
Sie zielt darauf ab, die spezifischen Motive und Lebensumstände von Frauen (z. B. Rollenbilder, Schamgefühle) in der Therapie besonders zu berücksichtigen.
- Citation du texte
- Tamara Di Quattro (Auteur), 2003, Alkoholabhängigkeit. Frauen und Sucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46843