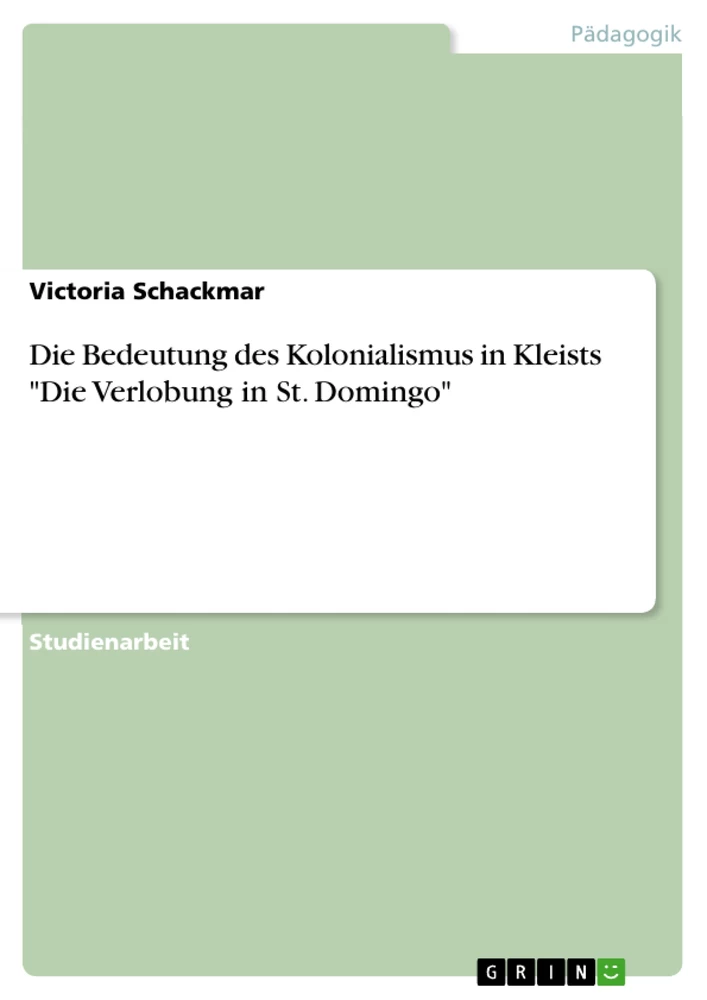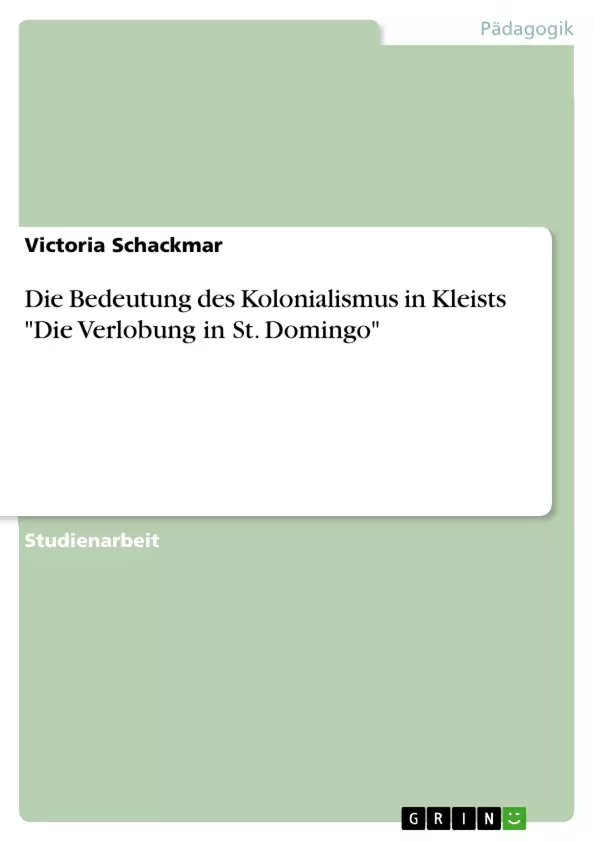Die Bedeutung des Kolonialismus für die Literatur wurde vor allem in der amerikanischen Literaturwissenschaft untersucht, zum Beispiel von dem Literaturwissenschaftler Edward W. Said. Untersuchungen für die deutschsprachige Literatur erschienen seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Hierbei ergibt sich vor allem ein methodisches Problem, da die Bezüge zum Kolonialismus an versteckten Stellen hergestellt werden, aber trotzdem von großer Bedeutung für das Verständnis des jeweiligen Werks ist und die Wahrnehmung des gesamten Werks entscheidend verändern kann. Ein bekanntes Analyse-Verfahren, das verwendet wird, ist das kontrapunktische Lesen.
Es muss hierbei beachtet werden, dass die Autoren und Leser des 19. Jahrhunderts und des frühen 19. Jahrhunderts den Kolonialismus als selbstverständlichen Bestandteil der Welt ansahen. Hierzu gehören beispielsweise Strukturen der Ungleichheit und Hierarchisierungen. Bei der kontrapunktischen Lektüre wird die Literatur zudem auf Mehrstimmigkeit gelesen und Gegenstimmen miteinbezogen. Es müssen westliche Konzepte berücksichtigt werden sowie die Konsequenzen einer Fremdbeherrschung für eine Kultur. Diese Methode der Textanalyse werde ich in meiner Arbeit ebenfalls anwenden, um die Bedeutung des Kolonialismus bezüglich des Rassismus für die Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ herauszuarbeiten. Hierbei werde ich zunächst die Verhaltensweisen der einzelnen Figuren betrachten, darauf achten, inwiefern die Figuren rassistische Züge aufweisen und wodurch die Figuren Vertrauen beziehungsweise Misstrauen gegenüber einander entwickeln. Anschließend werde ich auf die Erzählweise des Erzählers eingehen und die Funktion von Sprache und Gestik in dem Werk untersuchen.
Kleists Erzählungen wurden einige Zeit lang von Nationalsozialisten missbraucht. Auch Kritiker werfen ihm eine rassistische Einstellung vor. Ob diese Vorwürfe ihm unrecht tun oder nicht, werde ich ebenfalls untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Historischer Hintergrund
- 2.1 Die Haitianische Revolution
- 2.2 Zeitliche Einordnung der Erzählung Kleists
- 2.3 Entstehungsgeschichte der Erzählung
- 3 Rassismusdiskurs in der Verlobung in St. Domingo
- 3.1 Die Figurenkonstellation
- 3.1.1 Gustav
- 3.1.2 Babekan und Hoango
- 3.1.3 Toni
- 3.2 Der Erzähler
- 4 Die Bedeutung von Sprache und Gestik
- 4.1 Sprache
- 4.2 Körpersprache der Figuren
- 5 Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Kolonialismus in Heinrich von Kleists Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“. Sie beleuchtet, wie der Kolonialismus und die damit verbundenen Rassismusstrukturen die Handlung und Charakterentwicklung beeinflussen.
- Die Darstellung der Haitianischen Revolution und deren Einfluss auf die Handlung
- Die Analyse des Rassismusdiskurses in der Erzählung anhand der Figuren
- Die Bedeutung von Sprache und Körpersprache zur Vermittlung von Machtverhältnissen und Rassismus
- Die Frage nach Kleists eigener Positionierung zum Kolonialismus und Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ von Heinrich von Kleist vor und erläutert den historischen Kontext. Im Kapitel „Historischer Hintergrund“ wird die Haitianische Revolution im Detail beschrieben, die den Hintergrund der Erzählung bildet. Die Analyse der Figurenkonstellation in Kapitel 3 konzentriert sich auf die rassistischen Stereotype, die in der Erzählung verwendet werden. Das Kapitel „Die Bedeutung von Sprache und Gestik“ betrachtet, wie Sprache und Körpersprache in der Erzählung zur Vermittlung von Machtverhältnissen und Rassismus eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit Themen wie Kolonialismus, Rassismus, Haitianische Revolution, Heinrich von Kleist, „Die Verlobung in St. Domingo“, Interkulturalität, Rassismusdiskurs, Figurenkonstellation, Sprache, Körpersprache, Erzählperspektive.
- Citation du texte
- Victoria Schackmar (Auteur), 2018, Die Bedeutung des Kolonialismus in Kleists "Die Verlobung in St. Domingo", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468618