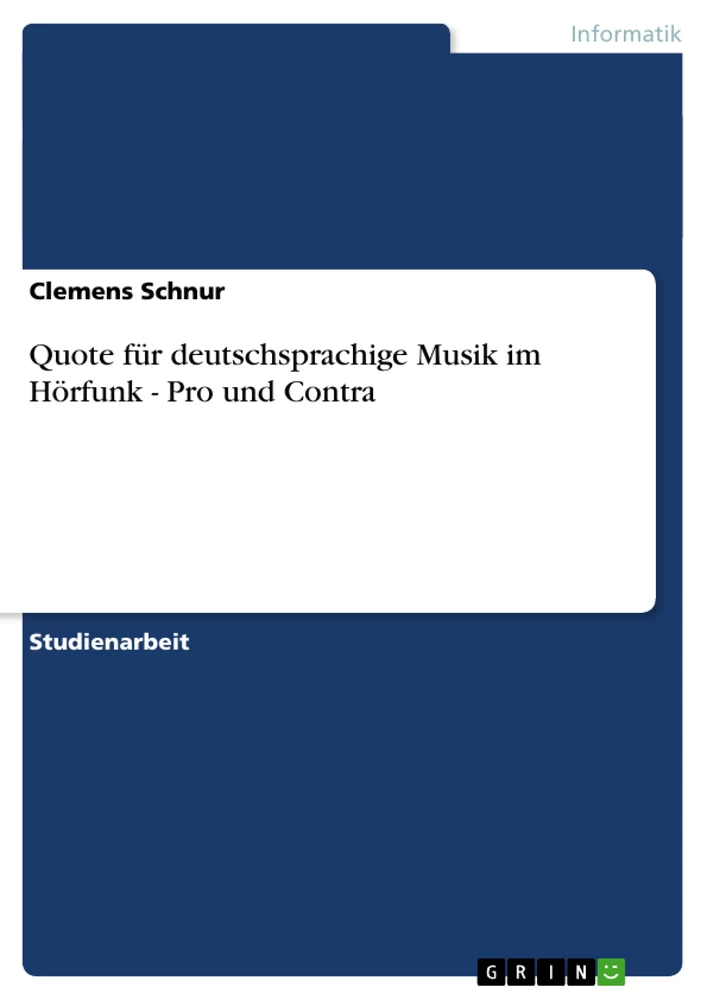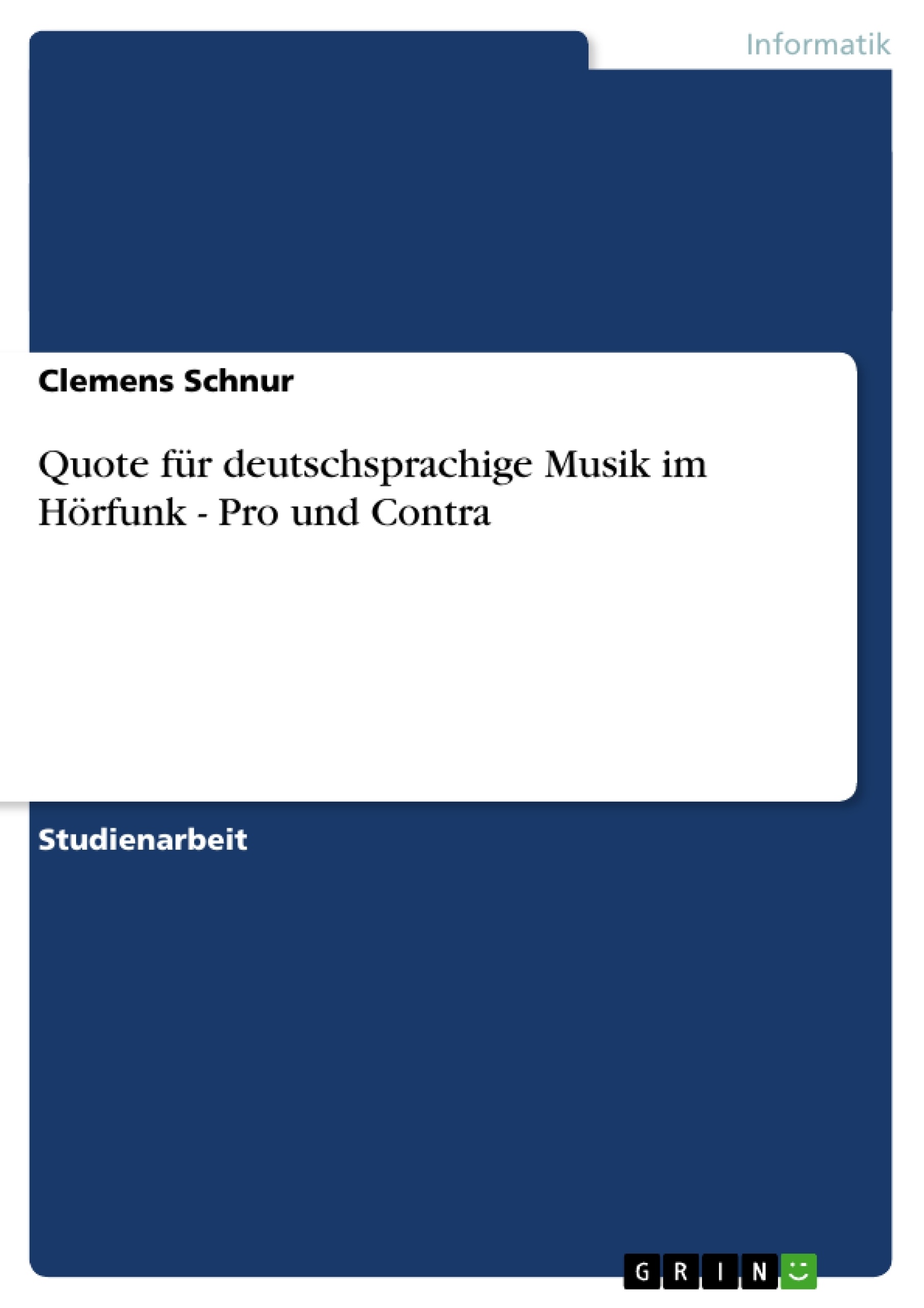„Quoten gegen Geschmacksdiktatur“, „Selbstverpflichtung statt Zwangsbeglückung“, „Vorwärts für den Nachwuchs“ – die Aussagen von Koop (2004, S. 1), Griefahn (2004, S. 1) und Kampeter (2004, S. 1) zeigen die unterschiedlichen Ansätze, wenn es um das Thema „Musik-Quote“ geht. Ein fester Prozentsatz deutscher Musik im Radio: Darüber erhitzen sich die Gemüter quer durch die Parteien und Künstlerkreise. Radiosender und Plattenfirmen bezichtigen sich gegenseitig, die Misere deutscher Popmusik herbeigeführt zu haben. Zahlen von Nielsen Music Control bestätigen die klare Missachtung deutscher Titel im bundesweiten Hörfunkangebot. Lediglich 4,9 Prozent betrug 2004 der Anteil nationaler Produktionen im Radio.
Die vorliegende Arbeit versucht, der hektischen und emotional geprägten Diskussion eine inhaltliche Ordnung zu verleihen. Über drei Phasen von Beschreibung, Analyse und Auswertung soll vor allem eines vermittelt werden: eine kritische Betrachtung der bestehenden Interessenskonflikte, die sich hinter der Forderung nach einer Besserstellung deutscher Produktionen verbergen. Vor allem an der Diskussion beteiligt ist das Konflikt-Triumvirat aus Musikwirtschaft, Hörfunkanbieter und Politik. Der gegenwärtige Austausch von Argumenten, Meinungen, und Vorschlägen mutet eher verwirrend als informativ oder gar aufklärend an. Deshalb muss hier Ziel sein, die angeführten Pro- und Contra-Positionen zu verifizieren oder gegebenenfalls zu widerlegen. Hierzu dient als Methode, das bestehende Konglomerat zwischen Phonoindustrie, Radiomachern und politischen Akteuren inhaltlich, organisatorisch und strukturell aufzubrechen.
Durch eine chronologische Auflistung der zeitlichen Eckpfeiler und die Darstellung der aktuellen Situation wird in Kapitel 2 zunächst der Status Quo im Diskurs um eine gesetzliche Regelung zugunsten deutscher Titel im Hörfunk beschrieben. Das gerne als verwendete Referenz französische Modell einer Quotenregelung im Hörfunk wird in Kapitel 3 ebenso analysiert, wie die Situation des deutschen Hörfunkmarktes in Abschnitt 4. Im Fokus steht hierbei die Überlegung, ob bereits bestehende gesetzliche Regelungen im europäischen Ausland modellhaften Charakter besitzen und demnach auf deutsches Terrain transferierbar sein können.
Kapitel 5 ergänzt die theoretischen Ansätze und Wissensstände durch konkrete Zahlen und Daten, welche Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit neue bzw. deutschsprachige Titel faktisch diskriminiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Chronologie der Quotendiskussion
- 2.1 Chronologie und aktuelle Entwicklung
- 2.2 Ausgewählte Positionen und Argumente - Pro und Contra Quote
- 2.3 Die aktuelle Situation in der Quotendiskussion
- 3. Das französische Modell als Vorbild einer deutschen Quotenregelung?
- 3.1 Die Quotierungen französischer Musikprogramme
- 3.2 Die Umsatzentwicklung der französischen Musikbranche
- 3.3 Die kulturellen und politischen Strukturen in Frankreich
- 4. Der Hörfunk in Deutschland
- 4.1 Die „(musikalische) Grundversorgung“
- 4.2 Hörererwartung und Hörernutzung im Rundfunk
- 4.2.1 Unbewußtes Hören als Rezeptions-erlebnis des Hörfunkkonsumenten
- 4.2.2 Der Begriff der „musikalischen Präferenz“
- 4.2.3 Funktionen des Musikhörens im Radio
- 4.3 Die Musik-Programmgestaltung der Hörfunkanbieter
- 4.3.1 Die Musiktestverfahren als Entscheidungsbasis zur Programmgestaltung
- 4.4 Der Begriff „Radioformat“
- 4.4.1 Definition (Radio-)Format
- 4.4.2 Klassifikationen Radioformate - Top Formate
- 4.4.3 Klassifikationen Radioformate - Formate und Subformate
- 4.4.4 Radioformate, Markt-/Kontaktorientierung, Quotenauswirkung am Beispiel Saarland
- 5. Aktuelle Zahlen zur Mediennutzung
- 5.1 Mediennutzung, Musik- und Sprachanteile in den Programmen
- 5.1.1 Die Mediennutzungsdauer in Deutschland
- 5.1.2 Anteile deutschsprachiger Musik im Hörfunk 2003
- 5.1.3 Musiksprache im Hörfunk am Beispiel Saarland
- 5.3.2 Veränderte Anteile deutschsprachiger Musik seit Beginn der Quotendiskussion
- 5.4 Hörerbefragung - Zahlen, Analyse, Auswertung
- 5.5 Der nationale Musikmarkt in Deutschland
- 6. Musik- und Künstlerförderung als Supplement einer Quotenregelung
- 6.1 Öffentliche Musikförderung in Deutschland
- 6.1.1 Private Musikförderung in Deutschland
- 6.2 Öffentliche Musikförderung auf Bundesebene
- 6.3 Stärken-Schwächen-Analyse der Musikwirtschaftsförderung
- 6.3.1 Schwächen und Risiken der Musikwirtschaftsförderung
- 6.3.2 Stärken und Chancen der Musikwirtschaftsförderung
- 6.4 Das Konzept „Musikexportbüro“
- 7. Rechtliche Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene
- 7.1 Die Landesmediengesetze in Deutschland
- 7.2 Die Rundfunkstaatsverträge in Deutschland
- 7.3 Die Rundfunkurteile des Bundesverfassungsgerichts
- 7.4 Die Rahmengesetze der Europäischen Union
- 8. Ergebnis der rechtlichen Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die kontroverse Debatte um eine Quote für deutschsprachige Musik im Hörfunk. Ziel ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Interessenkonflikten zwischen Musikwirtschaft, Hörfunkanbietern und Politik. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen, untersucht das französische Modell als möglichen Vergleich, und analysiert die aktuelle Situation im deutschen Hörfunkmarkt anhand von Daten und Zahlen.
- Chronologie und Entwicklung der Quotendiskussion
- Analyse des französischen Musikquotenmodells
- Bewertung der aktuellen Situation des deutschen Hörfunkmarktes
- Auswertung relevanter Daten zur Mediennutzung und Musikpräferenzen
- Untersuchung alternativer Fördermodelle für deutsche Musik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die kontroverse Debatte um die Musikquote im deutschen Hörfunk und die unterschiedlichen Positionen von Beteiligten wie Politik, Künstlern und Radiosendern. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der eine kritische Betrachtung der Interessenkonflikte zum Ziel hat und die Pro- und Contra-Argumente analysiert.
2. Die Chronologie der Quotendiskussion: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Diskussion um eine Musikquote, von ihren Anfängen bis zum aktuellen Stand. Es werden wichtige Ereignisse, Positionen und Argumente der verschiedenen Akteure chronologisch dargestellt und die aktuelle Situation im Diskurs um eine gesetzliche Regelung beleuchtet.
3. Das französische Modell als Vorbild einer deutschen Quotenregelung?: Dieses Kapitel analysiert das französische Modell der Musikquotenregelung im Hörfunk. Es untersucht die dortigen Quotierungen, die Umsatzentwicklung der französischen Musikbranche und die kulturellen und politischen Strukturen, die das Modell beeinflussen. Der Vergleich dient dazu, die Übertragbarkeit des französischen Modells auf den deutschen Kontext zu prüfen.
4. Der Hörfunk in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt den deutschen Hörfunkmarkt, insbesondere die Aspekte der musikalischen Grundversorgung, Hörererwartungen, Hörernutzung und Musikprogrammgestaltung. Es untersucht den Einfluss von Musiktestverfahren und Radioformaten auf die Programmauswahl und analysiert den Stellenwert von deutschsprachiger Musik im Hörfunkprogramm.
5. Aktuelle Zahlen zur Mediennutzung: Kapitel 5 präsentiert aktuelle Zahlen und Daten zur Mediennutzung in Deutschland, mit Fokus auf Musik- und Sprachanteile im Hörfunk. Die Daten sollen die im vorherigen Kapitel theoretisch erörterten Punkte veranschaulichen und die tatsächliche Verbreitung deutschsprachiger Musik beleuchten. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Glaubwürdigkeit und Aussagekraft der Daten findet statt.
6. Musik- und Künstlerförderung als Supplement einer Quotenregelung: Dieses Kapitel untersucht alternative Förderinstrumente für nationale Musikproduktionen, die in der Quotendebatte oft nur am Rande erwähnt werden. Es analysiert die öffentliche und private Musikförderung in Deutschland, beleuchtet die Stärken und Schwächen bestehender Förderstrukturen und präsentiert das Konzept „Musikexportbüro“ als ein Beispiel für eine konzertierte Aktion zur Förderung deutscher Musik im Ausland.
7. Rechtliche Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene: Kapitel 7 beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Hörfunk auf nationaler und europäischer Ebene. Es untersucht Landesmediengesetze, Rundfunkstaatsverträge, Urteile des Bundesverfassungsgerichts sowie EU-Rahmengesetze, um die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Musikquote zu erörtern.
Schlüsselwörter
Musikquote, deutschsprachige Musik, Hörfunk, Mediennutzung, Musikförderung, französisches Modell, Rundfunkrecht, Medienpolitik, Musikwirtschaft, Programmgestaltung, Hörererwartung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Musikquote im deutschen Hörfunk"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die kontroverse Debatte um eine Quote für deutschsprachige Musik im deutschen Hörfunk. Sie untersucht die Interessenkonflikte zwischen Musikwirtschaft, Hörfunkanbietern und Politik und beleuchtet die historischen Entwicklungen, das französische Modell als möglichen Vergleich und die aktuelle Situation des deutschen Hörfunkmarktes.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen und Argumenten in der Quotendebatte. Es soll ein umfassender Überblick über die historische Entwicklung, die aktuelle Situation und die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben werden. Zusätzlich werden alternative Fördermodelle für deutsche Musik untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Chronologie der Quotendiskussion, eine Analyse des französischen Musikquotenmodells, die Bewertung der aktuellen Situation des deutschen Hörfunkmarktes, die Auswertung relevanter Daten zur Mediennutzung und Musikpräferenzen sowie die Untersuchung alternativer Fördermodelle für deutsche Musik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Chronologie der Quotendiskussion, das französische Modell als Vorbild, der deutsche Hörfunkmarkt, aktuelle Zahlen zur Mediennutzung, Musik- und Künstlerförderung, rechtliche Rahmenbedingungen und ein abschließendes Ergebnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Quotendebatte.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet aktuelle Zahlen und Daten zur Mediennutzung in Deutschland, mit Fokus auf Musik- und Sprachanteile im Hörfunk. Diese Daten dienen dazu, die theoretischen Erörterungen zu veranschaulichen und die tatsächliche Verbreitung deutschsprachiger Musik zu beleuchten. Die Glaubwürdigkeit und Aussagekraft der Daten wird kritisch bewertet.
Wird das französische Modell untersucht?
Ja, die Arbeit analysiert das französische Modell der Musikquotenregelung im Detail. Sie untersucht die dortigen Quotierungen, die Umsatzentwicklung der französischen Musikbranche und die kulturellen und politischen Strukturen, um die Übertragbarkeit des Modells auf den deutschen Kontext zu prüfen.
Welche Rolle spielt die Musikförderung?
Die Arbeit untersucht alternative Förderinstrumente für nationale Musikproduktionen als Ergänzung zu einer möglichen Quotenregelung. Sie analysiert die öffentliche und private Musikförderung in Deutschland, beleuchtet die Stärken und Schwächen bestehender Förderstrukturen und präsentiert Beispiele für Fördermodelle.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Hörfunk auf nationaler und europäischer Ebene. Sie untersucht Landesmediengesetze, Rundfunkstaatsverträge, Urteile des Bundesverfassungsgerichts und EU-Rahmengesetze, um die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen einer Musikquote zu erörtern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Musikquote, deutschsprachige Musik, Hörfunk, Mediennutzung, Musikförderung, französisches Modell, Rundfunkrecht, Medienpolitik, Musikwirtschaft, Programmgestaltung, Hörererwartung.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Ergebnisse jedes Abschnitts hervorhebt. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über den Inhalt der Arbeit.
- Citation du texte
- Clemens Schnur (Auteur), 2005, Quote für deutschsprachige Musik im Hörfunk - Pro und Contra, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46906