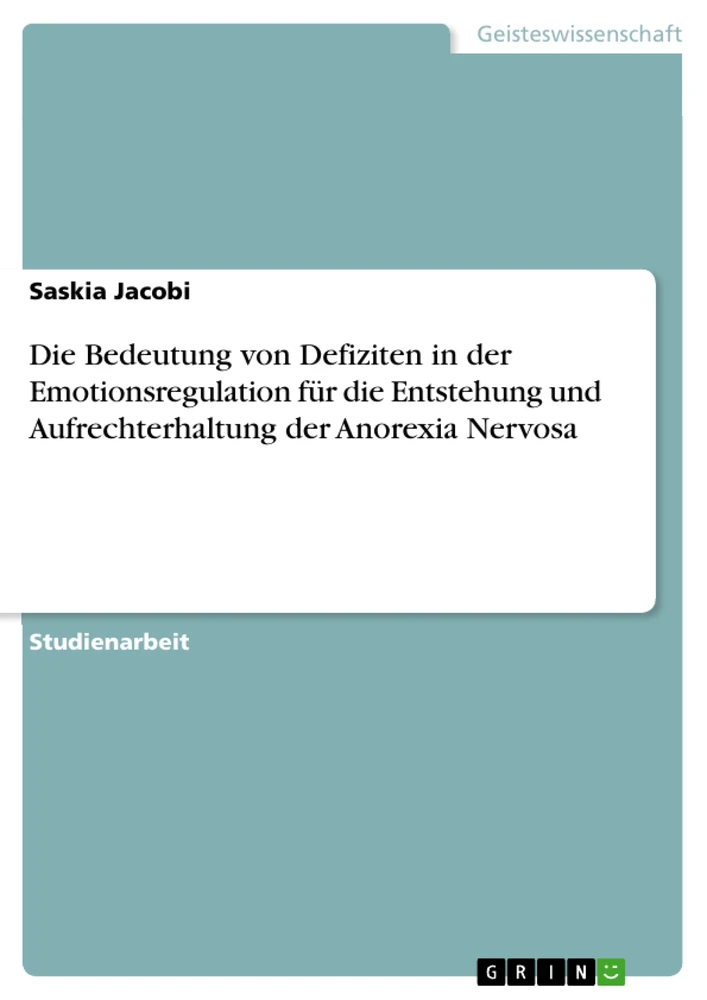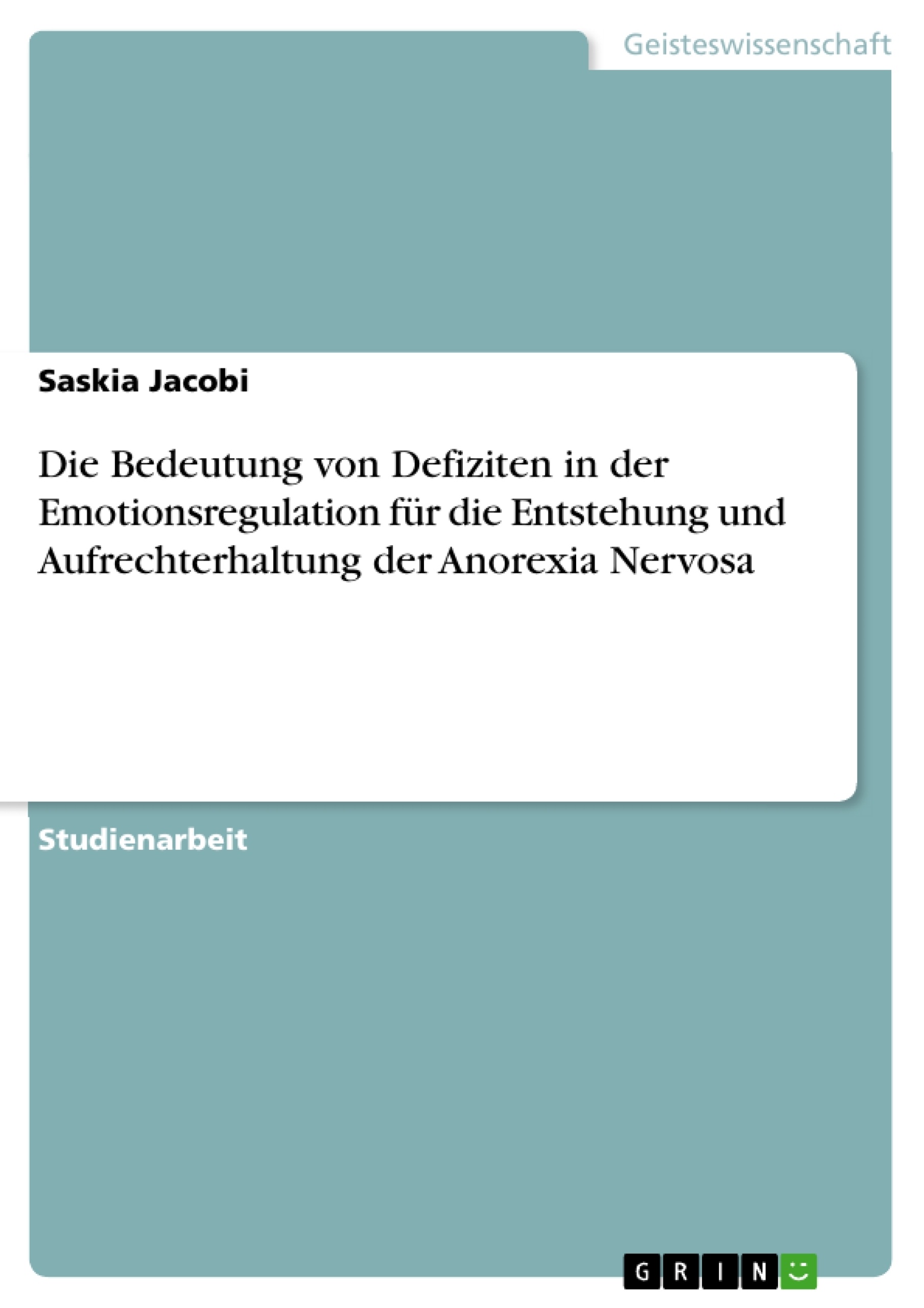Jugendliche und auch eine Vielzahl der Erwachsenen suchen nach Vorbildern, an denen sie sich bezüglich des Verhaltens und Aussehens orientieren können. In den sozialen Medien wie Instagram oder Facebook wird zunehmend ein extrem schlanker und trainierter Körper als Schönheitsideal propagiert, sodass dieser insbesondere für junge Frauen als Orientierungspunkt dient und angestrebt wird zum Beispiel in Form von Diäten.
Diese soziokulturellen Faktoren, nämlich die Medien und Schönheitsideale in der Gesellschaft spiegeln einen Bereich der Ursachen für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen wider, die wiederum in Wechselwirkung zueinander stehen. Essstörungen werden definiert als Störungen der Gewichtskontrolle und/oder Essgewohnheiten und gehören der Gruppe der Verhaltensstörungen an. Laut des DSM-IV-TR, einem amerikanischen Klassifikationssystem von psychischen Störungen lassen sich drei Klassen von Essstörungen unterscheiden: Die Anorexia Nervosa (AN) (307.1), die Bulimia Nervosa (BN) (307.51) und die Kategorie der „nicht näher bezeichneten Esstörungen“, wozu zum Beispiel die „Binge-Eating-Störung“ zählt (307.50).
Nicht nur die Medien oder Schönheitsideale in der Gesellschaft können die Entstehung einer Essstörung begünstigen, sondern auch biologische-, familiäre- und individuelle Faktoren. Zu den individuellen Faktoren gehört beispielsweise die dysfunktionale Emotionsregulation (ER). Dieser Faktor wird in der bestehenden Literatur kontrovers diskutiert und einige Informationen bezüglich des Einflusses wurden noch nicht untersucht. Aufgrund der zunehmenden Thematisierung und für zukünftige, darauf aufbauende Therapieansätze soll im Folgenden die Bedeutung von Defiziten in der Emotionsregulation für die Entstehung und Aufrechterhaltung speziell im Rahmen der AN ergründet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Das Störungsbild der Anorexia Nervosa
- Epidemiologie
- Diagnostikkriterien
- Symptomatik der Erkrankung
- Ätiologie
- Die Rolle von Emotionen bei der Anorexia Nervosa
- Definition Emotionsregulation
- Emotionsregulation bei der Anorexia Nervosa
- Diskussion
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Defiziten in der Emotionsregulation für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Anorexia Nervosa (AN). Ziel ist es, den Einfluss dysfunktionaler Emotionsregulationsstrategien auf das Krankheitsbild zu beleuchten und den aktuellen Forschungsstand darzustellen.
- Epidemiologie und Diagnostik der Anorexia Nervosa
- Die Rolle von Emotionen und Emotionsregulation im Allgemeinen
- Dysfunktionale Emotionsregulation bei Patient*innen mit AN
- Mögliche Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation und dem Entstehen/Aufrechterhalten von AN
- Ausblick auf zukünftige Forschung und Therapieansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Anorexia Nervosa ein und erläutert den soziokulturellen Kontext, insbesondere den Einfluss von Medien und Schönheitsidealen. Sie beschreibt die Bedeutung dysfunktionaler Emotionsregulation als einen möglichen Risikofaktor für die Entstehung von AN und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf AN, andere Essstörungen werden nicht betrachtet.
Das Störungsbild der Anorexia Nervosa: Dieses Kapitel beschreibt umfassend das Störungsbild der Anorexia Nervosa. Es behandelt die Epidemiologie, die Diagnostikkriterien (unter Berücksichtigung von BMI und Angst vor Gewichtszunahme) und die Symptomatik der Erkrankung. Die Ätiologie wird angesprochen, wobei die komplexen Ursachen betont und die Schwierigkeiten, alle Faktoren vollständig zu verstehen, hervorgehoben werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Krankheitsbildes in seinen verschiedenen Facetten und der Bedeutung der hohen Mortalitätsrate.
Die Rolle von Emotionen bei der Anorexia Nervosa: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Emotionsregulation und analysiert deren Rolle bei der Anorexia Nervosa. Es untersucht, wie Patient*innen mit AN Schwierigkeiten in der Emotionsregulation bewältigen, oft durch den Rückgriff auf Essstörungsverhalten wie Nahrungsrestriktion. Es werden Unterschiede zwischen den Subtypen der Anorexia Nervosa bezüglich des Schweregrades dysfunktionaler Emotionsregulation diskutiert, wobei die Limitationen der bisherigen Forschung auf jugendliche Patient*innen betont werden. Die Bedeutung der Emotionsregulation als potenziellen Schutzfaktor für die psychische Gesundheit wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Anorexia Nervosa, Essstörung, Emotionsregulation, dysfunktionale Emotionsregulation, Epidemiologie, Diagnostik, Ätiologie, Schutzfaktor, Risikofaktor, Therapieansätze, Mortalität, soziokulturelle Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Rolle von Emotionsregulation bei Anorexia Nervosa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Defiziten in der Emotionsregulation und der Entstehung sowie Aufrechterhaltung von Anorexia Nervosa (AN). Der Fokus liegt auf dem Einfluss dysfunktionaler Emotionsregulationsstrategien auf das Krankheitsbild und der Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Andere Essstörungen werden nicht berücksichtigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Epidemiologie und Diagnostik von Anorexia Nervosa, die Rolle von Emotionen und Emotionsregulation im Allgemeinen, dysfunktionale Emotionsregulation bei AN-Patient*innen, mögliche Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation und dem Entstehen/Aufrechterhalten von AN sowie einen Ausblick auf zukünftige Forschung und Therapieansätze.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung, eine Einleitung, ein Kapitel zum Störungsbild der Anorexia Nervosa (inklusive Epidemiologie, Diagnostikkriterien, Symptomatik und Ätiologie), ein Kapitel zur Rolle von Emotionen bei Anorexia Nervosa (mit Definition der Emotionsregulation und deren Analyse bei AN-Patient*innen), eine Diskussion und eine Schlussfolgerung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der Anorexia Nervosa ein, erläutert den soziokulturellen Kontext (insbesondere den Einfluss von Medien und Schönheitsidealen), beschreibt die Bedeutung dysfunktionaler Emotionsregulation als möglichen Risikofaktor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was beinhaltet das Kapitel zum Störungsbild der Anorexia Nervosa?
Dieses Kapitel beschreibt umfassend das Störungsbild der Anorexia Nervosa, inklusive Epidemiologie, Diagnostikkriterien (BMI und Angst vor Gewichtszunahme), Symptomatik und Ätiologie. Die Komplexität der Ursachen und die hohe Mortalitätsrate werden hervorgehoben.
Was wird im Kapitel zur Rolle von Emotionen bei Anorexia Nervosa behandelt?
Dieses Kapitel definiert Emotionsregulation und analysiert deren Rolle bei AN. Es untersucht den Umgang von AN-Patient*innen mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation (oft durch Essstörungsverhalten), diskutiert Unterschiede zwischen AN-Subtypen bezüglich des Schweregrades dysfunktionaler Emotionsregulation (mit Hinweis auf Limitationen der Forschung bezüglich jugendlicher Patient*innen) und behandelt die Bedeutung der Emotionsregulation als potenziellen Schutzfaktor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Anorexia Nervosa, Essstörung, Emotionsregulation, dysfunktionale Emotionsregulation, Epidemiologie, Diagnostik, Ätiologie, Schutzfaktor, Risikofaktor, Therapieansätze, Mortalität und soziokulturelle Einflüsse.
- Citation du texte
- Saskia Jacobi (Auteur), 2018, Die Bedeutung von Defiziten in der Emotionsregulation für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Anorexia Nervosa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469283