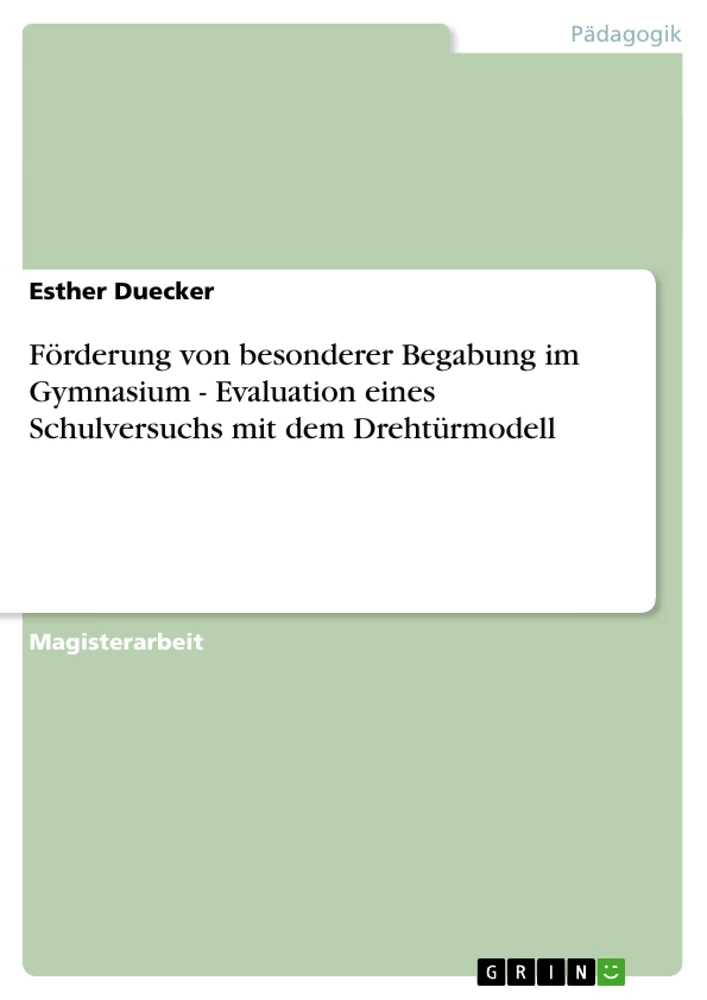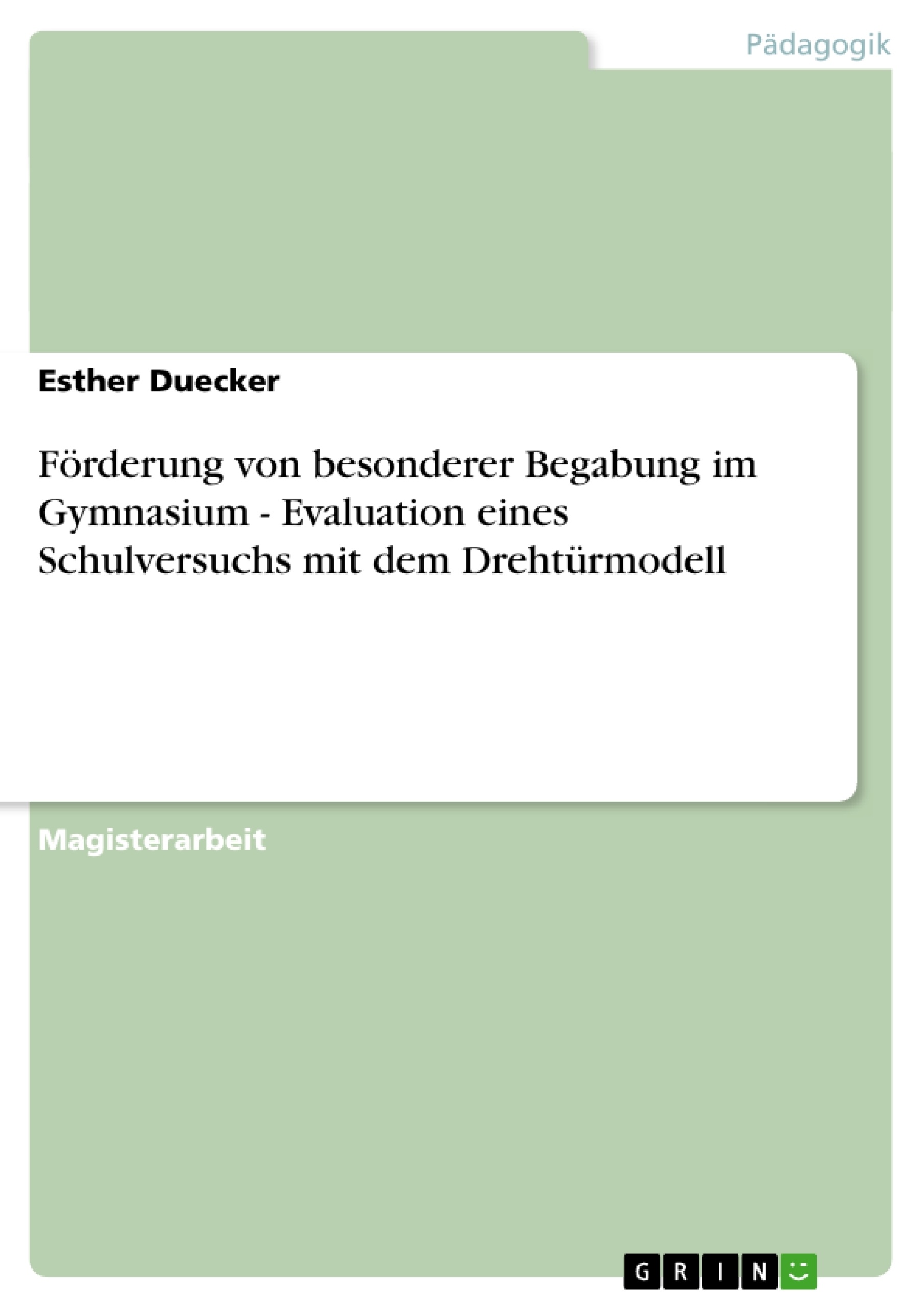„Begabung setzt sich durch“. Dieser Satz bestätigt sich womöglich in einer Reihe von Fällen. „Manche aber - und wer weiß wie viele? - verzehren sich in stillem Trotz und gehen unter.“ (Hesse 2003, 91). Die vielzitierte Textstelle Hesses weist auf die Schwierigkeiten hin, denen hochbegabte Kinder besonders in der Schule unterliegen können.
Seit Anfang der 80er Jahre hat sich die Förderung besonders begabter Kinder an deutschen Schulen durchgesetzt, so dass die von der Bundesregierung geforderte Chancengleichheit für alle Schüler, die die Förderung Begabter einschließt, mehr und mehr verwirklicht wird. Veröffentlichungen zu diesem Thema schießen sprichwörtlich wie Pilze aus dem Boden. Sie liefern wertvolle Tipps zur praktischen Umsetzung und zeigen vorbildliche Beispielschulen der Bundesrepublik auf, die Förderprogramme verschiedenster Art anbieten (vgl. BLK, Heft 91). Im Gegensatz zu den vielfältigen Aktivitäten im Förderbereich verfügt die Forschung nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch über sehr wenig empirische Nachweise der Effizienz von Förderprogrammen an deutschen Schulen.
Evaluationen im Rahmen einer schulischen Begabtenfördermaßnahme sind besonders für eine Schule von Interesse, da die dafür aufgewendeten Kosten für personelle, finanzielle und soziale Ressourcen der Schule erfolgreich eingesetzt werden sollen. Die Schule darf ein Fördermodell nicht lediglich mit dem Anspruch einführen, begabte Kinder in irgend einer Weise zu beschäftigen und gleichzeitig das Renommee der Schule zu verbessern, sondern sie muss gewährleisten, dass die Maßnahme tatsächlich die Ziele des jeweiligen Fördermodells erreicht. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern und vor allem mit den USA - die Evaluationsmaßnahmen als einen festen Bestandteil im Fördermodell verankert haben - werden Evaluationen in Deutschland noch in zu geringem Umfang durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abbildungsverzeichnis
- Diagrammverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Theoretische Grundlagen
- 1.1 Grundlagen, Ausgangspunkt und Fundament dieser Arbeit
- 1.1.1 Terminologie
- 1.1.2 Das „Drei-Ringe-Modell“ der Hochbegabung nach Renzulli
- 1.1.3 Resümee
- 1.2 Förderung in der Schule
- 1.2.1 Kurzdarstellung des rechtlichen Rahmens
- 1.2.2 Außerschulische und innerschulische Fördermöglichkeiten
- 1.2.3 Akzeleration und Enrichment
- 1.2.4 Mischformen aus Akzeleration und Enrichment
- 1.2.4.1 Das SEM und das „,Drehtürmodell“ nach Renzulli
- 1.2.4.1.1 Das dreistufige Enrichment
- 1.2.4.1.2 Das Drehtürmodell nach Renzulli bzw. nach Klingen
- 1.2.4.2 Evaluation von Fördermaßnahmen
- 1.2.5 Resümee
- 1.3 Das Weser-Gymnasium Vlotho
- 1.3.1 Das \"WGV-Drehtürmodell\"
- 1.3.2 Ziele des Begabtenförderprogramms „,WGV-Drehtürmodell”
- 1.3.3 Operationalisierung der Maßnahmewirkung
- 2 Methode
- 2.1 Untersuchungsdesign
- 2.1.1 Untersuchungsplan
- 2.1.2 Vortest
- 2.1.3 Kritik und Änderungen
- 2.2 Erhebungsinstrumente
- 2.2.1 Schülerfragebogen
- 2.2.2 Elternfragebogen
- 2.2.3 Fachlehrerfragebogen
- 2.2.4 Kursdozenteninterview
- 2.3 Untersuchungsart und Durchführung
- 2.3.1 Untersuchungsart
- 2.3.2 Durchführung der Befragung
- 2.4 Auswertung
- 2.4.1 Probleme und Lösungsversuche
- 2.4.2 Mögliche Störfaktoren
- 3 Ergebnisse
- 3.1 Darstellung der Ergebnisse der Schülerfragebögen
- 3.1.1 Stichprobe
- 3.1.2 Soziale Integration
- 3.1.3 Herausforderung
- 3.1.4 Lernmotivation
- 3.1.5 Leistung
- 3.1.6 Rahmenbedingungen
- 3.1.7 Heterogenität
- 3.2 Darstellung der Ergebnisse der Elternfragebögen
- 3.2.1 Stichprobe
- 3.2.2 Soziale Integration
- 3.2.3 Herausforderung
- 3.2.4 Lernmotivation
- 3.2.5 Leistung
- 3.2.6 Rahmenbedingungen
- 3.3 Darstellung der Ergebnisse der Fachlehrerfragebögen
- 3.3.1 Stichprobe
- 3.3.2 Soziale Integration, Herausforderung, Leistung
- 3.3.2.1 Schüler 1
- 3.3.2.2 Schüler 2
- 3.3.2.3 Schüler 3
- 3.3.2.4 Schüler 4
- 3.3.2.5 Schüler 5
- 3.3.2.6 Schülerin 6
- 3.3.2.7 Schüler 7
- 3.3.2.8 Schülerin 8
- 3.3.2.9 Schüler 9
- 3.3.3 Rahmenbedingungen
- 3.4 Darstellung der Ergebnisse der Interviews
- 3.4.1 Astronomiedozent
- 3.4.1.1 Soziale Integration
- 3.4.1.2 Heterogenität
- 3.4.2 Japanischdozentin
- 3.4.2.1 Soziale Integration
- 3.4.2.2 Heterogenität
- 3.5 Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von besonderer Begabung im Gymnasium, genauer gesagt die Evaluation eines Schulversuchs mit dem Drehtürmodell am Weser-Gymnasium Vlotho. Die Arbeit analysiert die Wirksamkeit des Fördermodells anhand der Erfahrungen von Schülern, Eltern und Lehrkräften. Dabei werden die Auswirkungen des Modells auf die soziale Integration, die Herausforderung der Schüler, die Lernmotivation, die Leistung sowie die Rahmenbedingungen der Förderung untersucht.
- Begabtenförderung im Gymnasium
- Evaluation eines Schulversuchs mit dem Drehtürmodell
- Wirkung des Fördermodells auf Schüler, Eltern und Lehrkräfte
- Analyse der sozialen Integration, der Herausforderung, der Lernmotivation, der Leistung und der Rahmenbedingungen der Förderung
- Identifizierung möglicher Stärken und Schwächen des Drehtürmodells
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit werden erörtert. Es wird der rechtliche Rahmen der Förderung von Hochbegabung erläutert und verschiedene Fördermodelle vorgestellt, mit besonderem Fokus auf das Drehtürmodell nach Renzulli.
- Kapitel 2: Die Methodik der Untersuchung wird beschrieben, einschließlich des Untersuchungsdesigns, der Erhebungsinstrumente und der Auswertungsmethode.
- Kapitel 3: Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert. Es werden die Daten aus Schülerfragebögen, Elternfragebögen, Fachlehrerfragebögen und Interviews analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Begabtenförderung, Hochbegabung, Drehtürmodell, Evaluation, Schulversuch, Gymnasium, soziale Integration, Herausforderung, Lernmotivation, Leistung, Rahmenbedingungen, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Drehtürmodell“ in der Begabtenförderung?
Das Drehtürmodell erlaubt es besonders begabten Schülern, den regulären Unterricht zeitweise zu verlassen, um an eigenen Projekten oder Kursen (z. B. Japanisch oder Astronomie) zu arbeiten.
Was besagt das „Drei-Ringe-Modell“ nach Renzulli?
Nach Renzulli entsteht Hochbegabung aus dem Zusammenspiel von drei Faktoren: überdurchschnittliche Fähigkeiten, hohe Kreativität und eine ausgeprägte Aufgabenverpflichtung (Motivation).
Wie wirkt sich die Förderung auf die soziale Integration aus?
Evaluationen zeigen, dass gezielte Förderung die soziale Integration oft verbessert, da die Schüler sich weniger unterfordert fühlen und ihre individuellen Stärken positiv in die Schulgemeinschaft einbringen können.
Was ist der Unterschied zwischen Akzeleration und Enrichment?
Akzeleration bedeutet das schnellere Durchlaufen des Lehrplans (z. B. Klassen überspringen). Enrichment bezeichnet die qualitative Vertiefung und Erweiterung des Lernstoffs über den Standardlehrplan hinaus.
Warum sind Evaluationen von Schulversuchen wichtig?
Evaluationen stellen sicher, dass die eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen tatsächlich die pädagogischen Ziele erreichen und die Schüler optimal gefördert werden.
- Citar trabajo
- Esther Duecker (Autor), 2004, Förderung von besonderer Begabung im Gymnasium - Evaluation eines Schulversuchs mit dem Drehtürmodell, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46935