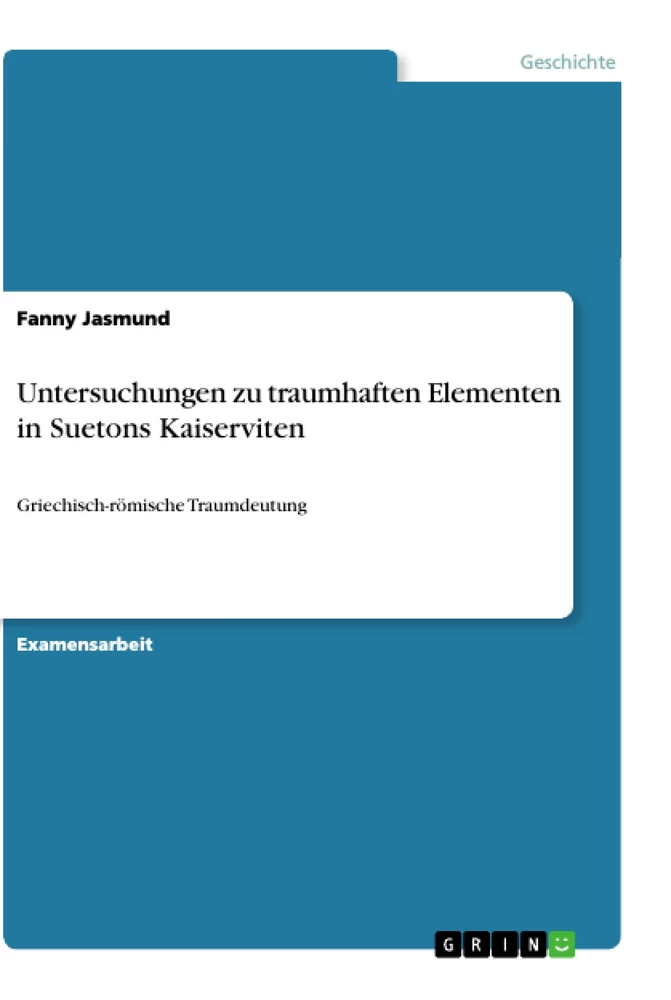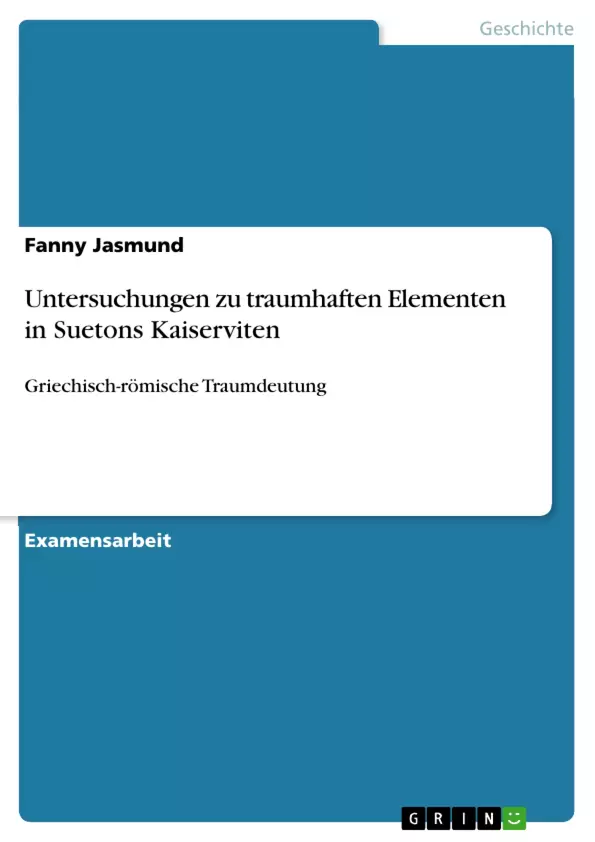In dieser Arbeit geht es darum, den Traum als literarisches Motiv in all seinen Facetten offenzulegen. Es sollen nicht die vielzähligen Traumtheorien und Traumdiskurse im Vordergrund stehen, sondern die Eigenarten des Traumes innerhalb einer literarischen Komposition.
Der Traum ist ein menschliches Mysterium, was jedem bekannt ist und wachsendem Interesse unterliegt. Ob nachts oder am Tag, während der Arbeit oder in ruhigen Momenten, wir träumen ständig. Tagtäglich, stündlich. Träume können Sehnsüchte widerspiegeln, Erlebtes konvertieren, erleichtern oder verwirren. Sie können aber auch Angst auslösen oder bedrohlich wirken. Sagen Sie einmal auf einer Feier oder bei einem Treffen mit Freunden, dass Sie eine wissenschaftliche Arbeit über Träume verfassen. Das Interesse ist Ihnen sicher. Schon im Altertum ist der Traum eine individuelle Komponente im menschlichen Leben, was zahlreiche Schriftzeugnisse belegen.
Vor 4000 Jahren entstanden erste Traumlexika. Im alten Ägypten waren es die „Meister der geheimen Dinge“, Priester, die sich der Traumdeutung widmeten. Aus Griechenland liefert uns der antike Traumdeuter Artemidoros von Daldis aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert durch seine fünfbändige Schrift Oneirokritikon eines der grundlegendsten und umfassendsten Werke, die jemals über Träume und ihrer Deutung verfasst wurden. Seine Schrift gründet auf ausgiebiger Feldforschung und langjähriger Berufserfahrung als Deuter und umfasst rund 1400 Traummotive und deren Deutung. Grundlegende Erfahrungen menschlichen Daseins finden in jede Literatur Einlass. So auch der Traum. In antiker Überlieferung spielten Träume eine bedeutende Rolle. Sie zählten zur Divination, zur Vorzeichendeutung oder zum Orakelwesen.
Seit den Homerischen Epen begegnet uns eine bekannte divinatorische Auffassung des Traumes. Sie kamen entweder von außen, etwa von den Göttern oder Dämonen, oder von innen, aus dem Körper bzw. aus der Seele des Menschen. Götter kündigten künftiges Geschehen an, während der Körper Erlebnisse und Eindrücke des Tages verarbeitete.Indem Dichter Träume in ihren Werken literarisch verankerten, übertrugen sie diesen spezifische Aufgaben, sei es als Motiv des poetischen Erzählens oder als Darstellung eines allen Menschen bekannten Phänomens. In Epos, Tragödie und Roman begegnet uns der Traum als literarisches Motiv in besonderem Maße.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung
- Methode und Aufbau
- Träume in der griechisch-römischen Literatur
- Träume aus Epos, Tragödie und Roman
- Träume in der antiken Historiographie
- Träume der Mächtigen in der antiken Biographie
- Vorbemerkungen
- Die Biographie in Rom
- Träume in der römischen Kaiserzeit
- Suetons Kaiserviten
- Träume in den 12 Kaiserbiographien Suetons– Einzeluntersuchungen
- Vorbemerkungen
- DIVUS IULIUS
- TIBERIUS
- C. CALIGULA
- DIVUS CLAUDIUS
- NERO
- GALBA
- OTHO
- VITELLIUS
- DIVUS VESPASIANUS
- DIVUS TITUS
- DOMITIANUS
- Motive und Funktionen der Träume bei Sueton
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Traum als literarischem Motiv in der römischen Kaiserzeit. Sie untersucht anhand von Suetons Kaiserviten, wie Träume innerhalb dieser Biographien dargestellt werden und welche Funktionen ihnen zukommen. Der Fokus liegt dabei auf den Träumen der römischen Kaiser, ihrer Bedeutung im Kontext der Biographie und der Rolle, die sie in der literarischen Gestaltung spielen.
- Die Bedeutung von Träumen in der römischen Literatur
- Die Funktion von Träumen in Suetons Kaiserviten
- Der Einfluss der Träume auf das Bild der Kaiser
- Die literarische Gestaltung von Träumen in Suetons Werk
- Die Rezeption von Träumen in der Antike
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Träume“ in den literarischen Kontext der Antike und führt in die Fragestellung der Arbeit ein. Sie skizziert die Methode und den Aufbau der Untersuchung, die sich auf Suetons Kaiserviten fokussiert.
Kapitel 2 beleuchtet die allgemeine Rolle von Träumen in der griechisch-römischen Literatur. Es werden Beispiele aus Epos, Tragödie und Roman sowie aus der antiken Historiographie aufgezeigt, um die Bedeutung von Träumen in verschiedenen Genres der Antike zu verdeutlichen.
Kapitel 3 untersucht die Bedeutung von Träumen in der römischen Biographie, insbesondere im Kontext von Suetons Kaiserviten. Es werden die historischen Hintergründe und die spezifischen Eigenschaften der römischen Biographie erläutert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Analyse von Träumen in Suetons Kaiserviten. Es werden einzelne Kaiserbiographien betrachtet und die Motive, Funktionen und die literarische Gestaltung der Träume untersucht.
Schlüsselwörter
Römische Kaiserzeit, Sueton, Kaiserviten, Träume, literarisches Motiv, Biographie, Funktion, Interpretation, antike Literatur, Divination, Vorzeichendeutung, politisches Symbol.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion haben Träume in Suetons Kaiserviten?
Träume dienen als literarisches Motiv zur Vorzeichendeutung (Divination) und charakterisieren die Herrscher sowie deren Schicksal in der antiken Biographie.
Wer war Artemidoros von Daldis?
Ein antiker Traumdeuter des 2. Jahrhunderts n. Chr., dessen Werk "Oneirokritikon" eines der umfassendsten Bücher über Traummotive und deren Deutung ist.
Wie unterschieden antike Menschen zwischen Traumquellen?
Träume konnten von außen (Götter, Dämonen) kommen, um die Zukunft anzukündigen, oder von innen (Seele, Körper), um Erlebtes zu verarbeiten.
Welche Kaiserbiographien werden bei Sueton untersucht?
Die Arbeit analysiert Träume in den Biographien von Julius Caesar bis Domitian, darunter auch Nero, Caligula und Vespasian.
Sind Träume in der antiken Historiographie rein fiktiv?
Sie werden als literarische Kompositionen betrachtet, die zwar auf realen Phänomenen basieren, aber gezielt eingesetzt werden, um die Erzählung zu strukturieren oder politische Botschaften zu vermitteln.
- Quote paper
- Fanny Jasmund (Author), 2017, Untersuchungen zu traumhaften Elementen in Suetons Kaiserviten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469592