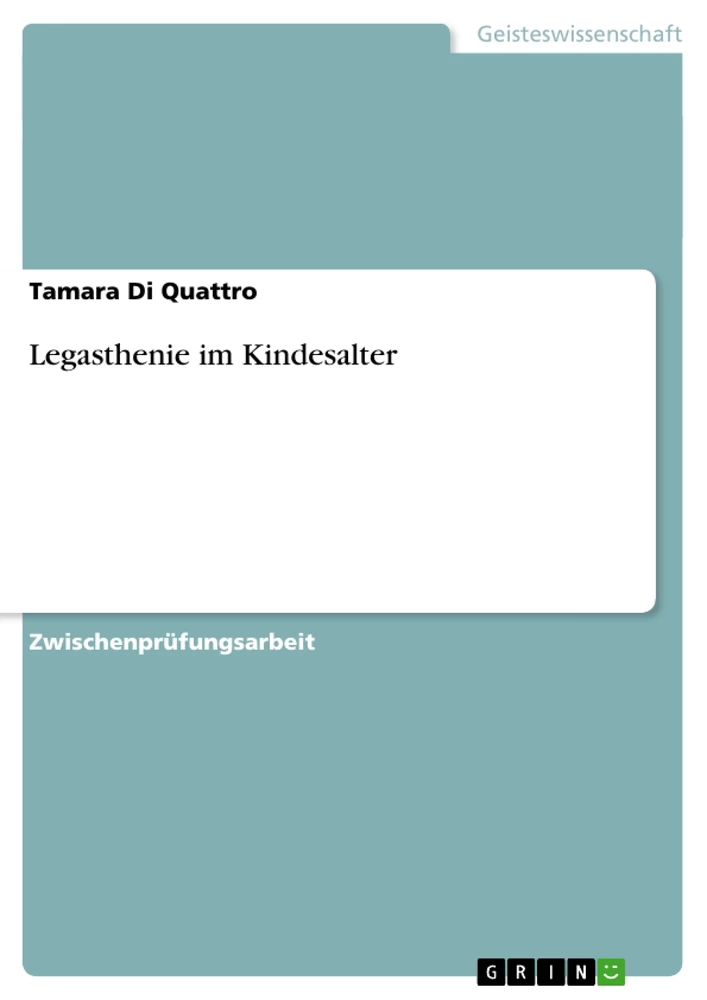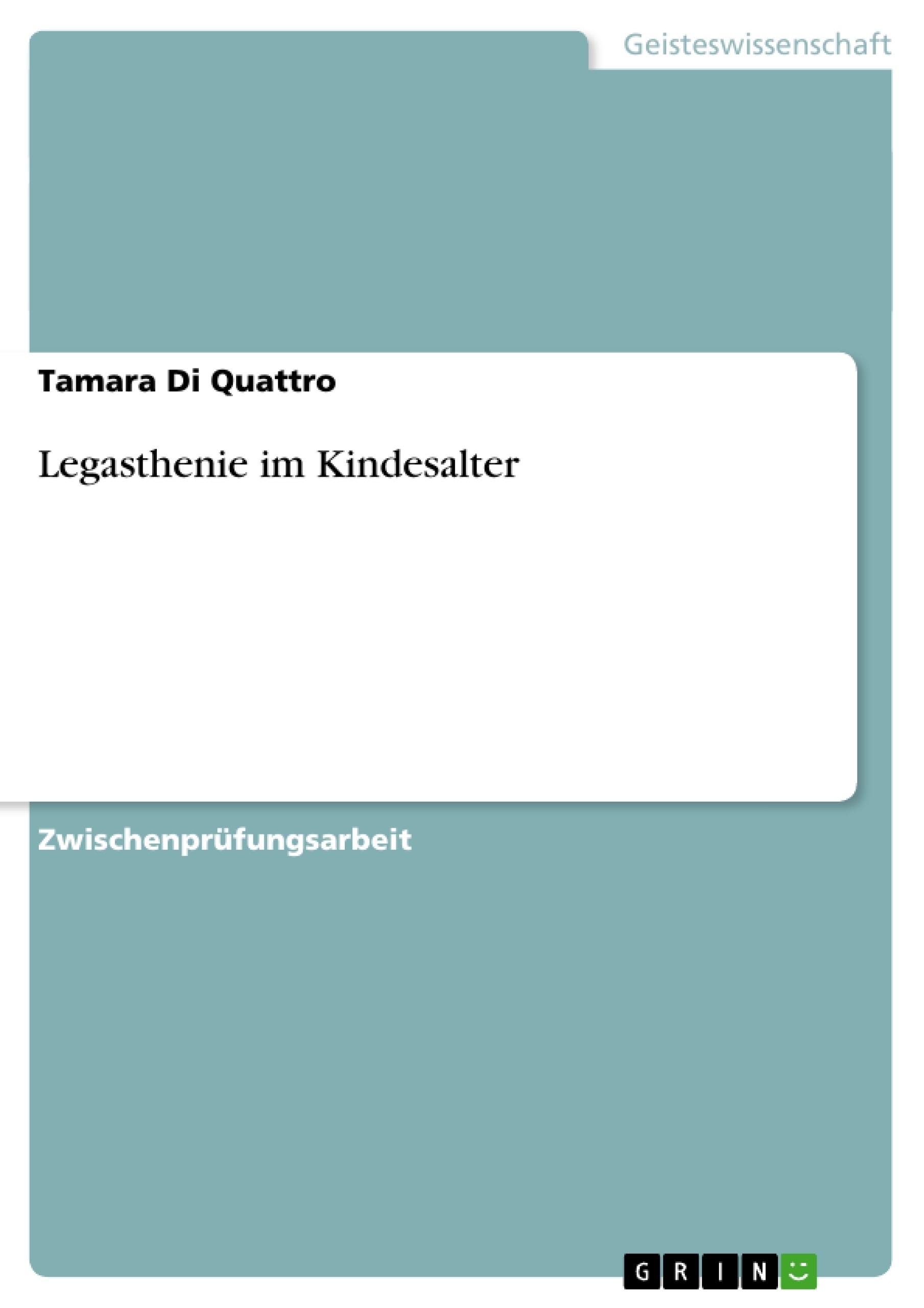Lesen und Schreiben sind grundlegende Kulturtechniken und von zentralem Stellenwert für die Bewältigung der Anforderungen, die das moderne Leben an den Menschen stellt. Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, weil sie Legasthenie haben, sind in ihrer schulischen, beruflichen und sozialen Integration gefährdet. Eine Legasthenie kann zu Deutsch als so genannte Leserechtschreibschwäche bezeichnet werden, kurz sagt man auch LRS. Sie muss für ein Kind aber nicht zu einem Problem werden, das sich derartig auswirkt, denn bei richtiger Behandlung und angemessenen Maßnahmen ist Legasthenie kein Schicksal, welches man hoffnungslos hinnehmen muss. Eltern und Lehrer sollten und müssen in einem solchen Fall unterstützende Hilfe leisten. Legasthenische Kinder sind weder dumm noch faul, sie haben lediglich ein Lernproblem, welches das Lesen und Schreiben betrifft und brauchen in diesem Bezug deshalb mehr Zeit und Hilfe als andere normal entwickelte Kinder. Es ist wichtig, dass die Eltern das Kind mit diesem Problem ernst nehmen und es so akzeptieren, viel Verständnis und viel Geduld aufbringen, und das zumeist verletzte Selbstwertgefühl ihres Kindes stärken. Vor allen Dingen aber ist es für die Entwicklung von bedeutendem Interesse, dass das Kind geliebt wird und sich auch so fühlt, und dies stets unabhängig von seinen Leistungen. Sich ausgiebig zu informieren als betroffene Eltern, über die Störung selbst, über Fördermöglichkeiten und Rechte, ist unerlässlich. Liebevolle und interessierte Eltern schaffen Bedingungen für eine optimale Entwicklung ihres Kindes.
Ebenso hat Schule als Lern- und Bildungsstätte dafür Sorge zu tragen und es als Pflicht und Aufgabe anzusehen, auf dieses Phänomen in angemessener Art und Weise zu reagieren, zumal Legasthenie keine Seltenheit ist. Es müssen alle Voraussetzungen geschaffen werden, die nötig sind, dass jedes Kind eine echte Chance erhält, dass jedes Kind bestmöglich gefördert wird. Nur all zu oft sind Kinder mit Legasthenie allein aufgrund dieser Schwäche Selektionsprozessen ausgeliefert, die eine Erfolg versprechende berufliche Zukunft zerstören bzw. erheblich behindern und erschweren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Schriftspracherwerb
- Zum Begriff Legasthenie
- Abgrenzung
- Beschreibung der Störung
- Erscheinungsform
- Das Störungsbild des Lesens
- Das Störungsbild des Rechtschreibens
- Vorschulische und primäre Begleitstörungen
- Sekundäre Begleitstörungen und Psyche
- Epidemiologie, Verlauf und Prognose
- Epidemiologie
- Prognose und Verlauf
- Diagnostisches Vorgehen
- Erklärungsansätze
- Genetische Erklärungsansätze
- Nichtgenetische Erklärungsansätze
- Neuropsychologische Erklärungsansätze
- Dysfunktion sprachlicher Informationsverarbeitung (Phonembewusstsein)
- Dysfunktion visueller Informationsverarbeitung
- Intervention
- Früherkennung und Frühbehandlung
- Hilfe aus dem Elternhaus (wie Eltern helfen und vorbeugen können)
- Schulische Förderung
- Aufgaben und Pflichten der Schule
- Hilfe im Unterricht
- Gesonderter Förderunterricht
- Außerschulische Förderung (Kosten/sozialrechtliche Bestimmungen/Therapie)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Legasthenie im Kindesalter. Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Einblick in die Thematik zu geben, die Störung zu beschreiben, die Entstehung zu erklären und die verschiedenen Formen der Intervention aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung der Störung Legasthenie
- Erscheinungsformen und Symptome von Legasthenie
- Begleitstörungen, die mit Legasthenie einhergehen können
- Ursachenforschung und Erklärungsansätze
- Möglichkeiten der Frühförderung und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Legasthenie ein und beleuchtet die Bedeutung von Lesen und Schreiben als Kulturtechniken. Sie zeigt die Schwierigkeiten auf, die Legastheniker in ihrer schulischen und sozialen Integration erleben, und betont die Wichtigkeit von Unterstützung und Förderung.
Im zweiten Kapitel wird die Störung Legasthenie genauer beschrieben. Es werden die verschiedenen Erscheinungsformen der Störung sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben dargestellt, sowie die damit verbundenen Symptome und Schwierigkeiten, mit denen Kinder mit Legasthenie konfrontiert sind.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Epidemiologie, dem Verlauf und der Prognose von Legasthenie. Es werden die Häufigkeit der Störung sowie die Entwicklung und der Verlauf des Störungsbildes beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich dem diagnostischen Vorgehen bei Legasthenie. Es werden verschiedene diagnostische Methoden vorgestellt, die zur Erkennung und Abgrenzung der Störung eingesetzt werden können.
Im fünften Kapitel werden verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Legasthenie vorgestellt. Es werden sowohl genetische als auch nichtgenetische Faktoren sowie neuropsychologische Erklärungen beleuchtet.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Intervention bei Legasthenie. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Früherkennung und Frühbehandlung vorgestellt sowie die Rolle des Elternhauses und der Schule in der Förderung von Kindern mit Legasthenie beleuchtet.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Leserechtschreibschwäche, LRS, Schriftspracherwerb, Sprachentwicklungsstörung, Lese- und Rechtschreibstörung, Frühförderung, Intervention, Schule, Elternhaus, neuropsychologische Erklärungsansätze, genetische Erklärungsansätze, diagnostisches Vorgehen, Epidemiologie, Prognose, Verlauf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Legasthenie (LRS)?
Legasthenie ist eine Lese-Rechtschreibstörung, die Kinder trotz normaler Intelligenz beim Erwerb der Schriftsprache erheblich beeinträchtigt.
Was sind typische Symptome beim Lesen und Schreiben?
Dazu gehören langsames Lesen, Vertauschen von Buchstaben, Auslassen von Wörtern und eine hohe Fehlerquote in der Rechtschreibung.
Welche Ursachen für Legasthenie gibt es?
Die Forschung nennt genetische Faktoren sowie neuropsychologische Ursachen, wie Probleme bei der sprachlichen oder visuellen Informationsverarbeitung.
Wie können Eltern ihr Kind unterstützen?
Wichtig sind viel Geduld, Anerkennung unabhängig von der Leistung und die Stärkung des Selbstwertgefühls des Kindes.
Welche Aufgaben hat die Schule bei Legasthenie?
Schulen müssen Fördermaßnahmen anbieten, Hilfen im Unterricht gewähren und durch einen Nachteilsausgleich Selektionsprozesse verhindern.
- Citar trabajo
- Tamara Di Quattro (Autor), 2003, Legasthenie im Kindesalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46966