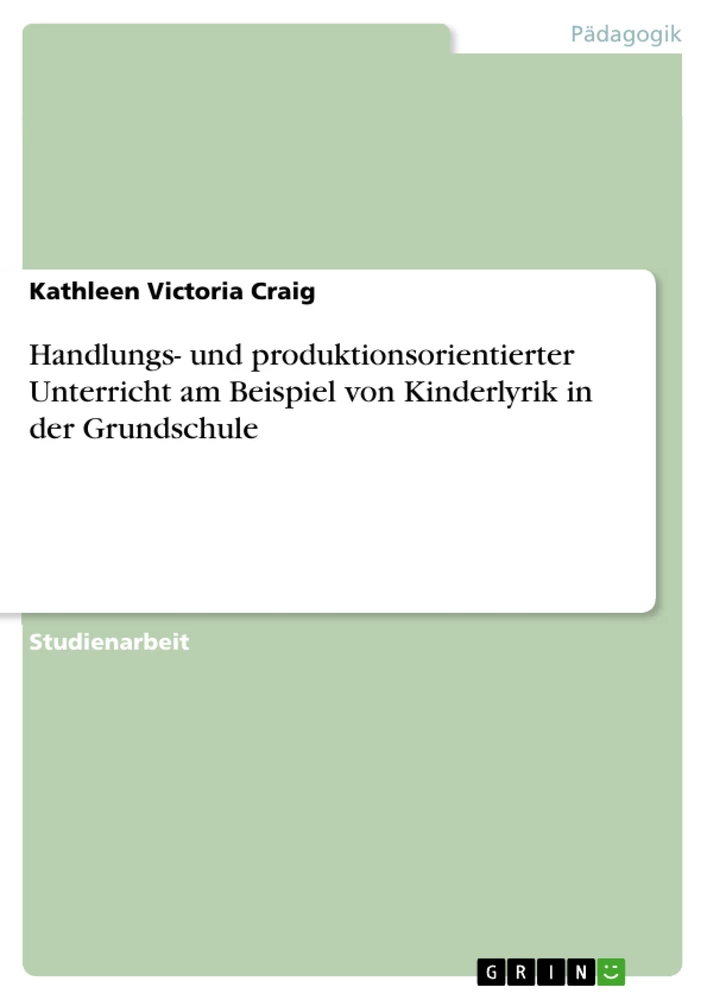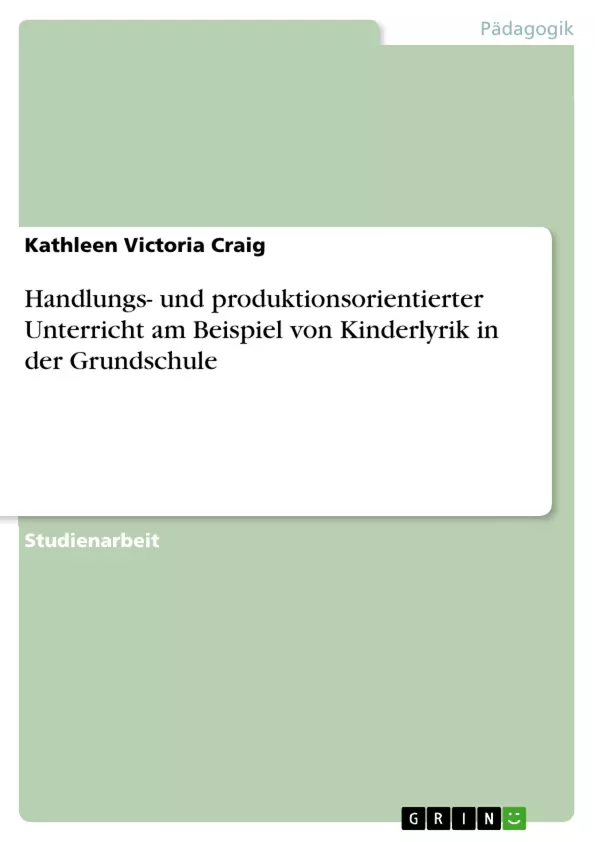„Wozu Lyrik heute?“ ist nicht nur der Buchtitel einer der bedeutendsten Lyrikerinnen der deutschen Gegenwartslyrik, Hilde Domin, sondern auch eine häufig gestellte Frage (junger) Erwachsener. Im Gegensatz dazu steht die Antwort einer Grundschülerin der vierten Klasse auf die Frage hin, wie sie Gedichte finde: „Ich liebe sie!“.
Kinder machen bereits vor Eintritt in die Schule viele Erfahrungen mit Lyrik, etwa durch Reime, Kinderlieder, oder Ähnlichem die fast, ausschließlich positiv sind.
Es liegt in der Verantwortung der Grundschulen dieses Interesse an Lyrik in den Unterricht einzubetten, stärker auszuprägen, zu vertiefen, sie nicht zu vernachlässigen und eine Brücke von der kindlichen Neugier auf Lyrik, zur Lust auf die vertiefte Auseinandersetzung im Erwachsenenalter zu schlagen.
Die Lehrkraft muss sich mit den Rahmenbedingungen vertraut machen: Wie können Begegnungen mit einem Text gestaltet werden, der sich von der gewohnten Alltagssprache abhebt? Laut Domin ist das Gedicht „eine Art Gegenstand, den dritte 'brauchen', das heißt: dessen sie bedürfen und dessen sie sich auch bedienen können" (Domin 1993, S.29). Daraus folgt, dass Lyrik nicht nur einen Gegenstand zum Selbstausdruck darstellt, sondern auch ein Mittel zur Herstellung des Kontakts mit anderen, woraus sich eine Relevanz von handlungs- und produktionsorientiertem Ansätzen ableitet lässt. Wird Kindern eine Vielfalt der Auseinandersetzung mit Gedichten geboten, können sie zeigen was sie berührt und beschäftigt, wodurch sich Gedichte auch für Erwachsene wieder neu öffnen, denn Gedichte sind für alle da.
In der folgenden Arbeit wird vorab der Begriff der Kinderlyrik definiert und in verschiedene Unterkategorien eingeordnet. Im Anschluss wird auf das Konzept des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts eingegangen und das didaktische Potenzial von Kinderlyrik hervorgehoben. Im Hinblick auf die Vielschichtigkeit soll diese Ausarbeitung zunächst einen Einblick in zwei besonders geeignete Methoden geben: szenische Interpretation von Gedichten und analoges Schreiben. Konkretisiert wird diese Darstellung an einem entsprechenden Umgang mit Lyrik, einem Gedicht von Jutta Richter. Diese Ausführung gibt verschiedene Antworten auf die voran gestellte Frage „Wozu Lyrik heute?“ und beleuchtet die Möglichkeiten szenischer Interpretationen und selbst produzierter lyrischer Texte als subjektives Ausdrucksmittel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Definition und Abgrenzung Kinderlyrik
- 2 Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht
- 2.1 Szenische Interpretation
- 2.2 Analoges Schreiben
- 3 Didaktisches Potenzial von Kinderlyrik in der Grundschule
- 3.1 Praxisbezogenes Beispiel
- 3.1.1 Unterrichtsdurchführung
- Fazit
- Reflexion der besuchten Seminare in Modul 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Bedeutung und das didaktische Potenzial von Kinderlyrik im Grundschulunterricht. Sie fokussiert auf die Gestaltung von handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtskonzepten, die Kinder aktiv in den Umgang mit lyrischen Texten einbeziehen.
- Definition und Abgrenzung von Kinderlyrik
- Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht in der Lyrikdidaktik
- Didaktisches Potenzial von Kinderlyrik im Grundschulunterricht
- Praxisbezogene Beispiele für die Umsetzung von Unterrichtskonzepten
- Reflexion der Bedeutung von Kinderlyrik für die kindliche Entwicklung und das Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Frage nach der Relevanz von Lyrik in der heutigen Zeit und verdeutlicht die Bedeutung von Kinderlyrik für die Entwicklung der kindlichen Sprachkompetenz und Lesekultur. Kapitel 1 definiert den Begriff der Kinderlyrik und differenziert zwischen verschiedenen Unterkategorien wie Kinderreimen, Kinderliedern und Kinderspielen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtskonzepten, die den Kindern einen aktiven Zugang zur Lyrik ermöglichen. Die Kapitel 2.1 und 2.2 beschreiben zwei konkrete Methoden: die szenische Interpretation von Gedichten und das analoge Schreiben. Kapitel 3 illustriert das didaktische Potenzial von Kinderlyrik anhand eines praxisbezogenen Beispiels und zeigt Möglichkeiten für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten auf.
Schlüsselwörter
Kinderlyrik, Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht, szenische Interpretation, analoges Schreiben, didaktisches Potenzial, Grundschule, Lyrikdidaktik, Sprachkompetenz, Lesekultur.
- Quote paper
- Kathleen Victoria Craig (Author), 2017, Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht am Beispiel von Kinderlyrik in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469844