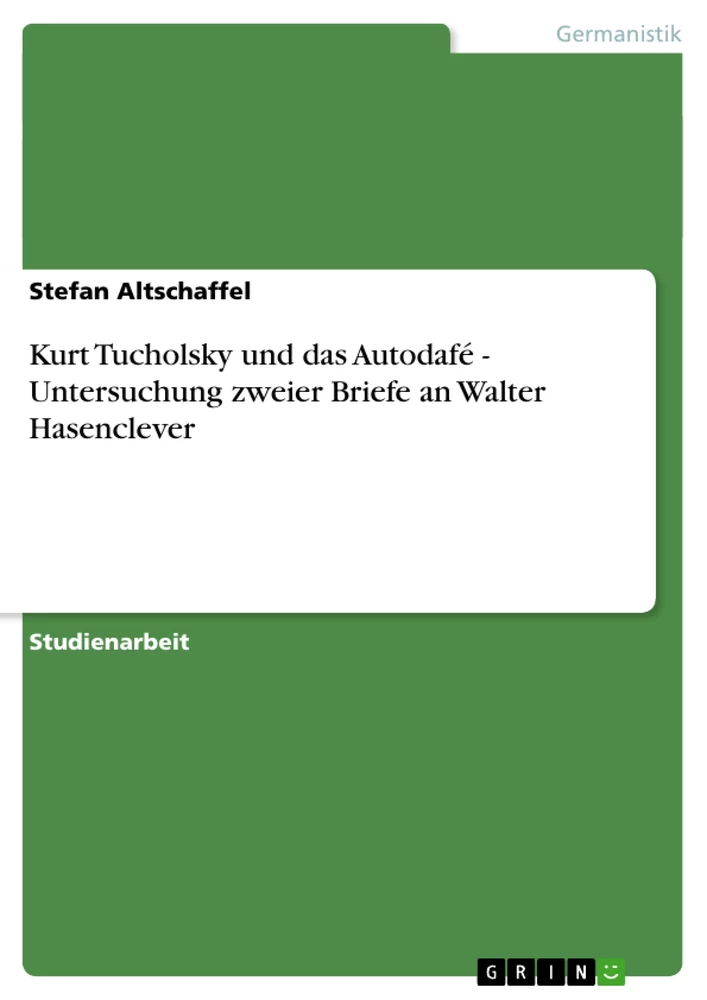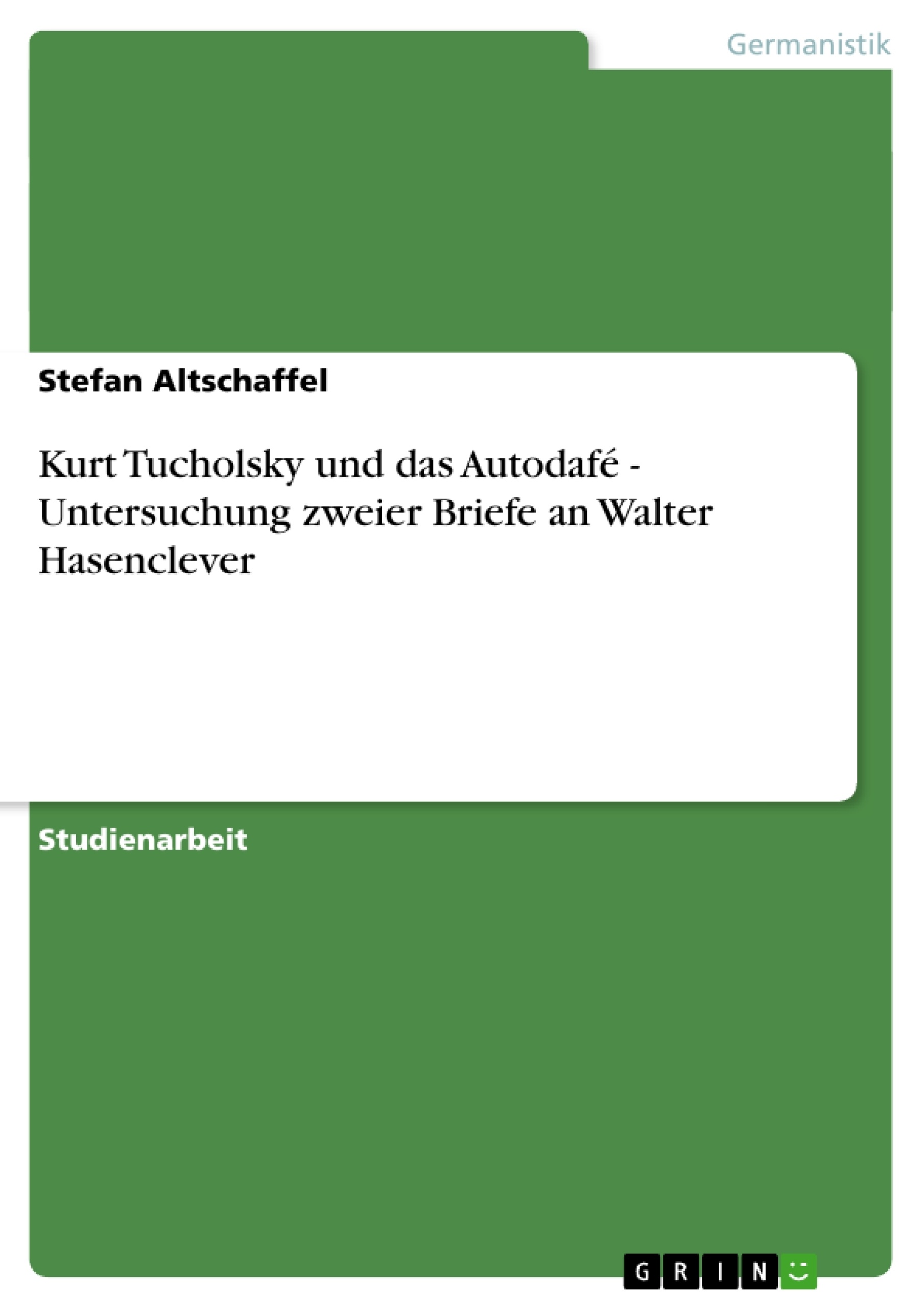„Unsere Bücher sind also verbrannt. Im Buchhändlerbörsenblatt ist eine große Proscriptionsliste für in vierzehn Tagen angekündigt. Dieser Tage stand an der Spitze des Blattes im Fettdruck:: ‚Folgende Schriftsteller sind dem deutschen Interesse abträglich. Der Vorstand erwartet, daß kein deutscher Buchhändler ihre Werke verkauft. Nämlich: Feuchtwanger – Glaeser – Holitscher – Kerr – Kisch – Ludwig – Heinrich Mann – Ottwalt – Plivier – Remarque – Ihr getreuer Edgar – und Arnold Zweig.’ In Frankfurt haben sie unsere Bücher auf einem Ochsenkarren zum Richtplatz geschleift. Wie ein Trachtenverein von Oberlehrern.“
Kurt Tucholsky schilderte diese Vorgänge am 17. Mai 1933 in einem Brief an seinen Freund Walter Hasenclever. Seine Position und seine Gedanken zum Autodafé und zur Situation im faschistischen Deutschland äußert Tucholsky sich in seinen bis heute überlieferten Briefen lediglich zweimal. Es handelt sich dabei jeweils um einen Brief an Walter Hasenclever, von denen der eine kurz vor, der andere kurz nach der Bücherverbrennung verfasst wurde.
Für die Bearbeitung der Korrespondenz zwischen Tucholsky und Hasenclever im Rahmen einer Hausarbeit steht leider kaum Sekundärliteratur zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Einschätzung des Stellenwertes des Autodafé durch Tucholsky. Dazu soll zunächst eine Einordnung der Vorgänge in den biografischen Kontext vorgenommen, also der Werdegang Tucholskys und seine persönliche Situation im Jahr 1933 beleuchtet werden. Der primäre Aspekt dieser Arbeit soll eine Analyse der Korrespondenz Tucholskys mit Walter Hasenclever sein. Ziel der Arbeit ist es, Überlegungen zu Tucholskys Aussagen bezüglich der Bücherverbrennung anzustellen und zu analysieren, welche Bedeutung letztere und die begleitenden Umstände in Deutschland auf den Autor gehabt haben mögen. Es soll jedoch hierbei nicht nach Gründen geforscht werden, deretwegen Tucholskys Werke den Flammen übergeben wurden, ebenso wenig wie der Aspekt des Freitods und eventuelle Ursachen dafür.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biografische Daten zu Kurt Tucholsky
- Die Freundschaft zu Walter Hasenclever
- Tucholsky im Jahre 1933
- Analyse der Briefe vom 07. Mai bzw. 17. Mai 1933
- Überlieferung
- Zum Akt der Bücherverbrennung
- Zu den Konsequenzen des Autodafés und des Verbots regimefeindlicher Autoren
- Zu seiner Rolle als Emigrant
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Kurt Tucholskys Reaktion auf die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933, basierend auf zwei Briefen an Walter Hasenclever. Ziel ist es, Tucholskys Einschätzung des Autodafés und die Bedeutung der Ereignisse für ihn zu untersuchen. Der biografische Kontext von Tucholsky im Jahr 1933 wird ebenfalls beleuchtet.
- Tucholskys Reaktion auf die Bücherverbrennung
- Die Freundschaft zwischen Tucholsky und Hasenclever
- Tucholskys Leben und politische Haltung im Jahr 1933
- Analyse der Briefe als Quellen
- Der Stellenwert des Autodafés im Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Tucholskys Bewertung der Bücherverbrennung vor und skizziert die Methodik der Arbeit. Sie basiert auf zwei Briefen Tucholskys an Hasenclever und berücksichtigt den biografischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Analyse der Briefe und der Bedeutung der Bücherverbrennung für Tucholsky, wobei Fragen nach den Gründen für das Verbot seiner Werke und sein Freitod außen vor bleiben.
Biografische Daten zu Kurt Tucholsky: Dieses Kapitel liefert einen knappen Überblick über Tucholskys Leben, von seiner Geburt bis zu seinem Tod 1935. Es werden wichtige Stationen seines Lebens, seine Ausbildung, seine berufliche Tätigkeit als Journalist und Schriftsteller sowie seine politischen Ansichten und seine Emigration nach Schweden im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machtergreifung dargestellt. Diese biografischen Daten bilden den Kontext für das Verständnis seiner Reaktion auf die Bücherverbrennung.
Die Freundschaft zu Walter Hasenclever: Dieser Abschnitt beschreibt die Beziehung zwischen Tucholsky und Hasenclever, die auf einer gemeinsamen journalistischen und literarischen Tätigkeit sowie gegenseitigem Vertrauen basierte. Die enge Freundschaft wird als wichtiger Kontext für die Analyse der Briefe hervorgehoben, da diese Einblicke in Tucholskys persönliche Gedanken und Emotionen bieten.
Tucholsky im Jahre 1933: Das Kapitel schildert Tucholskys Situation im Jahr 1933, dem Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung. Es beschreibt seine ablehnende Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus und die unmittelbare Reaktion auf die Bücherverbrennung. Der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft und die zunehmende Bedrohung seiner Existenz durch das NS-Regime werden hier thematisiert, was seine späteren Handlungen und Äußerungen mitbeeinflusst.
Analyse der Briefe vom 07. Mai bzw. 17. Mai 1933: Dieser Abschnitt analysiert die beiden Briefe Tucholskys an Hasenclever, die vor und nach der Bücherverbrennung geschrieben wurden. Die Briefe werden als zentrale Quellen für die Untersuchung seiner Reaktion auf die Ereignisse interpretiert. Es wird die Überlieferung der Briefe beleuchtet, die Darstellung der Bücherverbrennung selbst, die Konsequenzen des Autodafés und das Verbot regimekritischer Autoren sowie Tucholskys Rolle als Emigrant. Die Analyse konzentriert sich auf die Aussagen in den Briefen und deren Bedeutung im Kontext der Gesamtlage.
Schlüsselwörter
Kurt Tucholsky, Bücherverbrennung, 10. Mai 1933, Walter Hasenclever, Nationalsozialismus, Exil, Briefanalyse, Autodafé, regimekritische Literatur, politische Repression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Kurt Tucholskys Reaktion auf die Bücherverbrennung 1933
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Kurt Tucholskys Reaktion auf die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 anhand zweier Briefe an Walter Hasenclever. Der Fokus liegt auf Tucholskys Einschätzung des Ereignisses und seiner Bedeutung für ihn, eingebettet in den biografischen Kontext des Jahres 1933.
Welche Quellen werden verwendet?
Die zentrale Quelle dieser Arbeit sind zwei Briefe von Kurt Tucholsky an Walter Hasenclever, die vor und nach der Bücherverbrennung geschrieben wurden. Diese Briefe bieten Einblicke in Tucholskys persönliche Gedanken und Emotionen zu diesem Ereignis.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Tucholskys Reaktion auf die Bücherverbrennung, die Freundschaft zwischen Tucholsky und Hasenclever, Tucholskys Leben und politische Haltung im Jahr 1933, die Analyse der Briefe als Quellen und den Stellenwert des Autodafés im Kontext des aufkommenden Nationalsozialismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Tucholskys Biografie, seiner Freundschaft mit Hasenclever, seiner Situation im Jahr 1933, eine detaillierte Analyse der beiden Briefe (inkl. Überlieferung, Darstellung der Bücherverbrennung, Konsequenzen und Tucholskys Rolle als Emigrant) und abschließende Schlussfolgerungen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie Kurt Tucholsky die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 bewertet hat und welche Bedeutung dieses Ereignis für ihn hatte.
Welche Aspekte werden *nicht* im Detail behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Briefe und die unmittelbare Reaktion Tucholskys auf die Bücherverbrennung. Fragen nach den Gründen für das Verbot seiner Werke und sein Freitod bleiben außen vor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kurt Tucholsky, Bücherverbrennung, 10. Mai 1933, Walter Hasenclever, Nationalsozialismus, Exil, Briefanalyse, Autodafé, regimekritische Literatur, politische Repression.
Welche Informationen bietet das Kapitel zur Biografie Tucholskys?
Das Kapitel gibt einen knappen Überblick über Tucholskys Leben, von seiner Geburt bis zu seinem Tod 1935. Es werden wichtige Stationen seines Lebens, seine Ausbildung, seine berufliche Tätigkeit, seine politischen Ansichten und seine Emigration nach Schweden im Kontext der nationalsozialistischen Machtergreifung dargestellt.
Welche Rolle spielt die Freundschaft zwischen Tucholsky und Hasenclever?
Die enge Freundschaft zwischen Tucholsky und Hasenclever wird als wichtiger Kontext für die Analyse der Briefe hervorgehoben, da sie Einblicke in Tucholskys persönliche Gedanken und Emotionen bietet. Die gemeinsame journalistische und literarische Tätigkeit und das gegenseitige Vertrauen werden beschrieben.
Wie wird die Analyse der Briefe durchgeführt?
Die Analyse der Briefe konzentriert sich auf die Aussagen in den Briefen und deren Bedeutung im Kontext der Gesamtlage. Untersucht werden die Überlieferung der Briefe, die Darstellung der Bücherverbrennung selbst, die Konsequenzen des Autodafés und des Verbots regimekritischer Autoren sowie Tucholskys Rolle als Emigrant.
- Citation du texte
- Stefan Altschaffel (Auteur), 2004, Kurt Tucholsky und das Autodafé - Untersuchung zweier Briefe an Walter Hasenclever, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46993