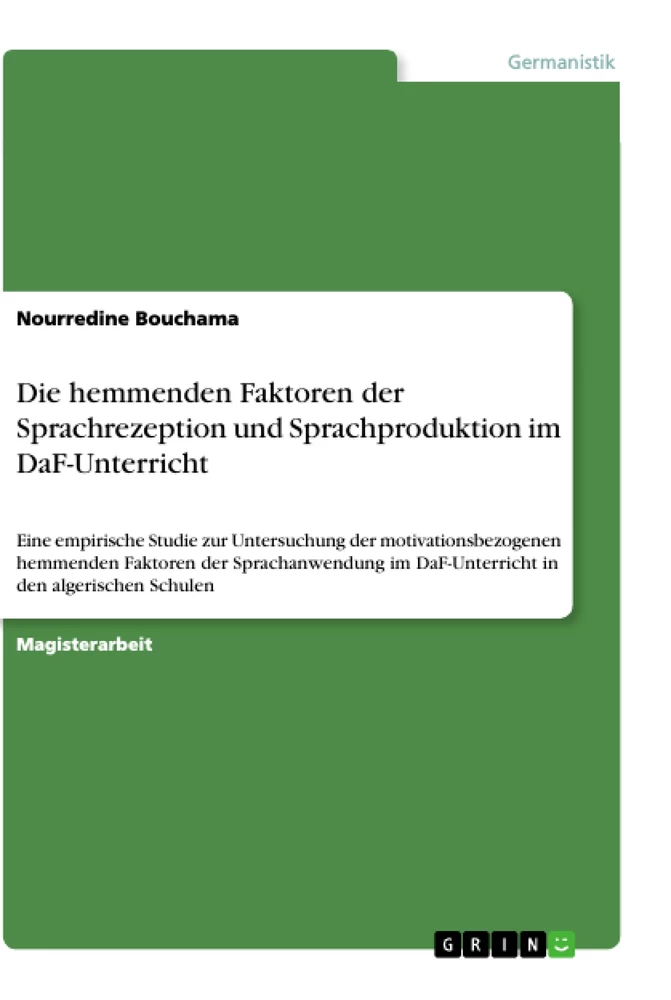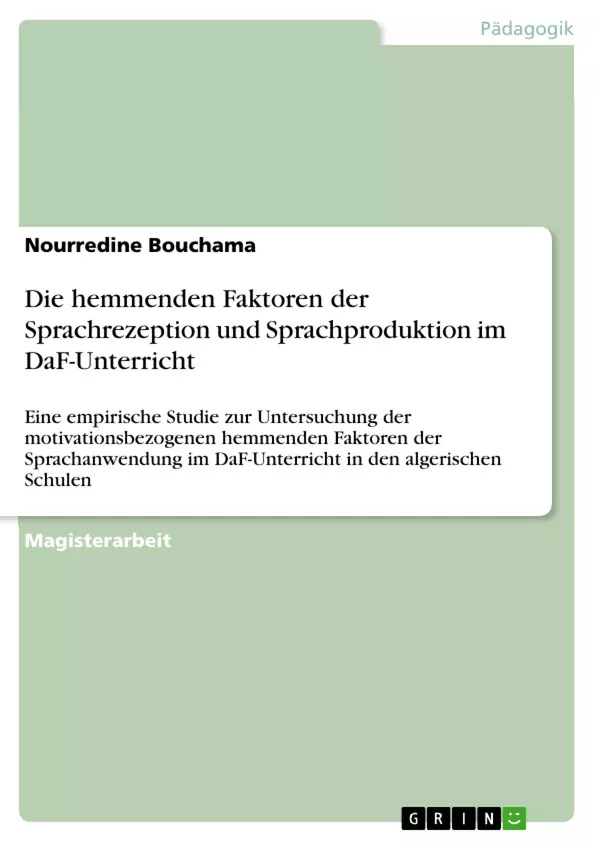In dieser Forschungsarbeit werden die hemmenden Faktoren der Sprachrezeption und Sprachproduktion beim Lernenden im DaF-Unterricht untersucht. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Rolle und die Bedeutung der Motivation als individueller Faktor für den Fremdsprachenlernprozess und Fremdsprachenlernerfolg im DaF-Unterricht und deren Hemmungsmöglichkeiten durch unterrichtliche Faktoren. Dabei wird auch der Zusammenhang zwischen Motivation einerseits, Interessen und Motiven des Lernenden andererseits als wichtiger Faktor für Fremdsprachenlernerfolg fokussiert. Die Motivation lässt sich wiederum von verschiedenen Faktoren beeinflussen. Die Entstehung, Schwäche und Stärke der Motivation lassen sich unter anderem von der Lernsituation also von der Unterrichtsmethode und der Herangehensweise wie man den Kurs gestaltet und ob man im Unterricht die Interessen und Motive der Lernenden durch Kursaktivitäten anspricht, sodass die Konzentration und die Ansatzbereitschaft bei dem Lernenden abgerufen werden, stark manipulieren. Daher ist es relevant und von großer Bedeutung, dass man auf die Unterrichtsgestaltung und deren Prinzipien im DaF-Unterricht eingeht und deren Einfluss auf individuelle Faktoren am Beispiel von Motivation der Lernenden und Sprechangst überprüft.
Der Anlass für diese Forschungsarbeit rührt aus beabsichtigten Beobachtungen und Bemerkungen, die ich in der Schulpraxis gemacht habe. Ich habe zuerst im Allgemeinen gemerkt, dass Motivation der Schüler von den Unterrichtsfaktoren stark beeinflusst werden kann. Ich bin in der Praxis darauf gekommen, als ich zum ersten Mal im Jahr 2003, den DaF- Studenten an der Universität Algier, die Wahl gegeben habe, selbst und freiwillig die Lerninhalte auszusuchen, und sich selbst in Gruppen zu teilen, nachdem sie selbst für diese Sozialform "Gruppenarbeit" entschieden haben. Am Ende haben wir jedes einzelne von den Gruppen bearbeitete Thema zusammen besprochen. Ich habe gemerkt, dass alle Studenten - auch die, die meistens wenig im Unterricht aktiv waren - sehr motiviert am Unterricht teilnahmen und tüchtig in der Gruppe zusammenarbeiteten. Gleichzeitig habe ich anhand eigener Erfahrungen und Beobachtungen feststellen können, dass die DaF-Lernenden im Unterricht vorwiegend Schwierigkeiten haben, Deutsch anzuwenden. Meistens kommen Deutschlernende am Ende deren Ausbildung mit mehr oder weniger großer Menge an Informationen über die Fremdsprache Deutsch (Grammatik, Linguistik, Wortschatz).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Forschungsstand der individuellen Faktoren des Lerners im Fremdsprachenunterricht
- 2 Theoretische Hintergrundkenntnisse: Lernen in einflussreichen Lerntheorien
- 2.1 Lernen in der behavioristischen Lerntheorie
- 2.1.1 Rolle des Lehrers
- 2.1.2 Lernprozess
- 2.1.3 Kritik
- 2.2 Lernen in der kognitivistischen Lerntheorie
- 2.2.1 Rolle des Lehrers
- 2.2.2 Lernprozess
- 2.2.3 Kritik
- 2.3 Lernen in der konstruktivistischen Lerntheorie
- 2.3.1 Zum Begriff Konstruktion
- 2.3.2 Interdisziplinarität als neues Forschungsfundament
- 2.3.3 Grundannahmen und Prinzipien des Konstruktivismus
- 2.3.4 Lernprozess
- 2.3.4.1 Authentizität des Lernens
- 2.3.4.2 Erläuterung des Begriffs Viabilität
- 2.3.4.3 Erläuterung des Begriffs Konsensualität
- 2.3.5 Rolle des Lehrers
- 2.3.6 Kritik
- 2.4 Lerntheorien im Vergleich
- 3 Fremdsprachenlernen: neue Wege
- 3.1 Fremdsprachenlernen oder Fremdsprachenerwerben
- 3.2 Lernersprache ist lernerautonom
- 3.3 Ganzheitliches und lernerautonomes Fremdsprachenlernen
- 3.3.1 Lernerautonomie im Fremdsprachenlernen
- 3.3.2 Autonomie und Ganzheitlichkeit des Fremdsprachenlerners
- 3.3.3 Lernerautonomie und ganzheitliche Fremdsprachenunterrichtsaktivitäten
- 3.3.4 Ganzheitlichkeit der Fremdsprachenforschung
- 3.4 Kognition und Affektion: dichotomisch oder komplementär?
- 4 Motivation als individueller Faktor beim Fremdsprachenlernen
- 4.1 Zur Begriffsbestimmung der Motivation
- 4.2 Motivation und Motive
- 4.2.1 Allgemeine Motive
- 4.2.2 Entstehung der Motivation
- 4.2.3 Motivation und Motive in Fremdsprachenforschung
- 4.2.4 Relevante Motive für das Fremdsprachenlernen
- 4.3 Motivationsarten
- 4.3.1 Instrumentelle und integrative Motivation
- 4.3.2 Intrinsische und extrinsische Motivation
- 4.4 Zur Rolle der Motivation im Fremdsprachenlernen
- 4.4.1 Motivation und Lernerfolg
- 4.4.1.1 Kausal- und Resultativhypothese
- 4.4.1.2 Internale und externale Lokation
- 4.4.2 Motivation und Lernerautonomie
- 4.5 Motivationsförderung im Fremdsprachenunterricht
- 4.5.1 Motivierungstechniken des Fremdsprachenlernenden
- 4.5.2 Förderung der intrinsischen und extrinsischen Motivation
- 4.6 Einfluss der Motivationsänderung auf das Fremdsprachenlernen
- 4.6.1 Amotivationsmöglichkeiten im Unterricht
- 4.6.2 Demotivationsmöglichkeiten im Unterricht
- 4.6.3 Einfluss von Selbstkonzept auf Motivation im Unterricht
- 5 Motivation und Sprechangst
- 5.1 Angst als erweiterte Stressreaktion
- 5.2 Sprechangst
- 5.3 Angst und Ängstlichkeit
- 5.4 Faktor Angst in der Fremdsprachenforschung
- Die Rolle der Motivation im Fremdsprachenlernen
- Motivationsfaktoren, die die Sprachanwendung im DaF-Unterricht beeinflussen
- Die Auswirkungen von Sprechangst auf den Spracherwerb
- Hemmende Faktoren der Sprachrezeption und Sprachproduktion im DaF-Unterricht
- Die Untersuchung motivationsbezogener hemmender Faktoren der Sprachanwendung im DaF-Unterricht in algerischen Schulen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit den hemmenden Faktoren der Sprachrezeption und Sprachproduktion im DaF-Unterricht. Sie untersucht, welche motivationsbezogenen Faktoren die Sprachanwendung im DaF-Unterricht in algerischen Schulen behindern. Die Arbeit analysiert die Rolle der Motivation im Fremdsprachenlernen und untersucht den Einfluss von Sprechangst auf die Sprachanwendung im Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik und beleuchtet den Forschungsstand der individuellen Faktoren des Lerners im Fremdsprachenunterricht. Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Lernens, wobei die behavioristische, kognitivistische und konstruktivistische Lerntheorie im Detail vorgestellt werden. Kapitel 3 behandelt das Fremdsprachenlernen und stellt verschiedene Ansätze vor, wie etwa das Konzept des lernerautonomen und ganzheitlichen Fremdsprachenlernens. Im vierten Kapitel wird die Motivation als ein bedeutender individueller Faktor im Fremdsprachenlernen untersucht, wobei verschiedene Motivationsarten und ihre Auswirkungen auf den Lernerfolg analysiert werden. Kapitel 5 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Motivation und Sprechangst und untersucht den Einfluss von Angst auf die Sprachanwendung im DaF-Unterricht.
Schlüsselwörter
DaF-Unterricht, Sprachrezeption, Sprachproduktion, Motivation, Sprechangst, Lernerautonomie, Fremdsprachenlernen, Lerntheorien, behavioristische Lerntheorie, kognitivistische Lerntheorie, konstruktivistische Lerntheorie, individuelle Faktoren, hemmender Faktor, Sprachanwendung, algerische Schulen.
- Arbeit zitieren
- Nourredine Bouchama (Autor:in), 2013, Die hemmenden Faktoren der Sprachrezeption und Sprachproduktion im DaF-Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469984