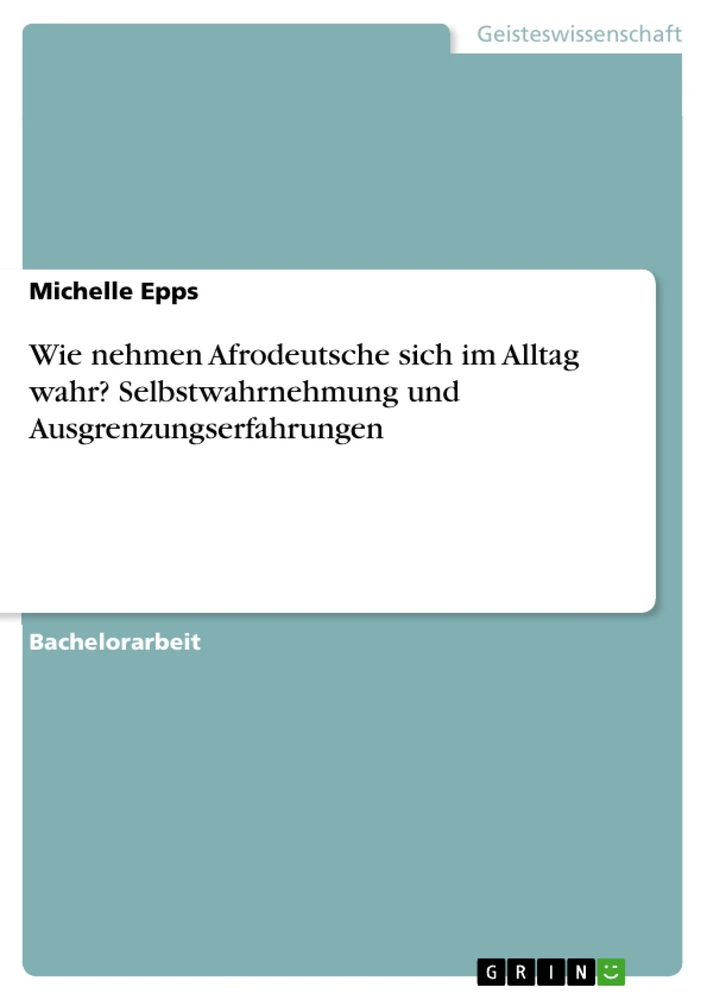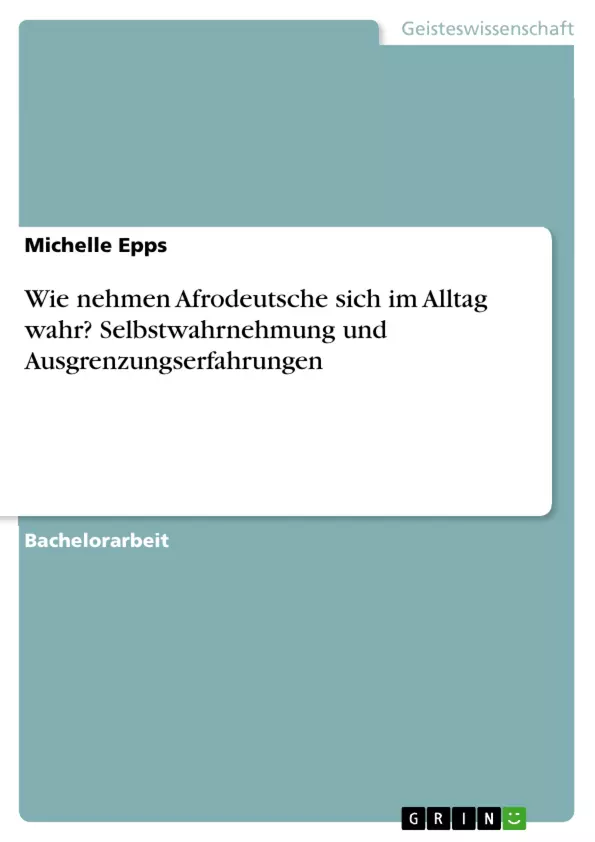Können sich Afrodeutsche selbst hinsichtlich ihrer Erfahrungen als anerkannt betrachten? Dazu wurden insgesamt fünf Afrodeutsche nach ihren Lebenserfahrungen und ihrer Meinung bezüglich der eigenen Anerkennung in Deutschland befragt.
Zunächst wird auf die Herkunft und Beweggründe der Nutzung des Begriffs Afrodeutsch eingegangen. Im Anschluss wird das methodische Vorgehen beschrieben, das die Grundlage dieser fünf Interviews darstellt. Dort wird ausführlich dargelegt, weshalb eine möglichst offene Interviewmethode wichtig ist, um ein unverfälschtes Meinungsbild der Befragten einzufangen.
Angelehnt an das Konzept der Anerkennung nach Axel Honneth wird dann geschaut, welche dieser Erfahrungen im Alltag dazu führen, dass sie sich nicht als gleichberechtigte Deutsche betrachten können. Im Laufe dieses Prozesses bilden sich Kategorien heraus, die im Zusammenhang mit der Erfahrung der Exklusion stehen, sowie über die Einschätzung ihrer eigenen gesellschaftlichen Stellung.
Die für diese Arbeit Befragten Afrodeutschen sind noch in einem durch Isolation geprägten weißen Umfeld aufgewachsen und manche sogar zeitweise in nahezu vollständiger Abwesenheit anderer Schwarzer Menschen. Es zeigte sich, dass sie sich nicht als strategisch essentialisierte Gruppe betrachten und aktuell auch nicht den Wunsch verspüren, eine aktive Identitätspolitik zu betreiben. Ihnen geht es eher um die individuelle Anerkennung als Deutsche Person, nicht aber explizit als Schwarze Person. Sie sehen sich bereits weitgehend von der Gesellschaft akzeptiert und möchten Ungerechtigkeiten durch die Demonstration von Gleichheit begegnen und nicht durch neue differentielle Kategorien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Theoretische Grundlagen.
- 2.1 Afrodeutsche/Schwarze Deutsche.
- 2.1.1 Ursprung.
- 2.1.2 Eingrenzung des Begriffs
- 2.2 Wie die reziproke Dynamik von Anerkennungsbeziehungen zu einem besseren Verständnis\nder Erlebniswelt Afrodeutscher beitragen kann...
- 2.2.1 Zur Theorie.
- 3. Methodisches Vorgehen...........
- 3.1 Teilnarrative (biographische) Interviews.....
- 3.1.1 Sampling und Durchführung..\n
- 4. Die Erfahrung der Divergenz in der Verortung als „,Deutsch“.
- 4.1 Wenn das Deutschsein ausgeklammert wird.
- 4.1.1 Die Frage nach der Herkunft.....
- 4.1.2 Ausschluss aus der „Deutschen Norm\"- Nicht typisch Deutsch!..\n
- 4.2 Die Erfahrung des Othering...\n
- 4.2.1 Gleichsetzung mit Fremden und Vorurteile..........\n
- 4.2.2 Rassistische Beleidigungen und Mobbing.....\n
- 4.2.3 Ein Mangel an Solidarität..\n
- 4.3 Selbstverortung als „,Deutsch\"/ Deutsche Zugehörigkeit.
- 4.3.1 Selbstverortung als Teil der Mehrheitsgesellschaft ..\n
- 4.3.2 Ablehnung von politisch-aktivistischen Kategorisierungen .....\n
- 4.3.3 Die Bewertung der eigenen gesellschaftlichen Position und der Umgang mit fehlender\nAnerkennung..\n
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Anerkennung von Afrodeutschen in Deutschland. Im Mittelpunkt steht die alltägliche Erfahrung von Ausgrenzung und die damit verbundene Frage nach der eigenen Zugehörigkeit zu einem deutschen Kollektiv.
- Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe
- Die Erfahrung des „Othering“ und die Konstruktion von Fremdheit
- Die Frage nach der individuellen Selbstverortung und dem Umgang mit der eigenen Zugehörigkeit
- Das Konzept der Anerkennung und die Bedeutung von Inklusion und Exklusion
- Die Rolle von politischer Identitätspolitik und die Bedeutung von individueller Anerkennung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die anhand eines aktuellen Beispiels von rassistischer Hetze gegen einen Afrodeutschen die Problematik der mangelnden Anerkennung von Afrodeutschen in Deutschland beleuchtet.
Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden die Begriffe Afrodeutsche/Schwarze Deutsche definiert, die reziproke Dynamik von Anerkennungsbeziehungen erläutert und das Konzept der Überexklusivität vorgestellt.
Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es wird die Verwendung von Teilnarrativen (biographischen Interviews) erläutert und das Sampling sowie die Durchführung der Interviews beschrieben.
Kapitel 4 analysiert die Erfahrungen von Afrodeutschen mit der Verortung als „Deutsch“. Es werden die Erfahrungen des Ausklammerns des Deutschseins, der Gleichsetzung mit Fremden, rassistischer Beleidigungen und Mobbings, sowie die Erfahrung des Mangels an Solidarität beleuchtet.
Kapitel 5 beinhaltet die Zusammenfassung und das Fazit der Arbeit. Dieses Kapitel wird in der Vorschau nicht berücksichtigt, um keine wichtigen Schlussfolgerungen vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Inklusion und Exklusion, Rassismus und Diskriminierung, Anerkennung und Zugehörigkeit, sowie die Lebenserfahrungen von Afrodeutschen in Deutschland. Wichtige Begriffe sind: Afrodeutsche, Schwarze Deutsche, Überexklusivität, Othering, Selbstverortung, Identitätspolitik, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit.
- Quote paper
- Michelle Epps (Author), 2018, Wie nehmen Afrodeutsche sich im Alltag wahr? Selbstwahrnehmung und Ausgrenzungserfahrungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470031