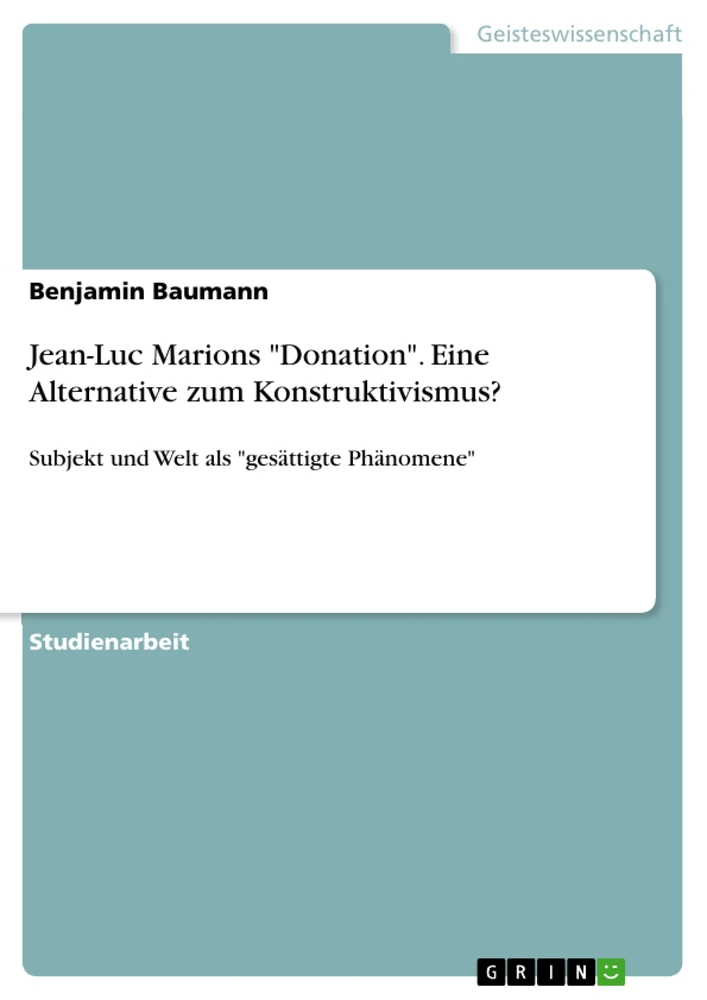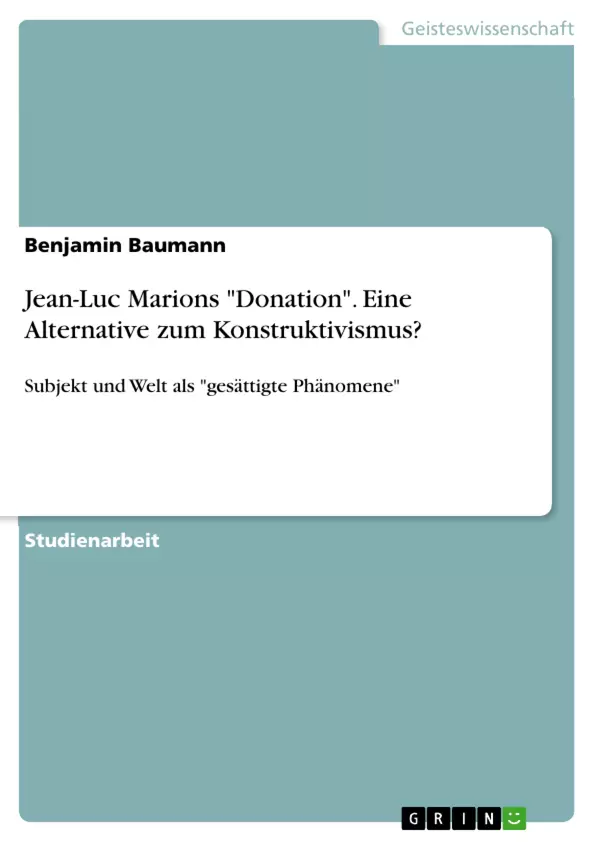Diese Arbeit beleuchtet das methodische Donationsdenken Marions und die Subjektivität sowie die Welt als gesättigtes Phänomen.
"Die Philosophie, verstanden als Metaphysik, geht ihrer Verwirklichung entgegen, indem sie, von Descartes bis Hegel, nicht aufhört, die Implikationen des Prinzips des zureichenden Grundes zu radikalisieren: Alles, was ist (Seiendes), ist in dem Maße, in dem eine causa (Wirkursächlichkeit) sive ratio (Begriff) seine Existenz, seine Inexistenz oder den Dispens jeder Ursache erklärt." (J.L. Marion)
Die Schwierigkeit dieser Kausalitätsgläubigkeit liegt im Erreichen eines letzten Grundes, dem keine weitere Ursache mehr zugeordnet werden und an dessen Legitimität man daher leicht zweifeln kann. Der Zweifel am ersten Grund muss sich notwendig auf jedes von diesem logisch abgeleitete Glied ausdehnen, so dass schließlich alles bezweifelt werden kann. Die bekannte Lösung Descartes’ liegt in der unbezweifelbaren Selbstaffektion des Subjekts.
Dabei bleibt erstens offen, woraus das Ich, das sich vorfindet qualitativ besteht. Zweitens baut sich ein solipsistischer Erkenntniskreis auf, aus dem das Subjekt logisch nicht auszubrechen vermag. Zu Recht stellt daher Marion die Frage: "Wie von der gesicherten Sache (res cogitans) zu einer anderen, unzugänglichen oder fast unzugänglichen Sache […] gelangen?"
Inhaltsverzeichnis
- Prolog: Husserl und Heidegger als historischer Vorwurf des marionschen Entwurfs
- Einführung in das methodische Donationsdenken Marions
- Die Faltung der donation: Gabe, Gebung, Gegebenheitscharakter, Gegebenheit
- Die Ent-Faltung der Gegebenheit: Zur Einführung der reduktiven Gegenmethode
- Das währende Gabeereignis der Subjektivität und die Welt als gesättigtes Phänomen
- Gesättigte Phänomene
- Die Dativstruktur des Subjekts
- Sich selbst empfangen – Leiblichkeit als erster Dativ
- Die Gegebenheit als Ereignis der Selbstwerdung
- Subjektivität als währendes Ereignis. Zur Sättigung der Welt
- Fazit: phénomène advenant. Zur Rehabilitierung der Unmöglichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die philosophische Konzeption von Jean-Luc Marion, insbesondere die Rolle der „Donation“ in seiner Kritik am Konstruktivismus. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Marions Ansatz zu analysieren und seine Kritik an Husserl und Heidegger zu beleuchten. Dabei soll die Bedeutung der „Donation“ als eine Alternative zu transzendentalen und existenzialen Reduktionen aufgezeigt werden.
- Die Kritik am Konstruktivismus
- Die Rolle der „Donation“ in Marions Philosophie
- Die Gegenmethode und ihre Relevanz
- Die Konzeption von Subjektivität und Welt
- Die Rehabilitierung der Unmöglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Prolog führt den Leser in die Ausgangssituation ein und präsentiert Husserl und Heidegger als historische Bezugspunkte für Marions Werk. Er beleuchtet die Kritik an der traditionellen Metaphysik und die Suche nach einer neuen Begründung für die Gegebenheit der Welt.
- Das zweite Kapitel stellt Marions methodisches Donationsdenken vor. Die Faltung der „Donation“ umfasst die Gabe, die Gebung, den Gegebenheitscharakter und die Gegebenheit. Der Autor erläutert die Bedeutung der Gegebenheit für die Phänomenologie und zeigt die Grenzen der transzendentalen und existenzialen Reduktionen auf.
- Kapitel 3 widmet sich dem währenden Gabeereignis der Subjektivität und der Welt als gesättigtem Phänomen. Es werden die Konzepte der „gesättigten Phänomene“ und der „Dativstruktur des Subjekts“ behandelt. Der Autor erklärt, wie das Subjekt sich selbst empfängt und die Welt als ein Ereignis der Selbstwerdung erfährt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind „Donation“, „Gegebenheit“, „Gegenmethode“, „Subjektivität“, „Welt“, „Gesättigte Phänomene“, „Husserl“, „Heidegger“, „Konstruktivismus“, „Phänomenologie“ und „Transzendentalität“. Die Arbeit befasst sich mit philosophischen Konzepten, die die Beziehung zwischen Subjekt und Welt neu definieren und die Grenzen des traditionellen Denkens überschreiten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Jean-Luc Marion unter dem Begriff "Donation"?
Donation bezeichnet die radikale Gegebenheit von Phänomenen, die nicht vom Subjekt konstruiert werden, sondern sich von sich aus schenken (Gabe) und zeigen.
Wie kritisiert Marion den Konstruktivismus?
Marion wendet sich gegen die Vorstellung, dass das Subjekt die Welt allein durch seinen Verstand konstituiert. Er betont stattdessen, dass die Gegebenheit der Welt dem Denken vorausgeht.
Was ist ein "gesättigtes Phänomen"?
Ein gesättigtes Phänomen ist ein Ereignis, das die Kapazität des menschlichen Begriffsvermögens übersteigt, wie etwa die Liebe, das Kunstwerk oder das religiöse Erleben.
Was bedeutet die "Dativstruktur des Subjekts"?
Das Subjekt ist nach Marion kein autonomes "Ich denke", sondern ein "Mir-Gegebenes" (Dativ). Es empfängt sich selbst erst durch die Gegebenheit der Welt und anderer Phänomene.
Inwiefern baut Marion auf Husserl und Heidegger auf?
Marion nutzt deren phänomenologische Methoden, geht aber über sie hinaus, indem er die Gegebenheit von den Beschränkungen der transzendentalen Subjektivität (Husserl) oder der Seinsfrage (Heidegger) befreit.
- Citation du texte
- Benjamin Baumann (Auteur), 2013, Jean-Luc Marions "Donation". Eine Alternative zum Konstruktivismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470479