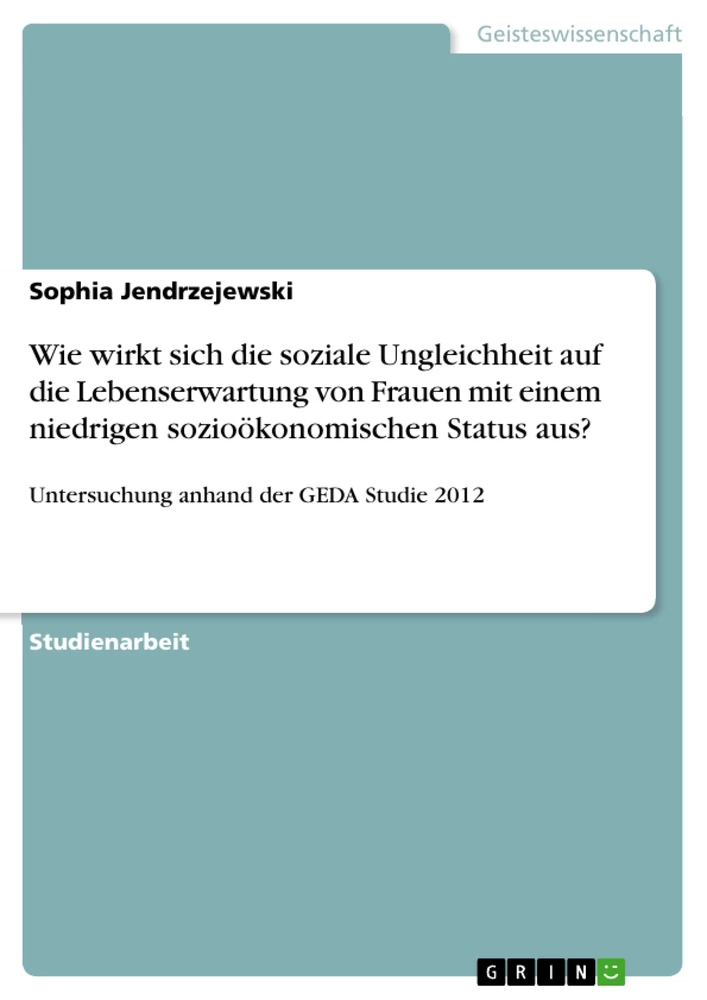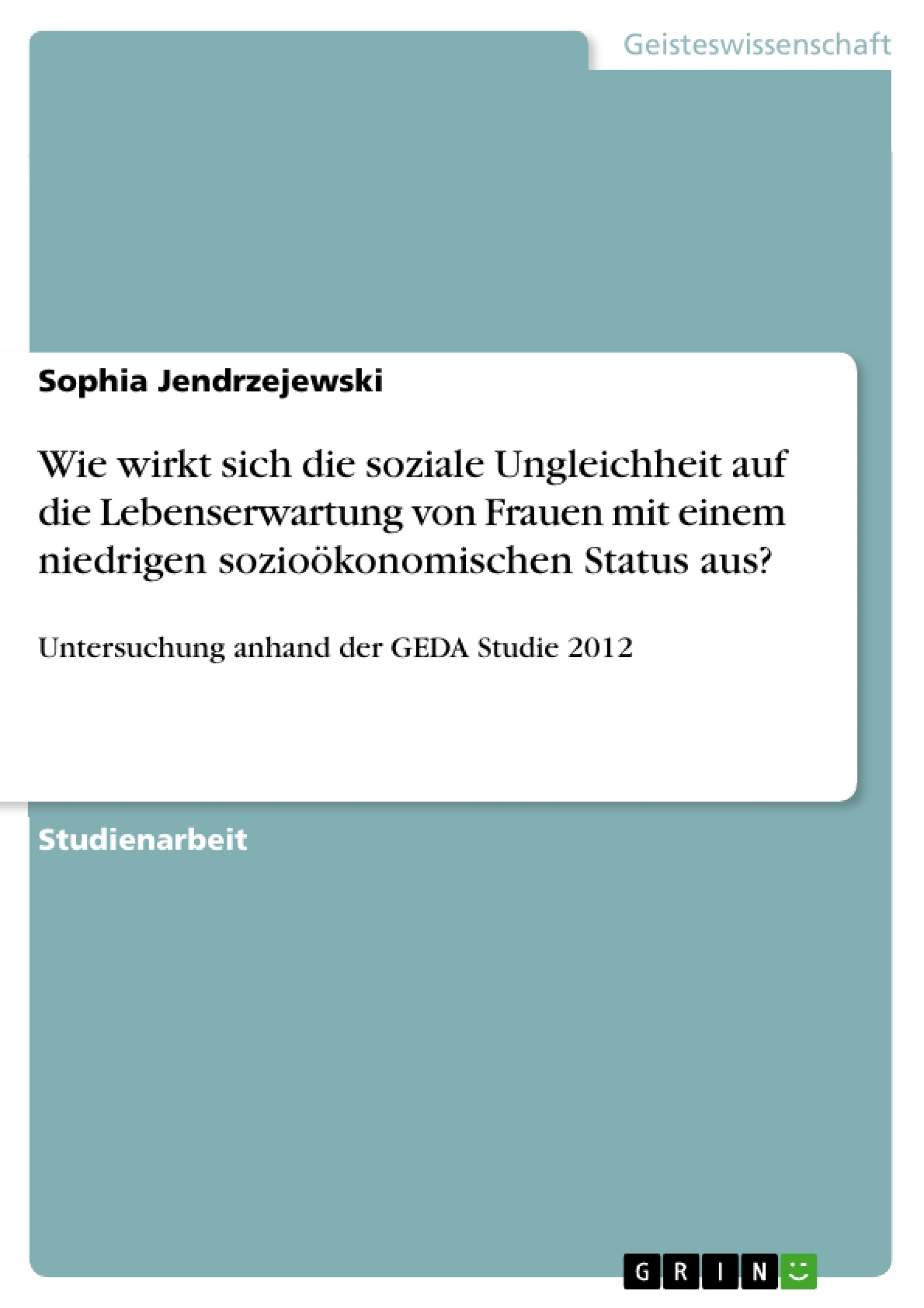Die Hausarbeit untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen Geschlecht, dem sozioökonomischen Status sowie der Gesundheit besteht. Bei der Analyse wurden die Daten der GEDA Studie 2012 genutzt.
Das Oberthema Gesundheit scheint in Bezug auf soziale Ungleichheit relevant, da viele Menschen Gesundheit als das wichtigste Gut in ihrem Leben wahrnehmen. Die Arbeit verbindet die beiden Ebenen der vertikalen und der horizontalen Ungleichheit, um eine spezifische Aussage über Frauen mit einem sozioökonomisch niedrigen Status zu treffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien zu dem Verhältnis gesunder Lebenserwartung und reeller Lebenserwartung
- 3. Forschungshintergrund
- 3.1 Definition soziale Ungleichheit
- 3.2 Forschungshintergrund Soziale Ungleichheit und gesunde Lebenserwartung in Deutschland
- 3.3 Forschungshintergrund Frauen und gesunde Lebenserwartung in Deutschland
- 4. Methode
- 4.1 Gesundheit in Deutschland aktuell 2012 (GEDA 2012)
- 4.2 GEDA Studie- Chronische Erkrankung
- 4.3 GEDA Studie- Gesundheitliche Einschränkung
- 4.4 GEDA Studie- Risikofaktoren
- 5. Diskussion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es zu erforschen, inwieweit sich soziale Ungleichheit auf die gesunde Lebenserwartung von Frauen mit einem sozioökonomisch niedrigen Status in Deutschland seit dem Jahr 2012 auswirkt.
- Soziale Ungleichheit und Gesundheit
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Lebenserwartung
- Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Gesundheit
- Die Rolle der GEDA Studie 2012 in der Untersuchung
- Die Bedeutung der gesunden Lebenserwartung im Kontext von sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theorien zu dem Verhältnis gesunder Lebenserwartung und reeller Lebenserwartung
- Kapitel 3: Forschungshintergrund
- Kapitel 4: Methode
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext von sozialer Ungleichheit und Gesundheit. Sie diskutiert die Auswahl der Indikatoren Geschlecht und sozialer Status und beleuchtet die Notwendigkeit, die Gesundheit von Frauen in der Forschung sichtbar zu machen.
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien, die das Verhältnis von gesunder Lebenserwartung und tatsächlicher Lebenserwartung beleuchten. Es analysiert Ansätze von Ernst Gruenberg, Lois M. Verbrugge und Jay Olshansky, Kenneth Manton und James F. Fries, die unterschiedliche Perspektiven auf die Einflussfaktoren der gesunden Lebenserwartung liefern.
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Forschungsstand zu sozialer Ungleichheit und gesunder Lebenserwartung in Deutschland. Es definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und analysiert die Forschungsergebnisse zu den Zusammenhängen von sozialem Status, Geschlecht und gesunder Lebenserwartung.
In diesem Kapitel wird die Methode der Arbeit erläutert, die auf der GEDA Studie 2012 basiert. Es werden die relevanten Daten und Variablen der Studie vorgestellt, die für die Untersuchung der Forschungsfrage genutzt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselwörter soziale Ungleichheit, gesunde Lebenserwartung, Geschlecht, sozioökonomischer Status, Frauen, GEDA Studie 2012, Deutschland. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit, wobei die gesunden Lebensjahre von Frauen mit niedrigem sozioökonomischen Status im Mittelpunkt stehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst soziale Ungleichheit die Gesundheit von Frauen?
Frauen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status weisen häufiger chronische Erkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen auf, was ihre gesunde Lebenserwartung mindert.
Was ist der Unterschied zwischen gesunder und reeller Lebenserwartung?
Die reelle Lebenserwartung gibt das Sterbealter an, während die gesunde Lebenserwartung die Jahre beschreibt, die ein Mensch ohne schwere Beeinträchtigungen lebt.
Welche Datenbasis nutzt diese Hausarbeit?
Die Untersuchung basiert auf den Daten der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell 2012“ (GEDA 2012).
Was versteht man unter vertikaler und horizontaler Ungleichheit?
Vertikale Ungleichheit bezieht sich auf den sozioökonomischen Status (Einkommen, Bildung), horizontale Ungleichheit auf Merkmale wie das Geschlecht.
Welche Risikofaktoren werden in der GEDA-Studie untersucht?
Untersucht werden Faktoren wie chronische Krankheiten, körperliche Einschränkungen und spezifische Lebensstil-Risiken.
Warum ist das Thema Gesundheit im Kontext sozialer Ungleichheit relevant?
Da Gesundheit als höchstes Gut wahrgenommen wird, zeigt die ungleiche Verteilung von Gesundheitschancen die tiefgreifenden Auswirkungen sozialer Schichtung.
- Quote paper
- Sophia Jendrzejewski (Author), 2018, Wie wirkt sich die soziale Ungleichheit auf die Lebenserwartung von Frauen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status aus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470482