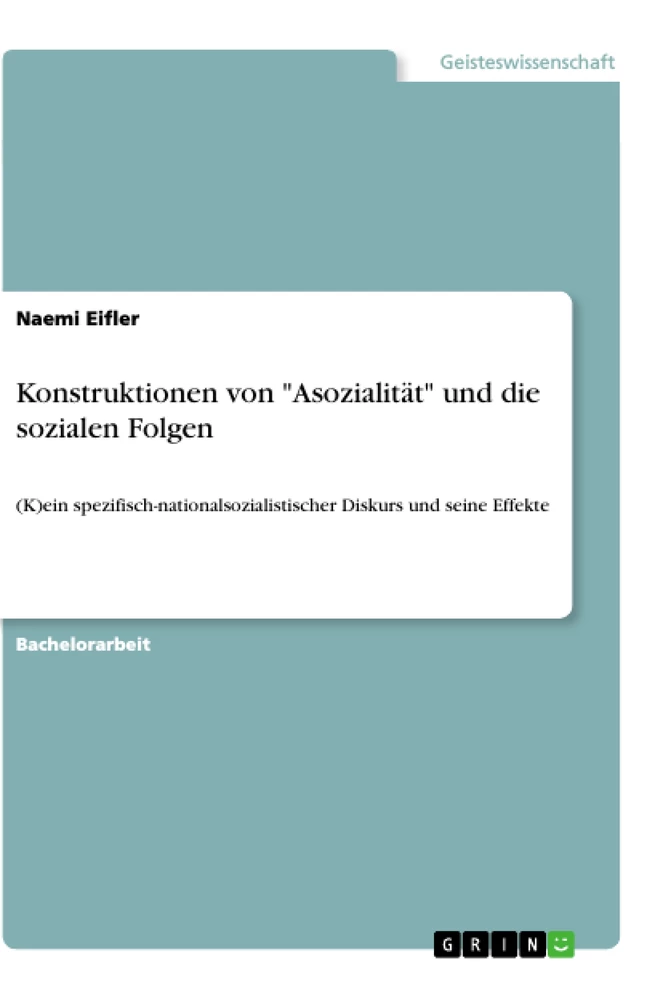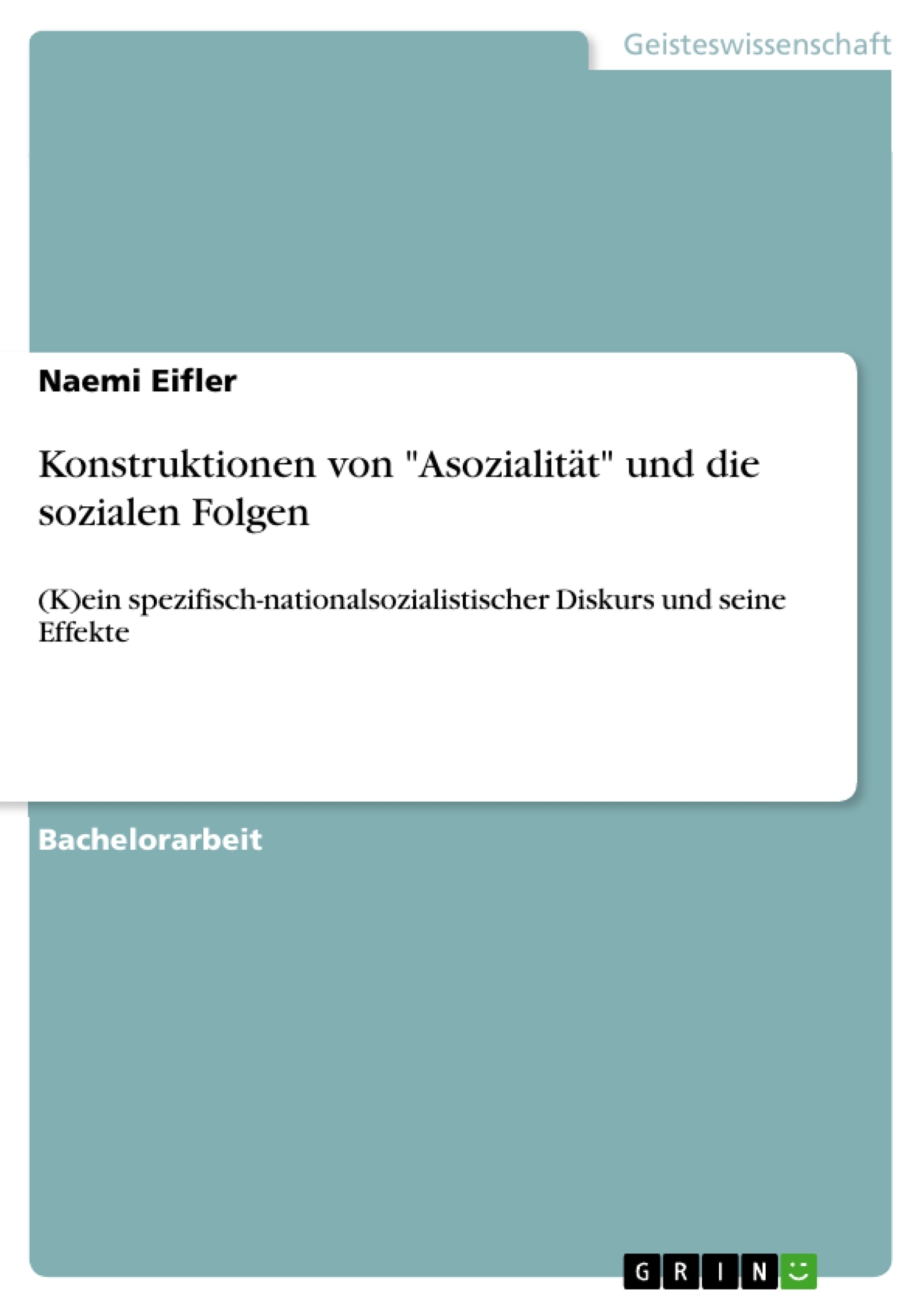In dieser Arbeit werden mit Fokus auf den Nationalsozialismus in Deutschland Herstellungsprozesse untersucht, die an der Konstruktion des Stigmatisierungs- und Verfolgungskonstrukts Asozialität beteiligt waren. Anhand quellengestützten geschichtswissenschaftlichen Forschungsmaterials werden Diskurse und Praktiken der Hierarchisierung, Etikettierung, und Klassifizierungen von Personen als ›asozial‹ untersucht und dargestellt.
Mit Blick auf das während der Weimarer Republik sich etablierende eugenische Denken erfolgt zunächst ein Einbettung in den wissenschaftlichen und sozialpolitischen Kontext vor 1933. Darüber hinaus erfolgt eine kurze Darstellung der Mitwirkung sozialarbeiterischen Denkens und Handelns. Letztlich erfolgen Hinweise auf nach 1945 festgestellter Kontinuitäten, die mit diesem Ungleichheitsparadigma in Zusammenhang gebracht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Gegenstand der Arbeit
- 1.3 Persönliche Motivation
- 1.4 Einbettung in den Forschungsstand
- 1.5 Aufbau der Arbeit
- 1.6 Theoretische Sensibilisierung
- 1.7 Formalien
- 1.8 Begriffsklärung >Asozial<, >Asozialität<
- 2 Einbettung in den historischen Kontext
- 2.1 Erb- und Rassenlehre und Eugenik als sozialpolitische Bewegung
- 2.2 Sozialpolitische Lage
- 2.3 Für den Nationalsozialismus relevante Rechts- und Gesetzeslage vor 1933
- 2.4 Diskussionen um ein Bewahrungsgesetz während der Weimarer Republik
- 2.5 Soziale Arbeit
- 2.6 Zwischenbilanz
- 3 Wirkung und Entwicklung des ›Asozialitäts<-Diskurses im Nationalsozialismus
- 3.1 Zur Produktion und Stellung von Wissenschaft im Nationalsozialismus
- 3.2 Die Be- und Neudeutung rechtswissenschaftlicher Theorien
- 3.3 Allgemein wirksame Rechtsgrundlagen im Nationalsozialismus
- 3.4 Eugenik und das konstruierte Verständnis von Gesundheit
- 3.5 Gesetzliche Grundlagen für Zwangsunterbringung und Haft
- 3.6 Kriminalbiologie als Bindeglied zwischen Eugenik und Justiz
- 3.7 Instrumente der Verfolgungspraxen
- 3.8 Klassifizierungen asozialisierter Personengruppen
- 3.9 (Mit)Wirkende Institutionen Sozialer Arbeit
- 4 Funktionen und Effekte der Diskurse
- 4.1 Soziale und materielle Folgen
- 4.2 Resümee
- 4.3 Kontinuitäten
- 5 Fazit
- 6 Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Konstruktion von „Asozialität“ im Nationalsozialismus und deren soziale Folgen. Die Arbeit analysiert die diskursiven und praktischen Prozesse der Hierarchisierung und Stigmatisierung von Individuen als „asozial“. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Einbettung dieser Prozesse in den wissenschaftlichen und sozialpolitischen Kontext der Weimarer Republik und dem eugenischen Denken dieser Zeit. Darüber hinaus werden Kontinuitäten nach 1945 beleuchtet.
- Konstruktion von „Asozialität“ im Nationalsozialismus
- Diskurse und Praktiken der Hierarchisierung und Stigmatisierung
- Eugenisches Denken und sozialpolitische Lage der Weimarer Republik
- Beteiligung Sozialer Arbeit an den Prozessen
- Kontinuitäten nach 1945
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen: Dieses Kapitel dient als Einleitung und führt in die Thematik der Arbeit ein. Es beschreibt den Gegenstand der Arbeit, die persönliche Motivation der Autorin, den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit. Es beinhaltet auch eine theoretische Sensibilisierung und Begriffsklärungen zu „Asozial“ und „Asozialität“, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen und den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten. Die Formalien der Arbeit werden ebenfalls erläutert.
2 Einbettung in den historischen Kontext: Dieses Kapitel bettet die Konstruktion von „Asozialität“ in den historischen Kontext der Weimarer Republik und des frühen Nationalsozialismus ein. Es analysiert die Rolle von Erb- und Rassenlehre, Eugenik und sozialpolitischen Entwicklungen, die die Grundlage für die spätere Verfolgung „asozialer“ Menschen bildeten. Die relevanten Rechts- und Gesetzeslagen vor 1933 werden ebenso untersucht wie die Diskussionen um ein Bewahrungsgesetz und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Das Kapitel liefert somit ein umfassendes Verständnis der Vorbedingungen für die Entwicklung des „Asozialitäts“-Diskurses im Nationalsozialismus.
3 Wirkung und Entwicklung des ›Asozialitäts<-Diskurses im Nationalsozialismus: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung und Wirkung des „Asozialitäts“-Diskurses während des Nationalsozialismus. Es analysiert die Rolle der Wissenschaft, die Be- und Neudeutung rechtswissenschaftlicher Theorien und die allgemein wirksamen Rechtsgrundlagen, die zur Verfolgung „asozialer“ Menschen führten. Die Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen Eugenik, Kriminalbiologie und Justiz, die zu Zwangsunterbringung und Haft führten. Die verschiedenen Instrumente der Verfolgungspraxen und die Klassifizierung „asozialisierter“ Personengruppen werden detailliert dargestellt. Auch die (Mit-)Wirksamkeit von Institutionen der Sozialen Arbeit in diesem Kontext wird thematisiert.
4 Funktionen und Effekte der Diskurse: Dieses Kapitel befasst sich mit den sozialen und materiellen Folgen des „Asozialitäts“-Diskurses. Es analysiert die weitreichenden Auswirkungen der Verfolgung und Stigmatisierung auf die betroffenen Personen und Gruppen. Das Resümee fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und untersucht die Kontinuitäten dieses Ungleichheitsparadigmas bis in die Nachkriegszeit. Hier wird auf die fortbestehende Ausgrenzung ehemaliger „asozialer“ KZ-Häftlinge eingegangen.
Schlüsselwörter
Asozialität, Nationalsozialismus, Eugenik, Kriminalbiologie, Soziale Arbeit, Stigmatisierung, Verfolgung, Diskurse, Rechtsgrundlagen, Kontinuitäten, Ungleichheitsparadigma, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Konstruktion von „Asozialität“ im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von „Asozialität“ im Nationalsozialismus und deren soziale Folgen. Im Fokus stehen die diskursiven und praktischen Prozesse der Hierarchisierung und Stigmatisierung von Individuen als „asozial“, eingebettet in den wissenschaftlichen und sozialpolitischen Kontext der Weimarer Republik und des eugenischen Denkens. Die Arbeit beleuchtet auch Kontinuitäten nach 1945.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion von „Asozialität“, Diskurse und Praktiken der Hierarchisierung und Stigmatisierung, eugenisches Denken und die sozialpolitische Lage der Weimarer Republik, die Beteiligung Sozialer Arbeit an den Prozessen und Kontinuitäten nach 1945.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Grundlagen) dient als Einleitung. Kapitel 2 (Historischer Kontext) bettet die Thematik in die Weimarer Republik und den frühen Nationalsozialismus ein. Kapitel 3 (Wirkung und Entwicklung des Asozialitäts-Diskurses) analysiert den Diskurs im Nationalsozialismus. Kapitel 4 (Funktionen und Effekte der Diskurse) befasst sich mit den sozialen und materiellen Folgen. Kapitel 5 (Fazit) rundet die Arbeit ab. Zusätzlich gibt es einen Epilog.
Welchen Zeitraum umfasst die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den Zeitraum der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, beleuchtet aber auch Kontinuitäten bis in die Nachkriegszeit.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext der Konstruktion und Umsetzung der „Asozialität“. Es wird analysiert, inwieweit Soziale Arbeit an den Prozessen der Stigmatisierung und Verfolgung beteiligt war oder zumindest mitwirkte.
Welche Bedeutung hat das eugenische Denken?
Das eugenische Denken wird als wichtiger Bestandteil des historischen Kontextes betrachtet, der die Konstruktion und Verfolgung von „Asozialen“ maßgeblich beeinflusste.
Welche Rechtsgrundlagen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die relevanten Rechts- und Gesetzeslagen vor 1933 und die allgemein wirksamen Rechtsgrundlagen im Nationalsozialismus, die zur Verfolgung „asozialer“ Menschen führten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Asozialität, Nationalsozialismus, Eugenik, Kriminalbiologie, Soziale Arbeit, Stigmatisierung, Verfolgung, Diskurse, Rechtsgrundlagen, Kontinuitäten, Ungleichheitsparadigma, Weimarer Republik.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Konstruktion und die weitreichenden sozialen und materiellen Folgen des „Asozialitäts“-Diskurses im Nationalsozialismus und beleuchtet die Kontinuitäten bis in die Nachkriegszeit. Die genauen Schlussfolgerungen finden sich im Fazit der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich akademisch mit der Thematik der „Asozialität“ im Nationalsozialismus auseinandersetzen möchten. Sie richtet sich an Studierende, Wissenschaftler und alle Interessierten, die ein tiefergehendes Verständnis der diskursiven und praktischen Prozesse der Ausgrenzung und Verfolgung im Nationalsozialismus suchen.
- Citar trabajo
- Naemi Eifler (Autor), 2014, Konstruktionen von "Asozialität" und die sozialen Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470519