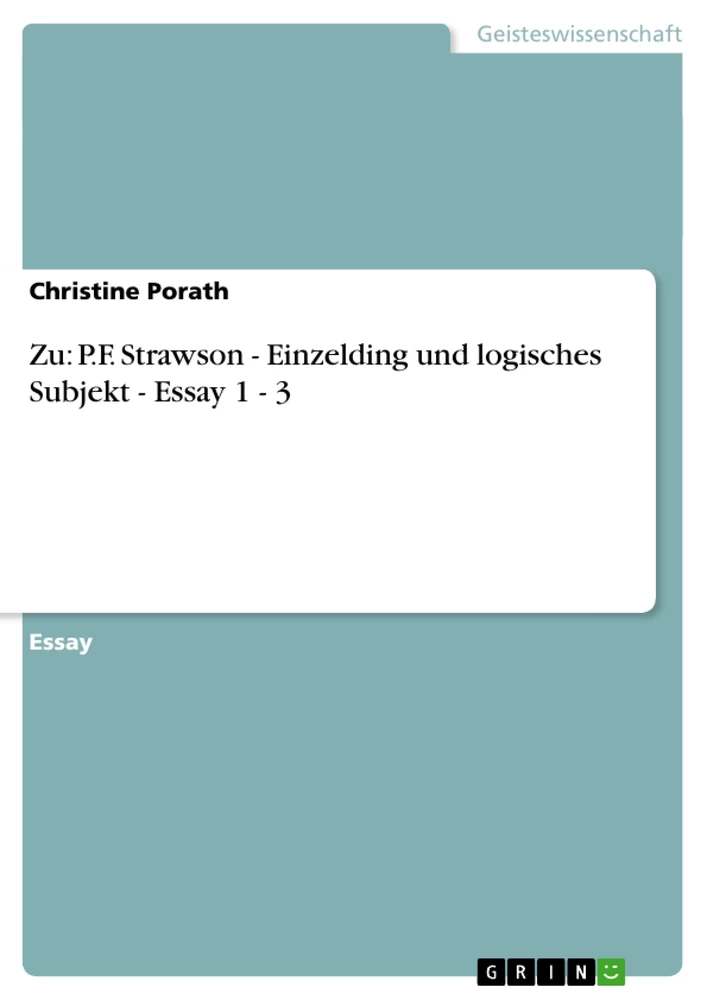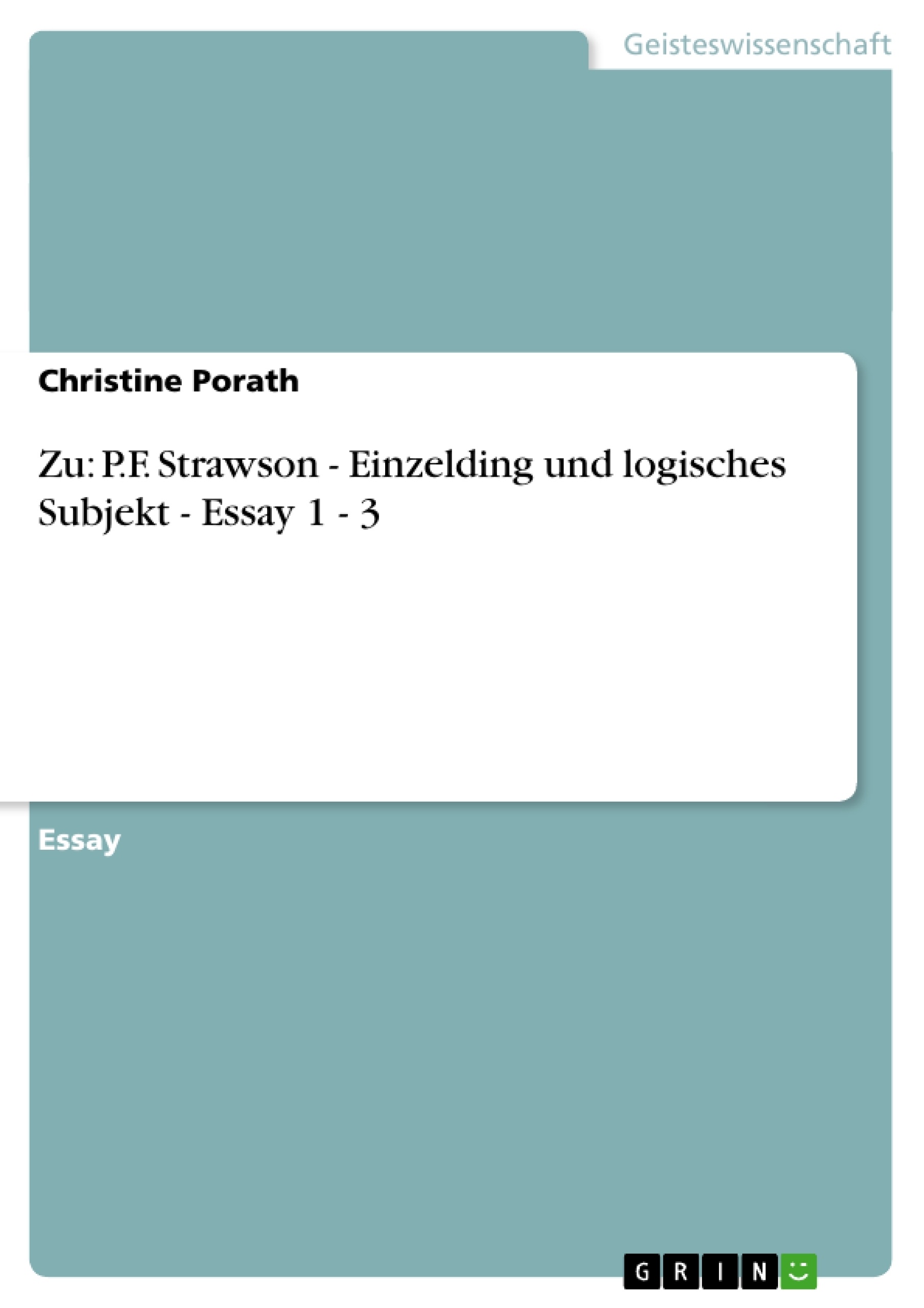Die zentrale Frage in P.F. Strawsons Werk „Einzelding und logisches Subjekt“ (individuals) ist, wie der Mensch über die Begriffe von Dingen seiner Umwelt verfügt und wie es möglich ist, dass er darüber verfügen kann (d.h. die Struktur dieser Begriffe und unser Denken über Einzeldinge).
Zunächst geht er davon aus, dass oft in einem Dialog von Dingen gesprochen wird (S.18) und es dabei darauf ankommt, dass der Hörer genau weiß von welchem Einzelding der Sprecher redet. Wenn das der Fall ist, so ist der Hörer in der Lage das betreffende Einzelding zu „identifizieren“. Nun ist es aber fraglich, wann man sich sicher sein kann, dass diese Identifikation funktioniert. Um eine Beantwortung zu finden, unterscheidet Strawson zwei Arten der Identifikation. Eine Form ist die „demonstrative Identifikation“. In diesem Fall ist der Hörer genau dann in der Lage ein Einzelding zu identifizieren, wenn er es im Moment der Erwähnung visuell und taktil wahrnehmen kann oder es kurz vorher konnte. Der Sprecher nimmt dabei demonstrativen Bezug (z.B. durch passende Demonstrativpronomina) auf das betreffende Ding, d.h. er weißt explizit auf das sichtbare oder kurz vorher sichtbar gewesene Objekt hin. Durch diesen Bezug wird ein bestimmter Bereich („Ausschnitt aus dem Universum“ S.23), das dem visuellen Blickfeld des Hörers und Sprechers entspricht, eingeschränkt, in dem die Identifikation stattfindet. Dadurch kann der Hörer das Einzelding lokalisieren und somit identifizieren.
Die andere Form der Identifikation ist die „nicht-demonstrative Identifikation“ von Einzeldingen. Sie trifft immer dann zu, wenn ein demonstrativer Bezug auf ein Ding nicht möglich ist, weil zum Beispiel die Szene, mit den zu identifizierenden Elementen, unübersichtlich oder verschiedene Abschnitte dieser Szene täuschend ähnlich sind und man Fehler bei der Beschreibung des betreffenden Objekts machen kann; aber auch wenn dieses Einzelding gegenwärtig nicht wahrnehmbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- Essay 1
- Zwei Formen der Identifikation von Einzeldingen: demonstrativ und nicht-demonstrativ
- Das Problem der nicht-demonstrativen Identifikation und Strawsons Lösung
- Das System von Raum und Zeit: grundlegend für die Möglichkeit Einzeldinge zu identifizieren.
- Zwei Kategorien von Einzeldingen bei denen eine Identifizierbarkeits-Abhängigkeit eines Typs von Einzeldingen besteht.
- Essay 2
- Materielle Körper: die grundlegenden Einzeldinge für die Identifikation von Einzeldingen
- Universalität der Behauptung, materielle Körper seien die grundlegenden Einzeldinge - das Gedankenexperiment einer rein auditiven Welt.
- Zusammenhang zwischen der Idee eines nicht-solipsistischen Bewusstseins und der Idee der Identifikation objektiver Einzeldinge.
- Gareth Evans Kritik an Strawsons Nachweis, dass Identifikation von Einzeldingen in einer rein auditiven Welt möglich ist.
- Essay 3
- Zuschreibung von Bewusstseinszuständen zu einem Subjekt: Strawsons Kritik an der ,,Cartesianischen Auffassung“ und der Theorie des „Nicht-Besitzen“.
- Der Begriff der Person – ein primitiver Begriff.
- Abhängigkeit von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung von Bewusstseinszuständen
- Verwendungsweise und Referenz des Wortes „ich“.
- Unterschiedliche Basis der Selbstzuschreibung und der Fremdzuschreibung von Bewusstseinszuständen und der daraus folgende Denkfehler des Skeptikers.
- Die logische Rolle des Begriffs „,,materieller Körper“ und des Begriffs,,Person\" in unserem Begriffssystem und deren Zusammenhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Strawsons Werk „Einzelding und logisches Subjekt“ beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen über die Begriffe von Dingen ihrer Umwelt verfügen und wie es möglich ist, dass sie darüber verfügen können. Der Fokus liegt auf der Analyse der Struktur dieser Begriffe und der Funktionsweise des Denkens über Einzeldinge.
- Die Bedeutung der Identifikation von Einzeldingen und die Unterscheidung zwischen demonstrativer und nicht-demonstrativer Identifikation.
- Das Raum-Zeit-System als Grundlage für die Identifikation von Einzeldingen und die Rolle von „individuierenden Tatsachen“.
- Die Abhängigkeit von der Identifizierung materieller Körper für die Identifikation anderer Einzeldingstypen.
- Die Beziehung zwischen der Identifikation von Einzeldingen und dem Konzept des Bewusstseins.
- Die Rolle der Person als ein fundamentaler Begriff im System der Identifikation.
Zusammenfassung der Kapitel
Essay 1
Strawson beginnt mit der Frage, wie wir in einem Dialog über Dinge sprechen können, ohne dass Missverständnisse entstehen, d.h. wie wir sicherstellen können, dass der Hörer weiß, welches Einzelding gemeint ist. Er unterscheidet zwei Formen der Identifikation: die demonstrative, bei der der Hörer das Ding im Moment des Sprechens wahrnehmen kann, und die nicht-demonstrative, bei der das Ding nicht sichtbar ist. Strawson argumentiert, dass die nicht-demonstrative Identifikation auf Beschreibungen beruht, die jedoch nicht immer eindeutig sind.
Er führt das Konzept der „individuierenden Tatsachen“ ein, die ein Ding durch Beziehungen zu anderen, demonstrativ identifizierbaren Dingen, eindeutig charakterisieren. Er stellt fest, dass die Identifikation von Einzeldingen in einem System von Raum und Zeit stattfindet, das uns einen festen Rahmen für die Lokalisierung und Zuordnung von Dingen bietet.
Essay 2
Strawson erörtert, ob es einen grundlegenden Typ von Einzeldingen gibt, dessen Identifikation die Identifikation anderer Typen ermöglicht. Er argumentiert, dass materielle Körper als grundlegende Einzeldinge fungieren, da sie den Rahmen für die Identifikation anderer Dinge bieten. Er stellt sich ein Gedankenexperiment vor, in dem Menschen nur auditive Wahrnehmungen haben und argumentiert, dass selbst in diesem Fall die Identifikation von Einzeldingen möglich wäre.
Strawson verknüpft die Idee der Identifikation von Einzeldingen mit dem Konzept eines nicht-solipsistischen Bewusstseins. Er untersucht die Kritik von Gareth Evans an seiner Argumentation, dass die Identifikation in einer rein auditiven Welt möglich ist.
Essay 3
Strawson widmet sich der Zuschreibung von Bewusstseinszuständen zu einem Subjekt und kritisiert die „Cartesianische Auffassung“ sowie die Theorie des „Nicht-Besitzen“. Er argumentiert, dass der Begriff der Person ein primitiver Begriff ist, der weder aus anderen Begriffen abgeleitet noch reduziert werden kann.
Er analysiert die Abhängigkeit von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung von Bewusstseinszuständen und die Rolle des Wortes „ich“. Strawson untersucht den Unterschied zwischen der Basis von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung und zeigt, wie der Skeptiker in Bezug auf das Bewusstsein in einen Denkfehler gerät.
Abschließend beleuchtet er die logische Rolle der Begriffe „materieller Körper“ und „Person“ in unserem Begriffssystem und den Zusammenhang zwischen ihnen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themengebiete von Strawsons Werk sind: Identifikation von Einzeldingen, demonstrative und nicht-demonstrative Identifikation, individuierende Tatsachen, Raum-Zeit-System, materielle Körper, Person, Bewusstseinszustände, Selbstzuschreibung, Fremdzuschreibung, Skeptizismus.
- Quote paper
- Christine Porath (Author), 2005, Zu: P.F. Strawson - Einzelding und logisches Subjekt - Essay 1 - 3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47064