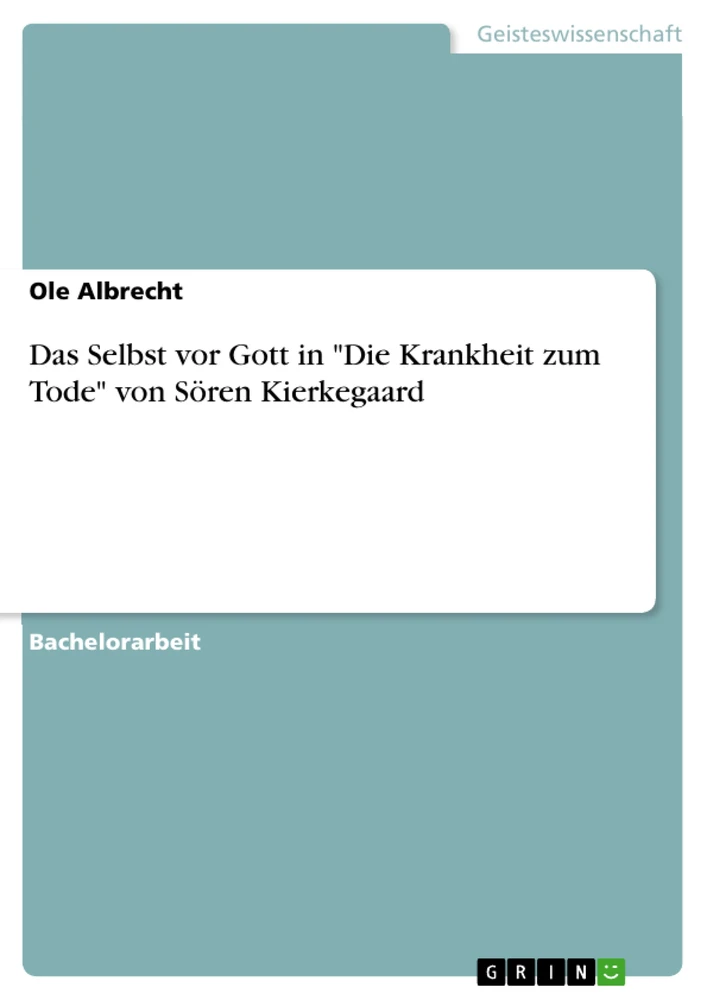In der Bachelorarbeit geht es zunächst darum, die Voraussetzungen zu erhellen, die es Kierkegaard erst ermöglichten, ein Werk wie die Krankheit zum Tode zu verfassen. Dies geschieht durch Hervorhebung der spezifischen Charakteristika seines Denkens, welche sich vor allem aus dem (philosophie-)historischen Kontext des Dänen ergeben. Anschließend soll die Krankheit zum Tode in ihrer Gesamtheit und ihrem Aufbau nach analysiert werden, damit es im Anschluss zu einer Untersuchung des Kierkegaardschen Menschenbildes kommen kann, welches sich mit dem im Titel dieser Arbeit auftauchenden Begriff des "Selbst vor Gott" identifizieren lässt.
Um dieses Menschenbild noch präziser zu bestimmen, wird es ferner zu einer vergleichenden Untersuchung mit der Deutung des Menschen durch J.-P. Sartre als einem hochrangigen Vertreter des sogenannten Existentialismus kommen. Im Anschluss an eine zusammenfassende, kritische Würdigung wird die Arbeit mit einem Abschnitt über die Aktualität Kierkegaardschen Denkens schließen.
Im Februar 1848 entwirft Sören Kierkegaard skizzenhaft den Grundriss für ein Werk, das den Titel "Gedanken, die von Grund auf heilen; christliche Arznei" tragen sollte. Dieses Werk, so plante es Kierkegaard, würde aus zwei unterschiedlichen Schriften bestehen - "Die Heilung von Grund auf" und "Die Krankheit zum Tode".
Nur Letztere brachte Kierkegaard schließlich zur Vollendung, doch die im ursprünglich geplanten Titel ausgedrückte Grundintention hatte sich nicht geändert. Kierkegaard, der in seiner Person die Symbiose von Arzt und Schriftsteller vorgenommen hatte, schuf eine Psychopathologie im Hinblick auf den modernen Menschen, dem er, ob jener es nun hören wollte oder nicht, schonungslos seine Krankheit diagnostizierte, ihm aber auch den Weg zur Heilung eröffnete, indem er ihm die entsprechende Arznei verordnete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwischen Hegel und Nietzsche – Kierkegaards Denken im Kontext zeitgenössischer Philosophie
- Der zerrissene Mensch - Kierkegaards theologische Anthropologie in der Krankheit zum Tode
- ,,L'existence précède L'essence\" - J.-P. Sartres atheistische Alternative
- Zusammenfassende Betrachtungen
- Zur Aktualität Kierkegaards
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Sören Kierkegaards philosophischer Anthropologie, wie sie im Werk „Die Krankheit zum Tode“ dargestellt wird. Ziel ist es, die spezifischen Charakteristika des Kierkegaardschen Denkens im Kontext seiner Zeit zu beleuchten und die Kernaussagen des Werkes zu analysieren. Dabei soll insbesondere das von Kierkegaard entwickelte Menschenbild im Spannungsfeld von „Selbst vor Gott“ untersucht werden.
- Kierkegaards Kritik am Hegelschen Idealismus
- Die Bedeutung der individuellen Existenz
- Die Rolle von Angst und Verzweiflung im menschlichen Leben
- Der Begriff des „Selbst vor Gott“
- Vergleichende Untersuchung mit der Anthropologie von J.-P. Sartre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Werk „Die Krankheit zum Tode“ vor und erläutert die Intentionen, die Kierkegaard mit diesem Werk verfolgt. Außerdem werden die zentralen Themen und die Struktur der Arbeit skizziert.
- Zwischen Hegel und Nietzsche: Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen Koordinaten des Kierkegaardschen Denkens im Kontext der Zeit. Es analysiert die Bedeutung von Hegels spekulativer Philosophie des Geistes für Kierkegaards Werk und zeigt dessen Abgrenzung von diesem Denksystem auf. Der Fokus liegt dabei auf der Kritik an der Hegelschen Vorstellung von einer durch die Vernunft erfassbaren Welt und der Betonung der individuellen Lebenserfahrung.
- Der zerrissene Mensch: Dieses Kapitel widmet sich Kierkegaards theologischer Anthropologie in der „Krankheit zum Tode“. Es untersucht die zentralen Konzepte des Werkes, wie z.B. die Angst, die Verzweiflung und den Begriff des „Selbst vor Gott“. Dabei wird deutlich, wie diese Konzepte die spezifische Lebenserfahrung des Einzelnen bestimmen und dessen Verhältnis zu Gott prägen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Werk „Die Krankheit zum Tode“ von Sören Kierkegaard und analysiert dessen philosophische Anthropologie im Spannungsfeld von Hegels Idealismus und Sartres Existenzialismus. Schwerpunktthemen sind: individuelle Existenz, Angst, Verzweiflung, „Selbst vor Gott“, theologische Anthropologie.
- Citar trabajo
- Ole Albrecht (Autor), 2010, Das Selbst vor Gott in "Die Krankheit zum Tode" von Sören Kierkegaard, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471041