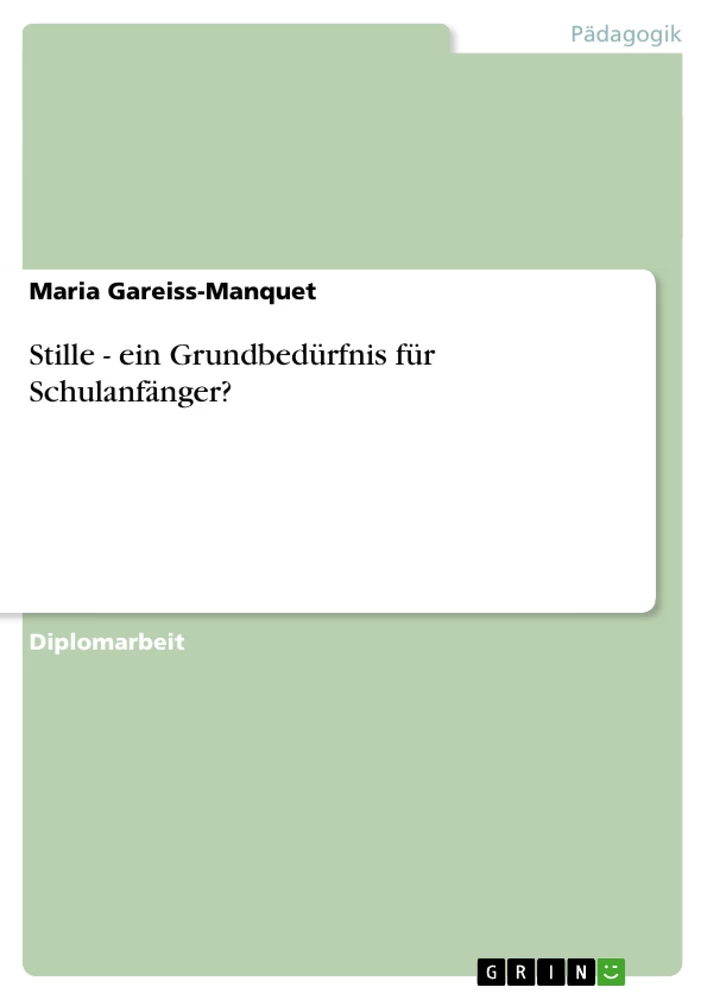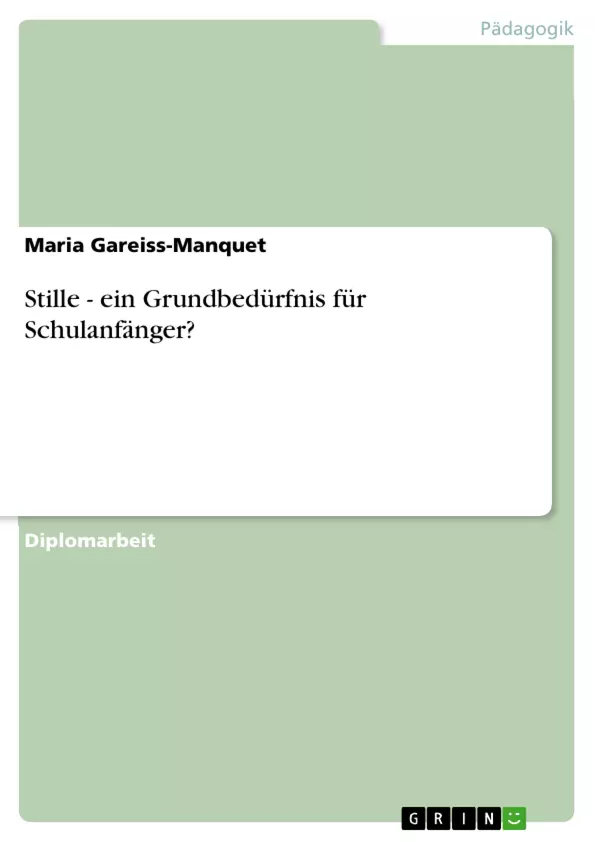Unsere Zeit ist keine Zeit der Stille.
Viele Bereiche der Wirklichkeit um und in uns sind mehr von Unruhe, Lärm und
geschäftigem Aktionismus durchsetzt, als durch Stille und Schweigen.
Was auf uns - und ungeschützter noch auf unsere Kinder - an elektronischer
Unterhaltung und sonstiger Zerstreuung einstürmt und zu oft aufgesogen oder
widerstandslos konsumiert wird, lässt uns nicht mehr zu Ruhe und Besinnung
kommen. Wir stehen uns bei der „Ich-Findung" selbst im Weg.
Zunehmend ist es Aufgabe der Schule, Schwachstellen und Gefahrenpunkte der
Gesellschaft zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.
Stille und Besinnung sollten ausreichend Raum im Leben jedes Menschen finden.
Solange dieses Anliegen von den Betroffenen selbst noch nicht artikuliert werden
kann - was bei Schulanfängern zumeist der Fall sein wird -, ist es wichtige
Aufgabe der Schule, Fürsprecher und Organisator dieses Grundbedürfnisses zu
sein.
Und ich erkannte,
dass sie die Stille nötig hatten.
Denn nur in der Stille
kann die Wahrheit eines jeden
Früchte ansetzen und Wurzeln schlagen.
Stille des Menschen,
der sich aufstützt und nachdenkt.
Stille, die ihn erkennen lässt.
Stille, die dich bei der Entfaltung behütet.
Stille des Herzens.
Stille der Sinne.
Stille der inneren Worte,
denn es ist gut, wenn du Gott wiederfindest,
der die Stille im Ewigen ist.
Antoine de Saint Exupery
Inhaltsverzeichnis
- Anstelle eines Vorwortes...
- 1. Versuch einer Begriffsklärung
- 1.1. Stille als Lautlosigkeit
- 1.2. Stille als Einstieg in das „Ich“
- 2. Die Bedeutung der Stille heute
- 3. Das menschliche Bedürfnis nach Stille
- 4. Veränderte Kindheit
- 4.1. Die Bedeutung der Familie hat sich verändert
- 4.2. Veränderungen der Schulsituation
- 4.3. Verlagerung der Spielfelder
- 4.4. Wirklichkeit aus zweiter Hand
- 5. Die spezielle Situation der Schulanfänger – die Sechsjahreskrise
- 5.1. Körperliche Veränderungen
- 5.2. Psychische Herausforderungen
- 5.3. Grundlegende Veränderungen im intellektuellen Bereich
- 5.4. Veränderungen der Familie
- 5.5. Soziales Leben der Sechsjährigen
- 6. Die Stille des Erziehers
- 7. Die Stille der Bräuche
- 8. Orte der Stille
- 8.1. Besuch in der Kirche
- 8.2. Die Stille im Wald
- 9. Situationen der Stille
- 10. Stille bei Maria Montessori
- 10.1. Entstehung der Übungen der Stille
- 10.2. Grundbedingungen
- 10.3. Einordnung in das methodische Konzept Montessoris
- 10.4. Das Gehen auf der Linie
- 11. Wichtige Voraussetzungen für die Durchführung von Stille-Übungen
- 12. Vorbereitende Spiele und Übungen
- 12.1. Beruhigende Spiele
- 12.2. Körpererfahrungsspiele
- 12.3. Atemspiele
- 12.4. Wahrnehmungsübungen
- 12.4.1. Zum Sehen
- 12.4.2. Zum Hören
- 12.4.3. Zum Berühren
- 12.4.4. Zum Riechen
- 12.4.5. Zum Bewegen
- 13. Stilleübungen -,,Wege in das Innere"
- 13.1. Phantasiereisen
- 13.2. Musikmeditation
- 13.2.1. Erste Erfahrungen mit dem Hinhören
- 13.2.2. Vorspielen einfacher Kompositionen
- 13.3. Tönen und Lautmalen
- 13.4. Bildmeditation
- 13.5. Meditative Kindertänze
- 13.6. Stilles Malen
- 13.7. Mandalas
- 13.7.1. Arbeiten mit Vorlagen
- 13.7.2. Mandalas selbst entwickeln
- 14. Weitere mögliche Hilfen auf dem „Weg nach Innen“
- 14.1. Vorlesen und Erzählen
- 14.2. Yoga
- 14.2.1. Was ist Yoga?
- 14.2.2. Wie Yoga entstanden ist
- 14.2.3. Einige Lektionen und Übungen
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Bedeutung von Stille für Schulanfänger. Sie befasst sich mit dem Konzept von Stille als Grundbedürfnis und untersucht die veränderte Kindheit, die besonderen Herausforderungen der Sechsjahreskrise und die Bedeutung von Stille in der Erziehung und im Unterricht.
- Stille als Grundbedürfnis von Schulanfängern
- Veränderungen in der Kindheit und die Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern
- Die Sechsjahreskrise und die besonderen Bedürfnisse von Schulanfängern
- Methoden zur Förderung von Stille und Entspannung bei Schulanfängern
- Die Rolle von Stille im pädagogischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel definiert den Begriff "Stille" und unterscheidet zwischen Stille als Lautlosigkeit und Stille als innerem Zustand.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Stille in der heutigen Zeit, die von ständiger Reizüberflutung geprägt ist.
- Das dritte Kapitel untersucht das menschliche Bedürfnis nach Stille als essenziellen Bestandteil der menschlichen Entwicklung.
- Kapitel vier analysiert die veränderte Kindheit im Kontext von Familie, Schule und Spiel.
- Kapitel fünf beleuchtet die besonderen Herausforderungen der Sechsjahreskrise für Schulanfänger, die körperliche, psychische und intellektuelle Veränderungen durchmachen.
- Kapitel sechs diskutiert die Rolle des Erziehers als Vorbild und Vermittler von Stille.
- Kapitel sieben untersucht die Bedeutung von Stille in Bräuchen und Ritualen.
- Kapitel acht identifiziert Orte der Stille, wie Kirche und Wald, als Möglichkeiten zur Entspannung und inneren Sammlung.
- Kapitel neun beschäftigt sich mit verschiedenen Situationen, die Stille und innere Ruhe fördern können.
- Kapitel zehn beleuchtet die Bedeutung von Stille im pädagogischen Konzept Maria Montessoris und beschreibt verschiedene Übungen zur Förderung von Stille.
- Kapitel elf stellt wichtige Voraussetzungen für die Durchführung von Stille-Übungen im schulischen Kontext dar.
- Kapitel zwölf bietet eine Auswahl an vorbereitenden Spielen und Übungen, die Kinder auf Stille-Übungen vorbereiten.
- Kapitel dreizehn präsentiert verschiedene Stilleübungen, die Kindern helfen, in ihr Inneres zu gelangen, wie Phantasiereisen, Musikmeditation und Stilles Malen.
- Kapitel vierzehn untersucht weitere Hilfen auf dem "Weg nach Innen", wie Vorlesen und Erzählen sowie Yoga.
Schlüsselwörter
Stille, Schulanfänger, Sechsjahreskrise, Kindheit, Familie, Schule, Erzieher, Maria Montessori, Stilleübungen, Meditation, Yoga
Häufig gestellte Fragen
Ist Stille ein Grundbedürfnis für Schulanfänger?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass Stille essenziell für die „Ich-Findung“ und die gesunde Entwicklung von Kindern ist, besonders in einer reizüberfluteten Zeit.
Was versteht man unter der „Sechsjahreskrise“?
Es beschreibt die Phase des Schuleintritts, die von massiven körperlichen, psychischen und intellektuellen Veränderungen sowie neuen sozialen Herausforderungen geprägt ist.
Welche Rolle spielt Maria Montessori in diesem Konzept?
Montessori entwickelte spezifische „Übungen der Stille“ (z. B. das Gehen auf der Linie), die Kindern helfen, Konzentration und innere Ruhe zu finden.
Welche praktischen Stilleübungen werden in der Arbeit vorgestellt?
Vorgestellt werden Phantasiereisen, Musikmeditation, stilles Malen, Mandalas sowie Wahrnehmungsübungen für alle Sinne.
Können auch Yoga oder Waldspaziergänge als Stille-Quellen dienen?
Ja, die Arbeit identifiziert den Wald als Ort der Stille und Yoga als wertvolle Hilfe auf dem „Weg nach Innen“ für Schulanfänger.
Warum ist die Schule heute mehr als früher als „Organisator von Stille“ gefordert?
Weil elektronische Unterhaltung und Zerstreuung im Alltag zunehmen, muss die Schule als Ausgleich einen Raum für Besinnung und Ruhe schaffen.
- Citar trabajo
- Maria Gareiss-Manquet (Autor), 2002, Stille - ein Grundbedürfnis für Schulanfänger?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4711