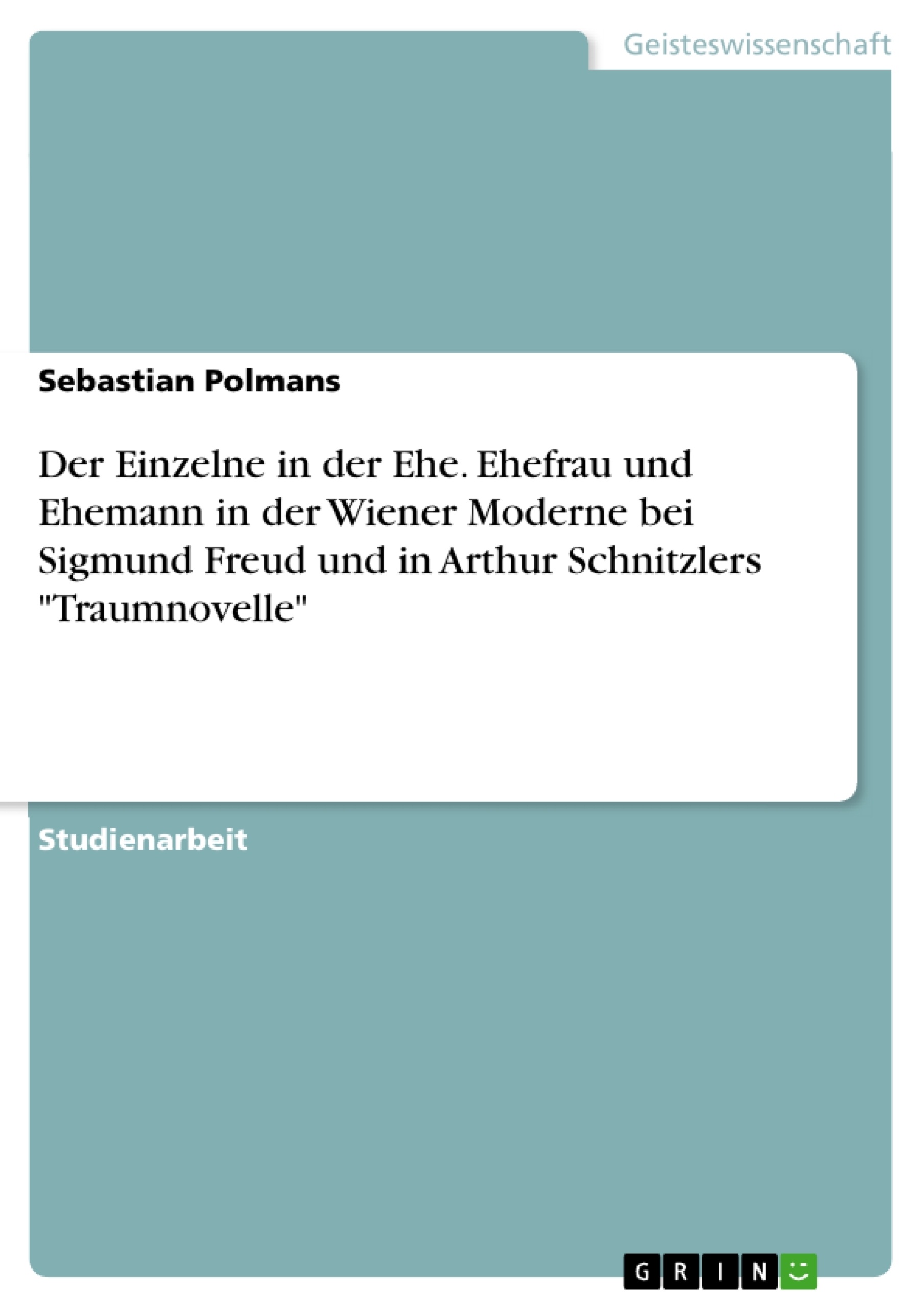Bereits Sokrates hat sich zum Problemkomplex der Ehe geäußert: „Heirate oder heirate nicht – du wirst es auf jeden Fall bereuen.“ Die Ehe für den Einzelnen, ob Mann oder Frau, scheint also eine ebenso zeitlose, wie unlösbare Problematik – ob nun ledig oder verheiratet. Doch heutzutage gilt das System der Ehe eher als epochal, denn als einzig mögliches Bündnis von Mann und Frau.
Die vorliegende Arbeit soll allerdings weder die Kulturgeschichte der Institution Ehe illustrieren, noch soll sie ein Ursachenforschungsunternehmen für gescheiterte Ehen darstellen. Die Arbeit setzt zeitlich an dem Punkt an, nämlich um 1900, an dem die traditionelle Ehe erstmals in der Öffentlichkeit ausgiebig und lebendig diskutiert wird. Dabei werden die Texte zweier Autoren der Jahrhundertwende untersucht, die die kritische Debatte um die Institution Ehe entscheidend mitbestimmt haben und deren Inhalte für die heutige Debatte noch immer aktuell sind.
Zwei Perspektiven versuchen dabei den Gegenstand zu erhellen, die eine aus der literarischen Sicht der Traumnovelle Arthur Schnitzlers, die andere aus Sigmund Freuds naturwissenschaftlich-psychologischem Blickwinkel. Beide zu untersuchenden Autoren haben mit ihren Arbeiten die Kultur in der Zeit der Jahrhundertwende im Allgemeinen, insbesondere die der Wiener Moderne, entscheidend mitbestimmt und sich sowohl in zahlreichen ihrer Schriften als auch in persönlichen Stellungnahmen zur Problematik der Ehe geäußert. Hierbei soll untersucht werden, inwieweit sich Analogien und Differenzen zwischen dem skizzierten Ehe- respektive Liebesleben in Schnitzlers Text sowie in Freuds Theorien und im wirklichen Liebesleben der beiden Autoren ausmachen lassen. Daher werden in dieser Arbeit ausgehend von Textanalysen Bezüge zur Biographie hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sigmund Freuds Kritik an der Institution Ehe
- Sigmund Freuds Einstellung zur Ehe
- Der Mann in der Ehe
- Die Frau in der Ehe
- Arthur Schnitzler, Traumnovelle und die Ehe
- Die Frau in der Ehe: Albertine
- Der Mann in der Ehe: Fridolin
- Die Lösung des Eheproblems in der Traumnovelle
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Ehemann und Ehefrau in der Wiener Moderne, indem sie Sigmund Freuds psychoanalytische Theorien mit Arthur Schnitzlers Traumnovelle vergleicht. Ziel ist es, Analogien und Unterschiede in der Betrachtung der Ehe und des individuellen Erlebens innerhalb der Ehebeziehung aufzuzeigen. Die biografischen Kontexte der Autoren werden ebenfalls berücksichtigt.
- Kritik an der traditionellen Eheinstitution um 1900
- Psychoanalytische Sichtweise auf Ehe und Sexualität (Freud)
- Literarische Darstellung von Ehekonflikten (Schnitzler)
- Der Einfluss der Moderne auf die Ehe
- Vergleichende Analyse von Freuds Theorien und Schnitzlers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische und gesellschaftliche Entwicklung der Ehe, von der Antike bis zur Jahrhundertwende. Sie thematisiert den Wandel der Ehevorstellungen, den Rückgang der Geburtenrate und den Anstieg der Scheidungszahlen. Besonders wird die Krise der traditionellen Ehe um 1900 hervorgehoben und die Relevanz der ausgewählten Autoren – Freud und Schnitzler – für die damalige und heutige Debatte um die Institution Ehe begründet. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich der individuellen Perspektiven von Mann und Frau in der Ehe, basierend auf den Textanalysen und biografischen Bezügen der Autoren.
Sigmund Freuds Kritik an der Institution Ehe: Dieses Kapitel analysiert Sigmund Freuds Sichtweise auf die Ehe. Es untersucht seine Einstellung zur Institution Ehe im Allgemeinen und beleuchtet seine spezifischen Ansichten zu den Rollen von Mann und Frau innerhalb der Ehe. Freuds psychoanalytische Konzepte werden herangezogen, um die Konflikte und Spannungen innerhalb ehelicher Beziehungen zu verstehen, insbesondere die Auswirkungen ungelöster innerpsychischer Konflikte auf die Partnerschaft. Die Analyse bezieht sich auf Freuds Schriften zur Sexualität und den Einfluss unbewusster Prozesse auf das eheliche Zusammenleben.
Arthur Schnitzler, Traumnovelle und die Ehe: Dieser Abschnitt befasst sich mit Arthur Schnitzlers Traumnovelle und analysiert die Darstellung der Ehe in diesem Werk. Die Rollen von Albertine und Fridolin werden im Detail untersucht, wobei ihr individuelles Erleben innerhalb der Ehe im Mittelpunkt steht. Die komplexen Beziehungen, Konflikte und die Suche nach Erfüllung werden im Kontext der Wiener Moderne beleuchtet. Das Kapitel untersucht Schnitzlers Lösungsansatz für die Eheprobleme, die in der Novelle präsentiert werden, und analysiert den Einfluss von Träumen und traumähnlichen Szenen auf die Handlung und die Charaktere.
Schlüsselwörter
Ehe, Wiener Moderne, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Traumnovelle, Psychoanalyse, Sexualität, Individuum, Mann, Frau, Rollenverständnis, Konflikt, Moderne, Gesellschaft, Institution, Liebe, Monogamie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Ehe in der Wiener Moderne anhand von Freud und Schnitzlers Traumnovelle
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Ehe und Ehepartnern in der Wiener Moderne. Sie vergleicht die psychoanalytischen Theorien Sigmund Freuds mit Arthur Schnitzlers Traumnovelle, um Analogien und Unterschiede in der Betrachtung der Ehe und des individuellen Erlebens innerhalb der Ehebeziehung aufzuzeigen. Biografische Kontexte der Autoren werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kritik an der traditionellen Ehe um 1900, die psychoanalytische Sichtweise auf Ehe und Sexualität bei Freud, die literarische Darstellung von Ehekonflikten bei Schnitzler, den Einfluss der Moderne auf die Ehe und eine vergleichende Analyse von Freuds Theorien und Schnitzlers Werk. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der individuellen Perspektiven von Mann und Frau in der Ehe.
Welche Autoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Werke von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Konkret wird Freuds psychoanalytische Sicht auf die Ehe analysiert und Schnitzlers Traumnovelle hinsichtlich der Darstellung der Ehe und der Rollen von Mann und Frau interpretiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über Sigmund Freuds Kritik an der Ehe, einem Kapitel über die Darstellung der Ehe in Schnitzlers Traumnovelle und einem Resümee. Jedes Kapitel untersucht die Ehe aus unterschiedlichen Perspektiven, unter Berücksichtigung der jeweiligen theoretischen und literarischen Kontexte.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse von Freuds Sicht auf die Ehe?
Die Analyse von Freuds Schriften beleuchtet seine allgemeine Einstellung zur Institution Ehe und seine spezifischen Ansichten zu den Rollen von Mann und Frau. Es werden Freuds psychoanalytische Konzepte herangezogen, um Konflikte und Spannungen innerhalb ehelicher Beziehungen zu verstehen, insbesondere die Auswirkungen innerpsychischer Konflikte auf die Partnerschaft.
Wie wird Schnitzlers Traumnovelle in Bezug auf die Ehe interpretiert?
Die Analyse der Traumnovelle konzentriert sich auf die Rollen von Albertine und Fridolin, deren individuelles Erleben innerhalb der Ehe im Mittelpunkt steht. Die komplexen Beziehungen, Konflikte und die Suche nach Erfüllung werden im Kontext der Wiener Moderne beleuchtet. Der Lösungsansatz für die Eheprobleme in der Novelle und der Einfluss von Träumen auf die Handlung und Charaktere werden ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Ehe, Wiener Moderne, Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Traumnovelle, Psychoanalyse, Sexualität, Individuum, Mann, Frau, Rollenverständnis, Konflikt, Moderne, Gesellschaft, Institution, Liebe, Monogamie.
Welche historische Entwicklung wird berücksichtigt?
Die Einleitung beleuchtet die historische und gesellschaftliche Entwicklung der Ehe von der Antike bis zur Jahrhundertwende, thematisiert den Wandel der Ehevorstellungen, den Rückgang der Geburtenrate und den Anstieg der Scheidungszahlen. Besonders wird die Krise der traditionellen Ehe um 1900 hervorgehoben.
- Quote paper
- Sebastian Polmans (Author), 2007, Der Einzelne in der Ehe. Ehefrau und Ehemann in der Wiener Moderne bei Sigmund Freud und in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471253