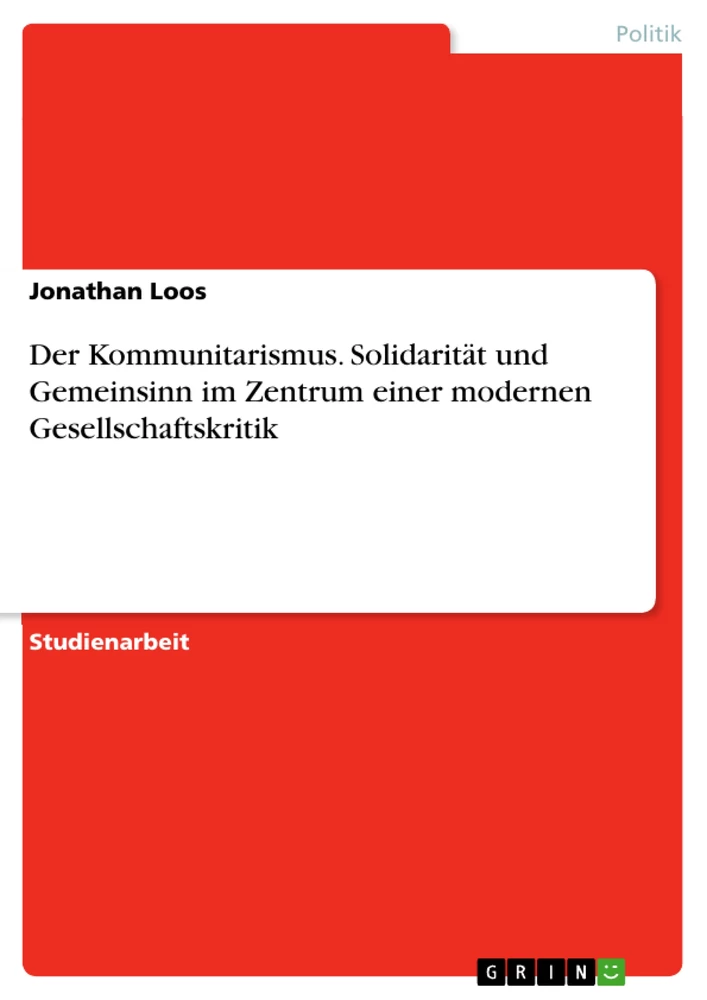Die steigenden Zahlen von Asylbewerbern haben in Deutschland intensive Debatten über den Umgang mit Asylsuchenden ausgelöst. Dabei stellen die aktuellen Flüchtlingsbewegungen den europäischen Kontinent nicht nur materiell, sondern auch ideell vor immense Herausforderungen. Mit Blick auf den Umgang mit Migranten rückt auch die Frage nach einer angemessenen Gesellschaftsform wieder stärker in das Blickfeld. Brennende Asylunterkünfte und zunehmender Fremdenhass auf deutschen Straßen zeigen deutlich, dass es notwendig ist, sich laufend mit den grundlegenden Prinzipien unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Schließlich müssen die Fragen nach einer gerechten politischen Ordnung immer wieder aufs Neue beantwortet werden. Wie können Gerechtigkeitsgrundsätze innerhalb einer Gesellschaft gefunden werden, die angemessen auf aktuelle Herausforderungen reagieren?
Die wohl umfassendste Gesellschaftstheorie der Gegenwart beschreibt John Rawls‘ politischer Liberalismus. In seinem Hauptwerk a theory of justice beschreibt er eine sozial-politische Grundordnung, die auf dem Wert der Gleichheit beruht und in der das Zusammenleben durch festgesetzte Gerechtigkeitsgrundsätze geordnet ist. Im Mittelpunkt seiner Theorie steht das Individuum als zentraler Entscheidungsträger. Rawls‘ Theorie hat eine Vielzahl von Reaktionen hervorgerufen. So entstand auch der Kommunitarismus in den 1980er Jahren als kritische Reaktion auf die liberale Philosophie Rawls. Die kommunitaristische Theorie betont in bewusster Abgrenzung zum Liberalismus die Verantwortung des Individuums gegenüber seiner Umgebung und die Bedeutung sozialer Bindungen eines jeden Menschen. Eine der zentralen Fragen des Kommunitarismus ist die, wie viel gemeinsame Identität zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft vorhanden sein muss, damit ein reibungsloses Zusammenleben funktioniert.
Im Folgenden sollen die Kritikpunkte des Kommunitarismus an der gesellschaftlichen Konzeption von Rawls‘ politischem Liberalismus aufgezeigt werden. Die Kritik an Rawls‘ Theorie entzündet sich dabei an verschiedenen Aspekten und ist auch innerhalb der kommunitaristischen Theorie sehr heterogen.
Abschließend stellt sich die Frage, wie die kommunitaristischen Kritikpunkte mit Blick auf die aktuelle politische Realität bewertet werden können. Ob die Befürchtungen sowie generell die radikale Kritik am politischen Liberalismus aus heutiger Sicht gerechtfertigt sind, soll deshalb zum Abschluss der Arbeit ebenfalls untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die kommunitaristische Kritik an Rawls' politischem Liberalismus
- 1. Das Individuum in der Gesellschaft
- 2. Die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft
- 3. Prioritätensetzung im politischen System
- 4. Moralvorstellungen als universelles Gut?
- 5. Bewertung der kommunitaristischen Kritik
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der kommunitaristischen Kritik an John Rawls' politischem Liberalismus. Sie untersucht die zentralen Kritikpunkte des Kommunitarismus an der gesellschaftlichen Konzeption von Rawls' Theorie und analysiert, wie diese Kritikpunkte in der aktuellen politischen Realität bewertet werden können.
- Das Konzept des Individuums in der Gesellschaft
- Die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft
- Die Bedeutung von Moralvorstellungen und Traditionen
- Die Rolle des Staates in der Gesellschaft
- Die Relevanz der kommunitaristischen Kritik in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik des Kommunitarismus und seiner Kritik an Rawls' politischem Liberalismus ein. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen der aktuellen Flüchtlingssituation und den Gedanken des Kommunitarismus, die sich in der heutigen Zeit besonders relevant erweisen.
II. Die kommunitaristische Kritik an Rawls' politischem Liberalismus
Dieses Kapitel stellt die Kernargumente der kommunitaristischen Kritik an Rawls' politischem Liberalismus dar. Es behandelt die Kritikpunkte in Bezug auf das Individuum in der Gesellschaft, die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft, die Prioritätensetzung im politischen System, die Rolle von Moralvorstellungen und die Bewertung der kommunitaristischen Kritik.
1. Das Individuum in der Gesellschaft
Dieser Abschnitt analysiert die liberale Konzeption des Individuums als ungebundenes Selbst und die Kritik des Kommunitarismus daran. Die Arbeit beleuchtet Rawls' Gedankenexperiment des Urzustands und die Kritik des Kommunitarismus an der Vorstellung eines Individuums, das frei von sozialen Bindungen und traditionell geprägten Werten agiert.
2. Die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft
Dieser Teil des Kapitels befasst sich mit der Vorstellung einer gerechten Gesellschaft aus der Sicht des Liberalismus und des Kommunitarismus. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der unterschiedlichen Auffassungen bezüglich des Individuums auf die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Kommunitarismus, politischer Liberalismus, John Rawls, Michael Sandel, Gerechtigkeitsgrundsätze, Gesellschaft, Individuum, Moral, Tradition, Werte, Politik, Flüchtlingssituation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Liberalismus und Kommunitarismus?
Der Liberalismus (Rawls) stellt das freie Individuum ins Zentrum, während der Kommunitarismus die Bedeutung sozialer Bindungen und der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft betont.
Welche Kritik üben Kommunitaristen an John Rawls?
Kritisiert wird vor allem das Konzept des „ungebundenen Selbst“ im Urzustand, das ohne soziale Werte und Traditionen agiert.
Warum ist diese Debatte heute besonders relevant?
Die aktuellen Flüchtlingsbewegungen fordern die Gesellschaft ideell heraus und werfen Fragen nach einer gerechten Ordnung und gemeinsamer Identität neu auf.
Wer ist ein bedeutender Vertreter der kommunitaristischen Kritik?
Michael Sandel wird als einer der zentralen Kritiker von Rawls' politischem Liberalismus in der Arbeit genannt.
Was fordert der Kommunitarismus für ein funktionierendes Zusammenleben?
Er fordert mehr Fokus auf Solidarität, Gemeinsinn und die Anerkennung moralischer Werte, die innerhalb einer Gemeinschaft gewachsen sind.
- Quote paper
- Jonathan Loos (Author), 2015, Der Kommunitarismus. Solidarität und Gemeinsinn im Zentrum einer modernen Gesellschaftskritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471304