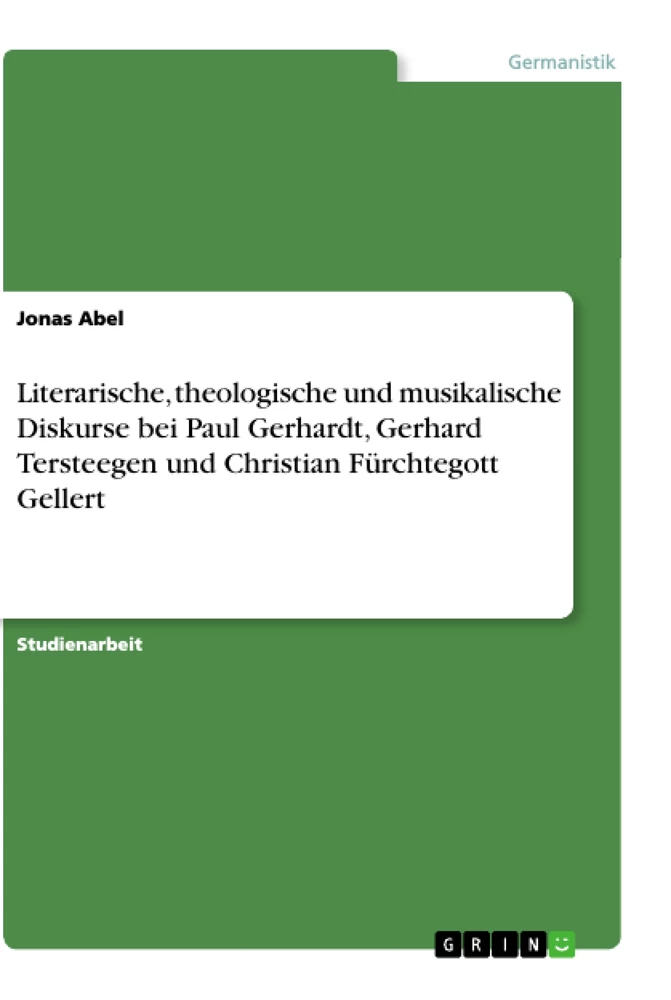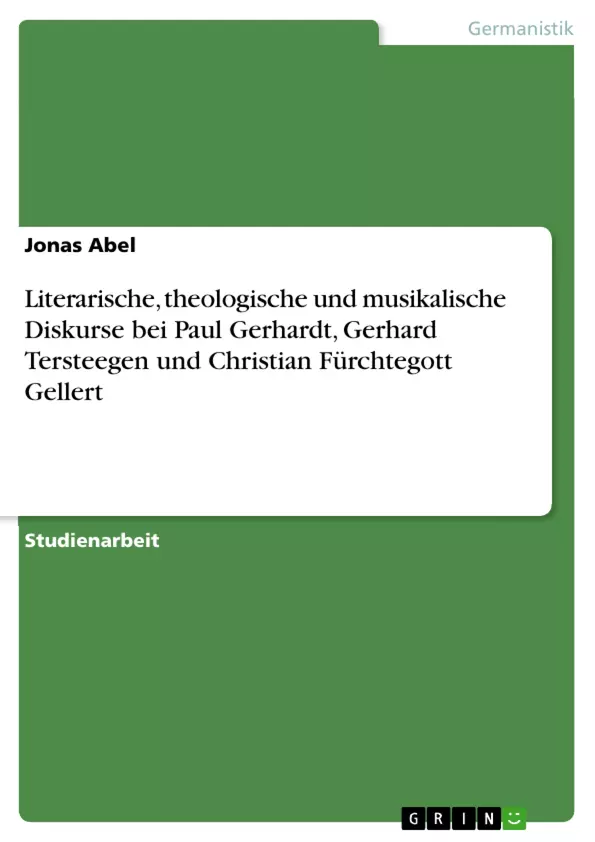Diese Untersuchung führt auf Grundlage dreier thematisch ähnlicher Gedichte eine Analyse auf literarischer, theologischer und musikalischer Ebene durch und vergleicht deren Ergebnisse in einem letzten Schritt. Zunächst wird dabei auf die Vorreden der Dichter in dem entsprechenden Werk, in welchem das jeweilige Gedicht erschien, Bezug genommen, um deren Ansichten über den Zweck der Dichtung darzulegen. Daneben wird näher auf die Problematik der Terminologie geistliches Lied und Kirchenlied eingegangen, um eine korrekte Verwendung im Rahmen dieser Arbeit zu gewährleisten. Eine einzelne Analyse literarischer und theologischer Elemente erübrigt sich durch deren gemeinsame Berührungspunkte, sodass der literarisch-theologische Diskurs eine Einheit bildet.
Neben inhaltlichen Aspekten des Gedichts werden theologische und poetologische Bestandteile der jeweiligen Lyrik genannt und erläutert. Dieser Diskurs wird mit einer Auseinandersetzung über das im jeweiligen Gedicht skizzierte Bild von Zufriedenheit fortgeführt: Was bedeutet Zufriedenheit im Sinne des Dichters? Des Weiteren erweist sich auch ein Blick auf die Erzählperspektive als gewinnbringend, denn durch diese mag es den Autoren gelingen, ihrem theologischen Anliegen noch besser Ausdruck zu verleihen.
Der musikalische Diskurs befasst sich mit einer ausgewählten Vertonung des Gedichts. Zunächst werden grundlegende Informationen zum musikalischen Erscheinungswerk und jeweiligen Komponisten gegeben, um dann in einem nächsten Schritt näher auf das Text-Musik-Verhältnis einzugehen. Es wird untersucht, ob und wie es gelingen kann, grundlegende Textaussagen der Dichtung musikalisch umzusetzen, darzustellen oder gar zu verstärken. Versucht das musikalische Werk den Text als kompositorische Grundlage möglichst genau umzusetzen oder ist der Komponist eher an einer freieren, kunstvolleren Ausgestaltung interessiert? Zusammengefasst zeigt der abschließende Vergleich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der lyrischen Dichtung der drei behandelten Autoren auf und lässt einen Wandel theologischer Glaubensinhalte und lyrischer Elemente deutlich werden. Auch der musikalische Diskurs findet Einzug in den Schlussteil, um an die anfangs erläuterte Terminologie von Kirchenlied und geistlichem Lied anzuknüpfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbemerkungen: Vorreden und Terminologie
- Literarisch-theologischer Diskurs
- Gerhard Tersteegen: «Die Seele entzieht sich der Mannigfaltigkeit»
- Grundlegende Beobachtungen zum Inhalt
- Elemente der Lyrik Tersteegens
- Zufriedenheit
- Erzählperspektive
- Paul Gerhardt: «Gib dich zufrieden und sei stille»
- Grundlegende Beobachtungen zum Inhalt
- Elemente der Lyrik Gerhardts
- Zufriedenheit
- Erzählperspektive
- Christian Fürchtegott Gellert: «Zufriedenheit mit seinem Zustande»
- Grundlegende Beobachtungen zum Inhalt
- Elemente der Lyrik Gellerts
- Zufriedenheit
- Erzählperspektive
- Gerhard Tersteegen: «Die Seele entzieht sich der Mannigfaltigkeit»
- Musikalischer Diskurs
- Georg Neumark: «Wer nun den lieben Gott läßt walten»
- Grundlegende Informationen zum Werk
- Text-Musik-Verhältnis
- Johann Sebastian Bach: «Geistliche Lieder und Arien >>
- Grundlegende Informationen zum Werk
- Text-Musik-Verhältnis
- Carl Philipp Emanuel Bach: «Herrn Professor Gellerts Geistliche Oden und Lieder>>
- Grundlegende Informationen zum Werk
- Text-Musik-Verhältnis
- Georg Neumark: «Wer nun den lieben Gott läßt walten»
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich einer detaillierten Analyse dreier Gedichte der im 17. und 18. Jahrhundert lebenden Dichter Paul Gerhardt, Gerhard Tersteegen und Christian Fürchtegott Gellert. Ziel ist es, die Besonderheiten ihrer Lyrik auf literarischer, theologischer und musikalischer Ebene zu untersuchen und diese Ergebnisse anschließend miteinander zu vergleichen.
- Die Bedeutung geistlicher Lyrik im 17. und 18. Jahrhundert
- Die Verbindung von literarischen, theologischen und musikalischen Diskursen in den Gedichten
- Der Begriff der Zufriedenheit in der Lyrik der drei Autoren
- Die Rolle der Erzählperspektive in der Vermittlung theologischer Botschaften
- Die Beziehung zwischen Text und Musik in der Vertonung der Gedichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die drei Autoren und ihre Gedichte vor und erläutert die Relevanz ihrer Werke im Kontext der Zeit. Sie verdeutlicht, dass die Lyrik der genannten Autoren die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen ihrer Zeit widerspiegelte und gleichzeitig Voraussetzungen für spätere literarische Entwicklungen schuf. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Analyse der Gedichte auf literarischer, theologischer und musikalischer Ebene sowie dem Vergleich der Ergebnisse.
Vorbemerkungen: Vorreden und Terminologie
Dieser Abschnitt behandelt die Vorreden der Dichter zu ihren Werken, in denen sie ihre poetischen Ansichten und die Bedeutung des geistlichen Liedes erläutern. Dabei wird insbesondere auf Christian Fürchtegott Gellerts Vorrede zu seinen "Geistliche[n] Oden und Lieder[n]" eingegangen. Er diskutiert die Rolle der geistlichen Lyrik in der Verbreitung von Glaubenswahrheiten und der Förderung von Frömmigkeit, betont aber auch die Notwendigkeit einer verständlichen und einprägsamen Sprache. Die Terminologie "geistliches Lied" und "Kirchenlied" wird im Hinblick auf ihre korrekte Verwendung im Rahmen der Arbeit diskutiert.
Literarisch-theologischer Diskurs
Dieser Abschnitt befasst sich mit den literarischen und theologischen Elementen der Gedichte von Gerhard Tersteegen, Paul Gerhardt und Christian Fürchtegott Gellert. Neben inhaltlichen Aspekten werden theologische und poetologische Bestandteile der Lyrik untersucht. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bild der Zufriedenheit in den Gedichten, wobei die Frage nach der Bedeutung dieses Begriffs im Sinne des jeweiligen Dichters im Vordergrund steht. Darüber hinaus wird die Rolle der Erzählperspektive betrachtet, die den Autoren dabei hilft, ihre theologischen Anliegen besser zu vermitteln.
Musikalischer Diskurs
In diesem Abschnitt werden ausgewählte Vertonungen der Gedichte untersucht. Zunächst werden grundlegende Informationen zu den Werken und den jeweiligen Komponisten geliefert, gefolgt von einer Analyse des Text-Musik-Verhältnisses. Es wird untersucht, inwieweit die musikalische Umsetzung die Textaussagen unterstützt, verstärkt oder gar eigenständig interpretiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind geistliche Lyrik, Kirchenlied, Zufriedenheit, Erzählperspektive, Text-Musik-Verhältnis, Paul Gerhardt, Gerhard Tersteegen, Christian Fürchtegott Gellert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Welche Dichter stehen im Zentrum der Untersuchung?
Die Untersuchung befasst sich mit Paul Gerhardt, Gerhard Tersteegen und Christian Fürchtegott Gellert.
Was ist der Unterschied zwischen "Kirchenlied" und "geistlichem Lied"?
Die Arbeit klärt diese Terminologie, um eine korrekte Verwendung im Kontext der Lyrik des 17. und 18. Jahrhunderts zu gewährleisten.
Wie wird das Thema "Zufriedenheit" in der Lyrik behandelt?
Jeder Dichter skizziert ein eigenes Bild von Zufriedenheit, das eng mit seinen theologischen Überzeugungen verknüpft ist.
Welche Rolle spielt die Musik in dieser Arbeit?
Der musikalische Diskurs analysiert Vertonungen der Gedichte (z.B. von J.S. Bach) und untersucht das Verhältnis zwischen Text und Komposition.
Welche Bedeutung hat die Erzählperspektive in den Gedichten?
Die Wahl der Perspektive hilft den Autoren, ihre theologischen Anliegen und Glaubensinhalte effektiver an den Leser zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Jonas Abel (Autor), 2016, Literarische, theologische und musikalische Diskurse bei Paul Gerhardt, Gerhard Tersteegen und Christian Fürchtegott Gellert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471395