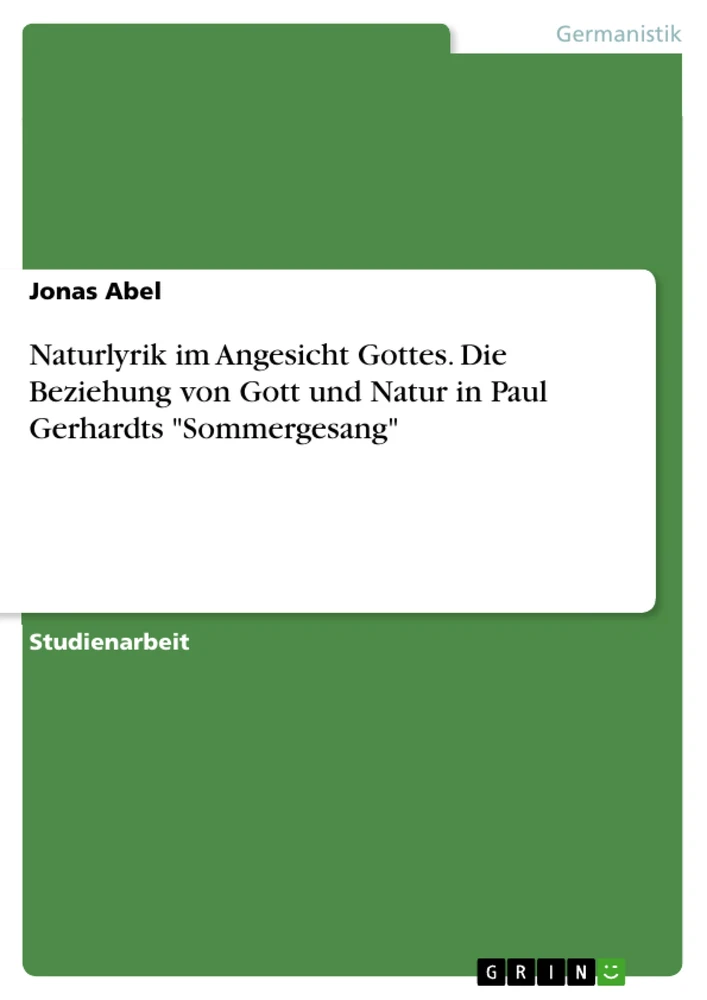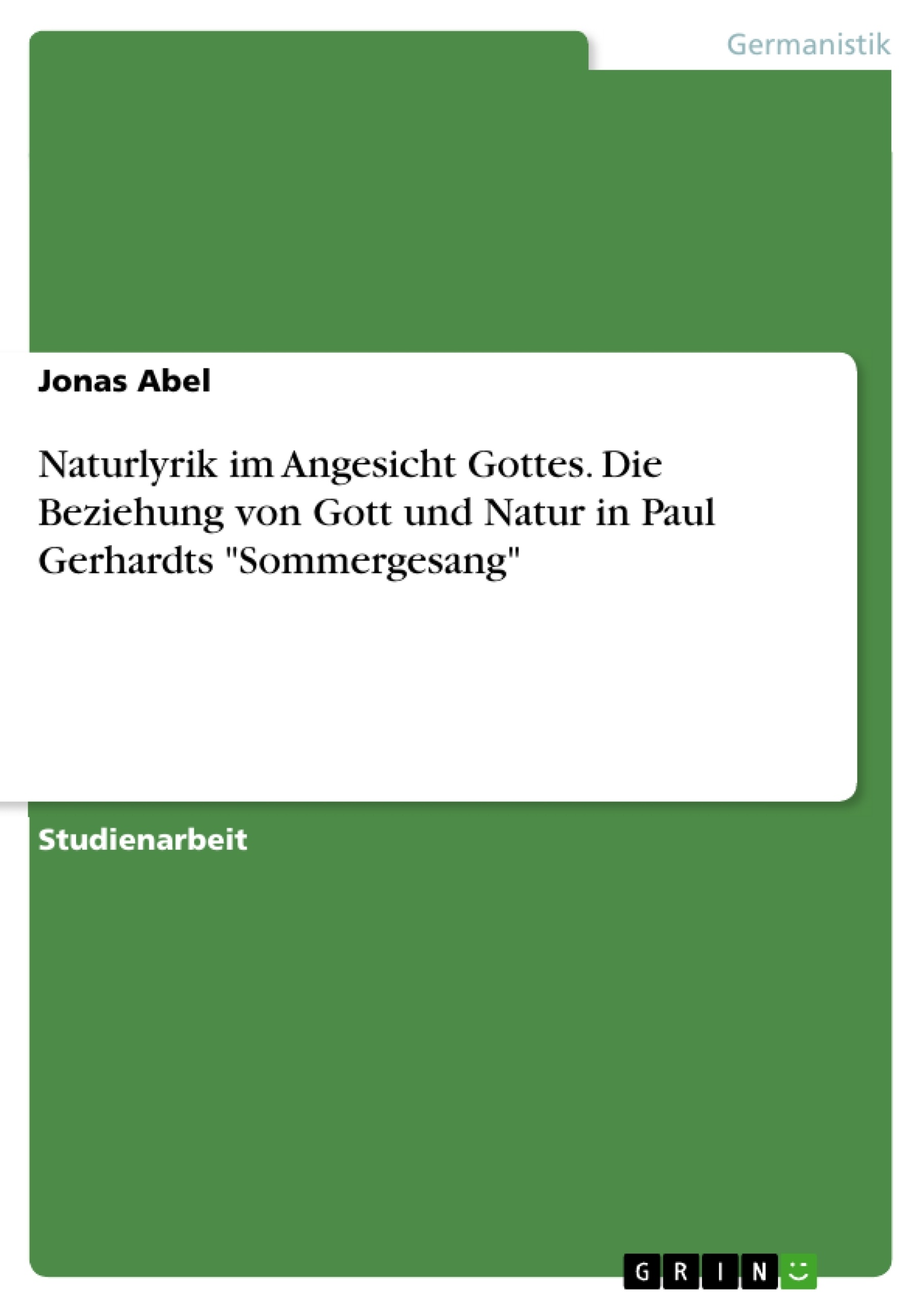Wie Paul Gerhardt das Naturbild zeichnet und wie genau Gott und die Natur in Beziehung treten, wird in dieser Arbeit untersucht. Dabei liegt der Sommergesang, das bekannteste der drei Lieder Gerhardts, im Fokus der Untersuchung.
Die Bedeutung Paul Gerhardts ist in der Literaturwissenschaft immer wieder herausgehoben worden. So bezeichnet diese ihn als "größten deutschen Kirchenlieddichter."
Aber nicht nur seine Bedeutung für den heutigen Gottesdienstgebrauch ist hervorzuheben, sondern es gilt, den Wert seiner Dichtung auch in unserem Alltag zu entdecken. Denn heutzutage wie damals ergreifen die Themen, die Gerhardt in seinen Liedern anspricht, die Menschen und sind deshalb immer noch – trotz und vielleicht auch aufgrund des immer geringer werdenden Stellenwertes, welches die Konfession und der Glaube im Leben des Menschen hat – als Sinnbild des Gottesglaubens und Gottvertrauens anzusehen.
Das Werk des Theologen lässt sich nach Eberhard von Cranach-Sichart durch die Zuordnung der einzelnen Lieder zu einer bestimmten Thematik wie zum Beispiel Lob und Dank, Kreuz und Trost oder zu speziellen, persönlichen Anlässen wie Christlicher Ehestand und Leichenpredigten untergliedern.
So findet das Themenfeld "Gott in der Natur" aber lediglich mit drei Gedichten bei Cranach-Sichart Berücksichtigung. In zahlreichen anderen Gedichten Gerhardts finden sich naturlyrische Elemente und diese können in der Folge unter dem Thema "Gott in der Natur" zusammengefasst werden. Alleine schon durch den biblischen Topos, der in fast jedem seiner Gedichte ganz deutlich zu spüren ist, sind Elemente der Naturlyrik nicht von der Hand zu weisen. Dieses Themenfeld eröffnet seine ganz eigene Thematik: Neben Gott selbst steht auch seine Schöpfung im Zentrum.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Entstehung, Rezeption und Gliederung des Textes
- 2.2 Aufforderung an das Herz
- 2.3 Gottes Schöpfung in der Natur
- 2.4 Mit dem Herzen singen
- 2.5 Der Himmlische Garten
- 2.6 Das Herz - zurück auf der Erde
- 2.7 Bitte um den Segen und Geist Gottes
- 3. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den „Sommergesang“ von Paul Gerhardt im Hinblick auf die Naturlyrik und die Darstellung Gottes in der Schöpfung. Ziel ist es, die Bedeutung des Gedichts im Kontext der religiösen Frömmigkeit und des theologischen Denkens Gerhardts zu beleuchten.
- Die Entstehung, Rezeption und Gliederung des Textes
- Die Darstellung der Natur als Gottes Schöpfung
- Die Rolle des Herzens und der Frömmigkeit in der Natur
- Der Bezug des Gedichts auf biblische Traditionen und Motive
- Die Bedeutung des „Sommergesangs“ im Kontext der protestantischen Naturlyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung Paul Gerhardts als Kirchenlieddichter und den Stellenwert seiner Dichtung im Alltag heraus.
Der Hauptteil befasst sich mit der Entstehung, Rezeption und Gliederung des „Sommergesangs“. Es werden verschiedene Interpretationen und Gliederungen des Gedichts aus lyrik- und theologiehistorischer Perspektive beleuchtet.
Die Kapitel 2.2 bis 2.7 befassen sich mit den einzelnen Strophen des Gedichts und analysieren die darin enthaltenen Themen wie die Aufforderung an das Herz, die Gottes Schöpfung in der Natur, das Singen mit dem Herzen, den himmlischen Garten, die Rückkehr des Herzens auf die Erde und die Bitte um den Segen Gottes.
Schlüsselwörter
Paul Gerhardt, Sommergesang, Naturlyrik, Gottes Schöpfung, Frömmigkeit, protestantische Kirchenlieddichtung, biblische Traditionen, Emblematik, Theologiegeschichte, Lyrikgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Paul Gerhardts "Sommergesang"?
Es ist eines der bekanntesten deutschen Kirchenlieder, das die Schönheit der Natur als unmittelbares Werk und Zeichen Gottes preist.
Wie wird die Beziehung zwischen Gott und Natur dargestellt?
Die Natur wird als "Buch der Schöpfung" gesehen, in dem der Mensch Gottes Güte und Allmacht erkennen und loben kann.
Welche Rolle spielt das "Herz" in Gerhardts Lyrik?
Das Herz ist der Ort der persönlichen Frömmigkeit; es wird aufgefordert, sich über die Schöpfung zu freuen und Gott aktiv Dank zu sagen.
Was symbolisiert der "Himmlische Garten"?
Die irdische Natur im Sommer dient als Vorgeschmack und Sinnbild für die ewige Seligkeit und den paradiesischen Zustand bei Gott.
In welche Kategorien lässt sich Gerhardts Werk unterteilen?
Sein Werk umfasst Lieder zu Lob und Dank, Kreuz und Trost sowie Naturlyrik, die alle tief in der biblischen Tradition verwurzelt sind.
- Citar trabajo
- Jonas Abel (Autor), 2015, Naturlyrik im Angesicht Gottes. Die Beziehung von Gott und Natur in Paul Gerhardts "Sommergesang", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471401