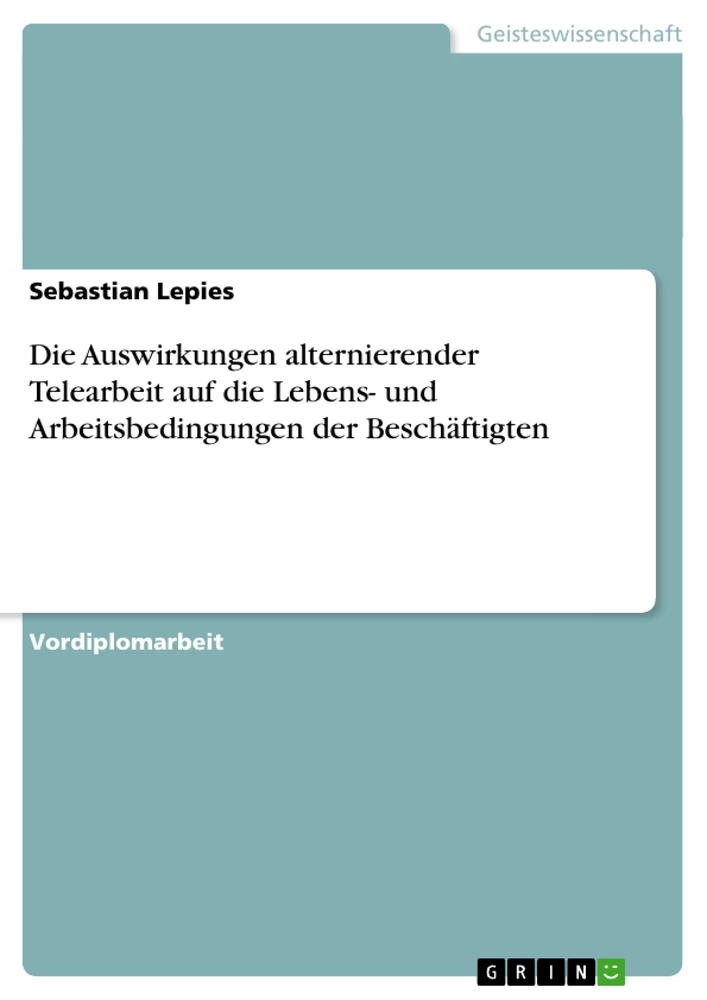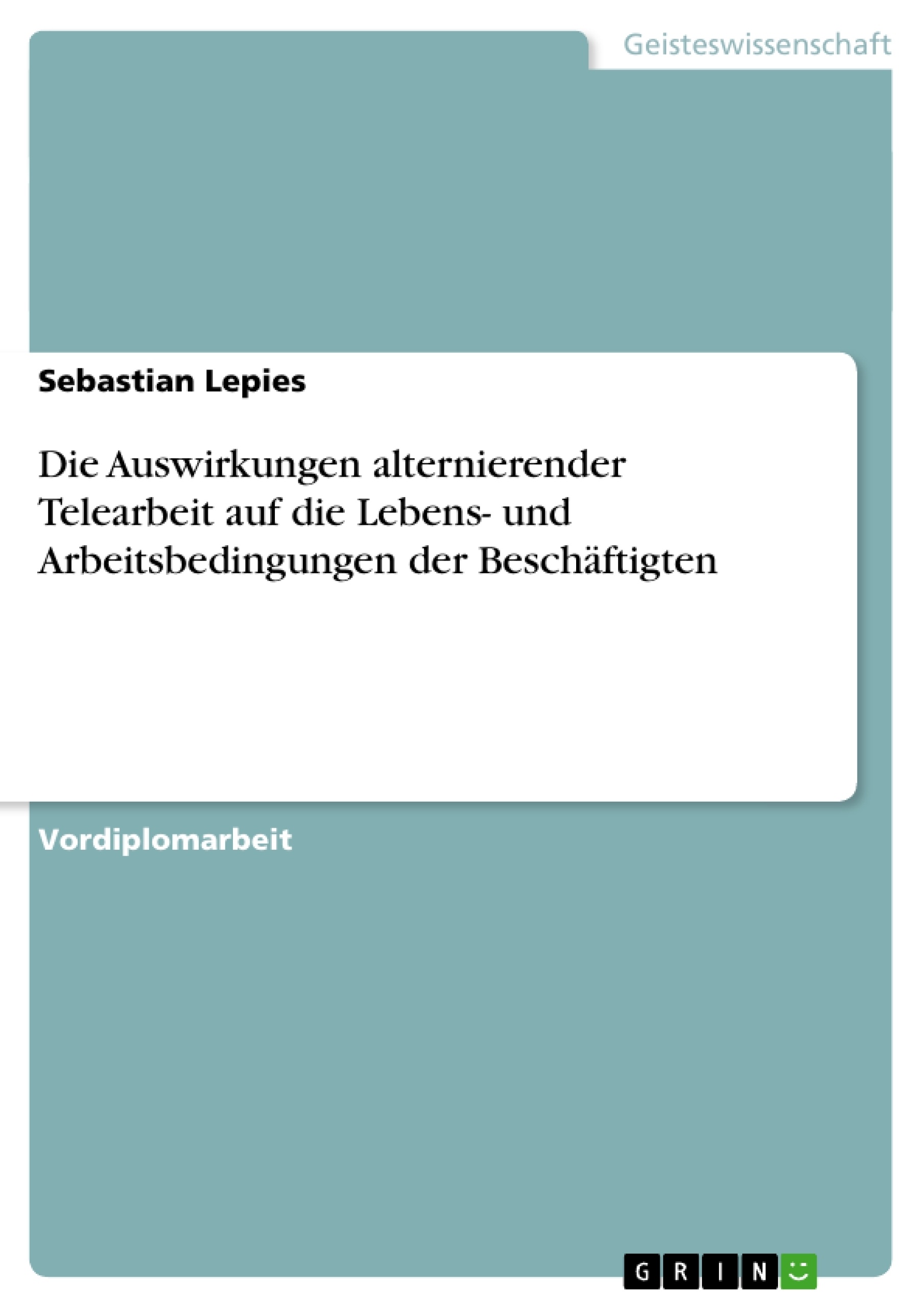Mit dem Übergang von der Industrie- in die Informationsgesellschaft vollziehen sich auch in der Arbeitswelt tief greifende Veränderungen. Die reine Produktionsarbeit verliert an Bedeutung, denn »bearbeitet« werden heute zunehmend Informationen. Im Jahr 1999 lag der Anteil der Beschäftigten, die an ihrem Arbeitsplatz überwiegend mit Informationen umgehen, bei 50% (vgl. Dostal 1999: 25). Verschiedentlich wird von einem vierten Sektor - dem Informationssektor - gesprochen (vgl. ebd.). Durch die weite Verbreitung von Computern und deren Vernetzung kann Arbeit völlig neu organisiert werden. Arbeit wird örtlich und zeitlich flexibel, denn „[d]er kostengünstige Austausch von Informationen auch über größere Entfernungen hinweg ist heute kein großes Problem mehr.“ (Voß 1998: 12). Durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK-Technologie) lässt sich die Arbeit aus dem betrieblichen Umfeld entkoppeln und es sind völlig neue Formen der Arbeitsorganisation möglich.
Geradezu als Prototyp der sich entwickelnden neuen Arbeitsformen gilt für manche die Telearbeit (vgl. Baukrowitz/Boes/Schwemmle 1999: 137). Telearbeit kann in vielen verschiedenen Formen auftreten, die sich stark voneinander unterscheiden. Eine dieser Formen ist die alternierende Telearbeit, auf die sich die öffentliche Diskussion zum Thema Telearbeit in den letzten Jahren besonders konzentriert hat (vgl. Reichwald et al. 1998: 79). Diese Telearbeitsform wird für zukunftsträchtig gehalten und steht im Zentrum öffentlicher Maßnahmen, die Telearbeit fördern sollen (vgl. Schat 2002: ). Angesichts dessen erscheint es sinnvoll, gerade die Auswirkungen der alternierenden Telearbeit auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu analysieren. Sie könnte zukünftig für viele Beschäftigte zu Normalität werden. Die Fragestellung dieser Arbeit lautet deshalb: Welche Chancen und welche Risiken ergeben sich durch die alternierende Telearbeit für die in dieser Arbeitsform Beschäftigten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff der Telearbeit und die Telearbeitsformen
- 2.1. Mobile Telearbeit
- 2.2. Telearbeit in Satelliten- oder Nachbarschaftsbüros
- 2.3. Teleheimarbeit
- 2.4. Alternierende Telearbeit
- 3. Die heutige Verbreitung der Telearbeit in Deutschland
- 4. Was ist das Neue an alternierender Telearbeit?
- 5. Chancen und Risiken alternierender Telearbeit
- 5.1. Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort
- 5.2. Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- 5.3. Veränderung der Geschlechterverhältnisse
- 5.4. Mangelnde Sozialkontakte alternierender Telearbeiter
- 5.4.1. Mangelnde soziale Kontakte im privaten Umfeld?
- 5.4.2. Mangelnde soziale Kontakte im beruflichen Umfeld?
- 5.5. Dequalifizierung
- 5.6. Mehrarbeit und Selbstausbeutung
- 5.7. Der Rechtsstatus alternierender Telearbeiter
- 6. Alternierende Telearbeit und kollektive Interessenvertretung
- 6.1. Die gewerkschaftliche Sichtweise im Zeitverlauf
- 6.2. Neue Balance zwischen Sicherheit und Flexibilität
- 6.3. Die Regulierung der häuslichen Arbeitszeiten
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen alternierender Telearbeit auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten. Sie untersucht sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser neuen Arbeitsform. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der empirischen Überprüfung der in der Literatur geäußerten, teilweise gegensätzlichen Meinungen.
- Definition und Abgrenzung alternierender Telearbeit von anderen Telearbeitsformen
- Aktuelle Verbreitung und empirische Forschungslücken zu alternierender Telearbeit in Deutschland
- Chancen und Risiken für Beschäftigte (Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Kontakte, Dequalifizierung, Mehrarbeit)
- Rolle der Gewerkschaften bei der Interessenvertretung und Regulierung
- Bewertung der bestehenden empirischen Datenlage und deren Limitationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der Arbeitswelt im Zuge der Informationsgesellschaft und die zunehmende Bedeutung von Informationsarbeit. Telearbeit, insbesondere die alternierende Form, wird als zukunftsweisende Arbeitsform vorgestellt. Die Arbeit untersucht die Chancen und Risiken alternierender Telearbeit für Beschäftigte anhand bestehender empirischer Studien, da diese bisher rar und oft auf kleine Stichproben beschränkt sind. Die Fragestellung der Arbeit wird präzise formuliert.
2. Der Begriff der Telearbeit und die Telearbeitsformen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionen von Telearbeit in der Literatur und benennt Gemeinsamkeiten, wie die räumliche Entkopplung vom Unternehmensstandort und den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. Es betont die Notwendigkeit, den Begriff der Telearbeit einzugrenzen, um den Fokus auf neue Formen der Arbeitsorganisation zu legen und andere Berufsgruppen, wie z.B. Außendienstmitarbeiter, auszuschließen. Die Kapitel erläutert die Unterschiede zwischen verschiedenen Telearbeitsformen und deren unterschiedlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten.
3. Die heutige Verbreitung der Telearbeit in Deutschland: Kapitel 3 thematisiert den aktuellen Stand der Verbreitung von alternierender Telearbeit in Deutschland und weist auf Defizite in der empirischen Forschung hin. Es wird die Schwierigkeit, eine repräsentative Datenbasis zu erhalten, hervorgehoben, da genaue Kenntnisse über die Grundgesamtheit der alternierenden Telearbeiter fehlen. Diese Limitationen werden als Ausgangspunkt für die Analyse der verfügbaren Daten aus kleineren Studien genannt.
4. Was ist das Neue an alternierender Telearbeit?: Dieses Kapitel untersucht, welche Beschäftigten tatsächlich eine neue Form der Arbeitsorganisation repräsentieren. Es differenziert zwischen verschiedenen Formen der Telearbeit und analysiert, welche davon als „neu“ im Sinne einer veränderten Arbeitsorganisation bezeichnet werden können. Es bildet somit die Grundlage für die detaillierte Analyse der Chancen und Risiken in den folgenden Kapiteln. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zu bereits existierenden Arbeitsmodellen.
5. Chancen und Risiken alternierender Telearbeit: Dieses Kapitel analysiert die in der Literatur diskutierten Chancen und Risiken alternierender Telearbeit, die von flexibleren Arbeitszeiten bis zu potenziellen negativen Auswirkungen auf soziale Kontakte und die Gefahr von Dequalifizierung und Selbstausbeutung reichen. Es werden verschiedene Facetten wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Veränderung der Geschlechterverhältnisse untersucht, wobei die Erkenntnisse empirischer Studien herangezogen und kritisch bewertet werden.
6. Alternierende Telearbeit und kollektive Interessenvertretung: Kapitel 6 fokussiert auf die Rolle der Gewerkschaften bei der Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Kontext alternierender Telearbeit. Es untersucht die gewerkschaftliche Sichtweise im Zeitverlauf und die Notwendigkeit einer neuen Balance zwischen Sicherheit und Flexibilität. Die Regulierung von Arbeitszeiten im häuslichen Umfeld wird als wichtiger Aspekt der Interessenvertretung herausgestellt. Die Kapitel analysiert den Schutz der Arbeitnehmer vor potenziellem Missbrauch neuer Arbeitsformen durch Unternehmen.
Schlüsselwörter
Alternierende Telearbeit, Telearbeit, Arbeitsorganisation, Informationsgesellschaft, Chancen, Risiken, Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Kontakte, Dequalifizierung, Mehrarbeit, Selbstausbeutung, Gewerkschaften, Interessenvertretung, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen alternierender Telearbeit auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen alternierender Telearbeit auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten. Sie untersucht sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser neuen Arbeitsform und beleuchtet die empirische Datenlage kritisch.
Welche Telearbeitsformen werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen verschiedenen Telearbeitsformen wie mobiler Telearbeit, Telearbeit in Satelliten- oder Nachbarschaftsbüros, Teleheimarbeit und alternierender Telearbeit. Der Fokus liegt auf der alternierenden Telearbeit und deren Abgrenzung zu anderen Formen.
Wie verbreitet ist alternierende Telearbeit in Deutschland?
Kapitel 3 behandelt die aktuelle Verbreitung von alternierender Telearbeit in Deutschland. Es wird jedoch auf die Schwierigkeit hingewiesen, eine repräsentative Datenbasis zu erhalten, da genaue Kenntnisse über die Grundgesamtheit der alternierenden Telearbeiter fehlen. Die Arbeit benennt die Limitationen der verfügbaren Daten aus kleineren Studien.
Was ist das Besondere an alternierender Telearbeit?
Kapitel 4 untersucht, welche Beschäftigtengruppen tatsächlich eine neue Form der Arbeitsorganisation repräsentieren. Es differenziert zwischen verschiedenen Formen der Telearbeit und analysiert, welche davon als „neu“ im Sinne einer veränderten Arbeitsorganisation bezeichnet werden können. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zu bereits existierenden Arbeitsmodellen.
Welche Chancen bietet alternierende Telearbeit?
Die Arbeit hebt Chancen wie die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine mögliche Veränderung der Geschlechterverhältnisse hervor.
Welche Risiken birgt alternierende Telearbeit?
Die Arbeit benennt Risiken wie den Mangel an sozialen Kontakten (sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld), die Gefahr der Dequalifizierung, Mehrarbeit und Selbstausbeutung. Der Rechtsstatus alternierender Telearbeiter wird ebenfalls als wichtiger Aspekt diskutiert.
Welche Rolle spielen Gewerkschaften?
Kapitel 6 befasst sich mit der Rolle der Gewerkschaften bei der Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Kontext alternierender Telearbeit. Es untersucht die gewerkschaftliche Sichtweise im Zeitverlauf, die Notwendigkeit einer neuen Balance zwischen Sicherheit und Flexibilität und die Regulierung der Arbeitszeiten im häuslichen Umfeld.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alternierende Telearbeit, Telearbeit, Arbeitsorganisation, Informationsgesellschaft, Chancen, Risiken, Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, soziale Kontakte, Dequalifizierung, Mehrarbeit, Selbstausbeutung, Gewerkschaften, Interessenvertretung, empirische Forschung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Der Begriff der Telearbeit und die Telearbeitsformen, Die heutige Verbreitung der Telearbeit in Deutschland, Was ist das Neue an alternierender Telearbeit?, Chancen und Risiken alternierender Telearbeit, Alternierende Telearbeit und kollektive Interessenvertretung, und Fazit.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Der HTML-Inhalt beinhaltet eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Inhalte jedes Abschnitts hervorhebt.
- Quote paper
- Sebastian Lepies (Author), 2005, Die Auswirkungen alternierender Telearbeit auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47188