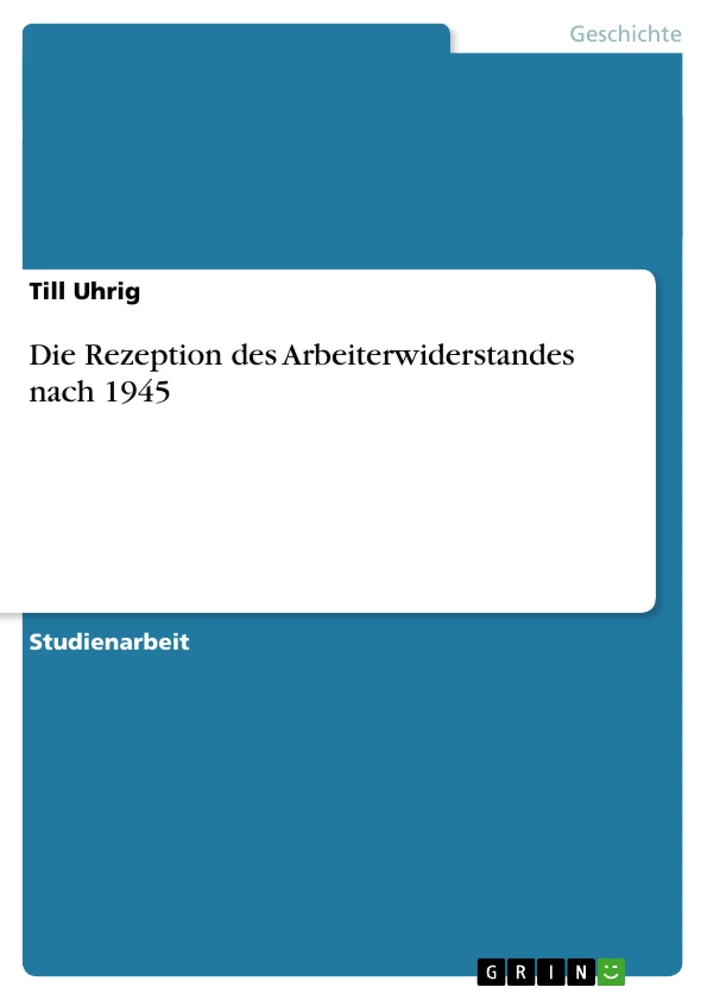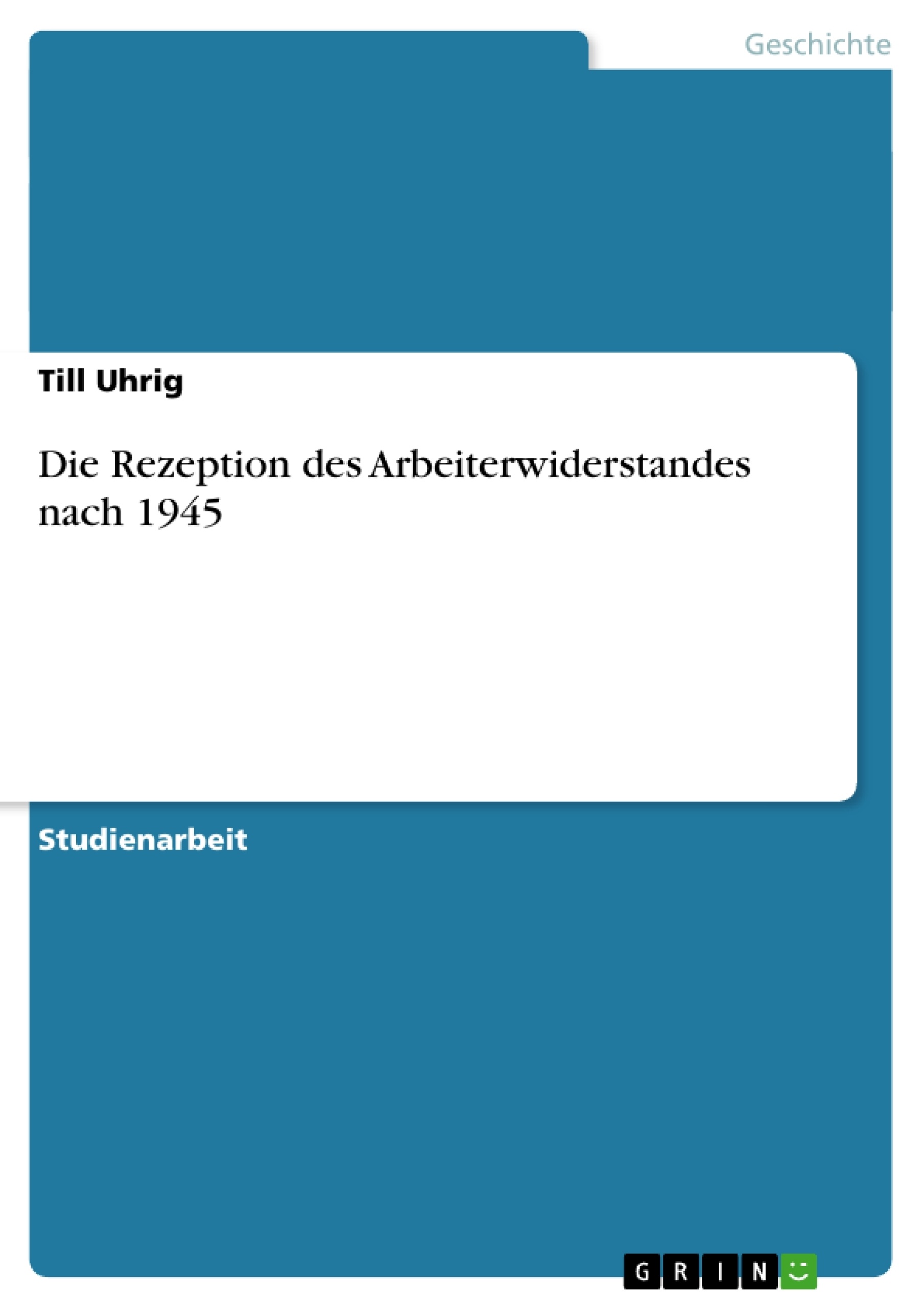1. Einleitung
Die Rezeptionsgeschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus ist eine Geschichte der Politisierung und Instrumentalisierung historischen Gedenkens. Hin und her pendelnd zwischen dem Stigma des Vaterlandsverrats und mystisch verklärter Heldenverehrung, zwischen Missachtung und höchster Medienpräsenz, war die Erinnerung an den Widerstand zahlreichen Deutungs- und Bedeutungswandlungen unterworfen. Wie kaum ein anderes Feld der Zeitgeschichte war die Widerstandsforschung immer wieder politischer Einflussnahme und Vereinahmung durch konkurrierende Interessengruppen ausgesetzt. Nicht zu unrecht spricht Peter Steinbach in diesem Zusammenhang von „Geschichtspolitik“. Die Idee des Widerstandes als solche und in viel größerem Maße die Tatsache der Existenz eines „anderen Deutschland“ in Opposition gegen das NS-Regime boten sowohl Angriffs- als auch Projektionsfläche für einige der großen gesellschaftlichen und politischen Debatten der Nachkriegszeit.
In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus vor allem auf Problemstellungen und Auseinandersetzung bei der Frage um die Würdigung des Arbeiterwiderstandes gelegt werden. Dabei wird der Begriff „Arbeiterwiderstand“ als politisch links motivierter Widerstand aus dem Umfeld der Arbeiterparteien SPD und KPD, sowie der Gewerkschaften verstanden.
Es soll untersucht werden, wieso dem Arbeiterwiderstand vergleichsweise lange Zeit eine angemessene Würdigung versagt blieb und welche Ereignisse und Entwicklungen zur publizistischen und historiographischen „Entdeckung“ des Arbeiterwiderstandes Ende der sechziger Jahre führten. Einer Übersicht über die Stationen des Erinnerns folgt ein Problematisierungsteil, der sich näher mit den Eigenheiten des Arbeiterwiderstands - wie etwa dem Problem des Exils - und deren Bedeutung für die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft beschäftigt. Außerdem soll eine gesamtdeutsche Perspektive eröffnet werden, indem der Einfluss der Systemkonkurrenz zwischen den beiden deutschen Staaten auf die Widerstandsrezeption untersucht wird.
Obwohl in den letzten Jahren eine Fülle von Literatur zum Thema Widerstand erschienen ist, so ist die Zahl der Veröffentlichungen zur Rezeptionsgeschichte doch begrenzt geblieben. Speziell zur Rezeptionsgeschichte des Arbeiterwiderstandes ist meist nur in Aufsatzform publiziert worden. Dennoch kann die Literatur ihm Rahmen dieser Arbeit als ausreichend gelten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhalt:
- II. Arbeit
- 1. Einleitung
- 2. Stationen des Erinnerns
- 2.1 Der Remer-Prozess
- 2.2 Der Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953
- 2.3 Widerstandsdefinitionen der Jurisdiktion
- 3. Problemstellung und Hindernisse in der Frage der Würdigung des linken Widerstandes
- 3.1 Systemkonkurrenz
- 3.1.1 SBZ DDR
- 3.1.2 BRD
- 3.2 Das Problem des Exils
- 3.3 Taktieren der politischen Linken
- 4. Wem gehört der Widerstand? - Die sechziger Jahre
- 4.1 Generationenkonflikt
- 4.2 Notstandsgesetzgebung und Studentenproteste
- 5. Veränderte Wahrnehmung und „Entdeckung“ des linken Widerstandes
- 5.1 Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung / Frankfurter Konferenz
- 5.2 Offizielles Gedenken
- 6. Schlussbetrachtung
- III. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeption des Arbeiterwiderstands nach 1945 und analysiert die Gründe, warum dieser lange Zeit keine angemessene Würdigung erfuhr. Der Fokus liegt auf den Ereignissen und Entwicklungen, die zur „Entdeckung“ des Arbeiterwiderstands Ende der sechziger Jahre führten.
- Die Politisierung und Instrumentalisierung des historischen Gedenkens
- Die Schwierigkeiten bei der Würdigung des linken Widerstands im Kontext der Systemkonkurrenz
- Das Problem des Exils und dessen Bedeutung für die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft
- Die Rehabilitierung des 20. Juli und dessen Einfluss auf die Wahrnehmung des Widerstands
- Die Bedeutung des Arbeiteraufstands vom 17. Juni 1953 für die Widerstandsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Diese Einleitung stellt die Rezeptionsgeschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus als eine Geschichte der Politisierung und Instrumentalisierung historischen Gedenkens dar. Sie erläutert, wie der Widerstand zwischen dem Stigma des Vaterlandsverrats und mystifizierter Heldenverehrung changierte und zahlreichen Deutungs- und Bedeutungswandlungen unterworfen war.
- Kapitel 2: Stationen des Erinnerns
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte des Widerstandsgedenkens, insbesondere im Kontext des 20. Juli 1944. Es beschreibt die anfängliche Verdrängung des Themas und die schrittweise Rehabilitation des 20. Juli im Laufe der fünfziger und sechziger Jahre.
- Kapitel 2.1: Der Remer-Prozess
Der Remer-Prozess wird als ein Beispiel für eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit Problemen und Eigenschaften von Widerständigkeit dargestellt. Die Verhandlung beleuchtet die schwierige Position der Angehörigen des 20. Juli und ihre Rolle in der Nachkriegsgesellschaft.
- Kapitel 2.2: Der Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953
Der Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR wird als ein Ereignis beschrieben, das die Realität bestehender totalitärer Systeme vor Augen führte und die Aktualität des Widerstandsbegriffs verdeutlichte.
- Kapitel 3: Problemstellung und Hindernisse in der Frage der Würdigung des linken Widerstandes
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Herausforderungen, die der Würdigung des Arbeiterwiderstands im Nachkriegsdeutschland im Weg standen. Es werden die systembedingten Unterschiede zwischen DDR und BRD, das Problem des Exils und die taktische Zurückhaltung der politischen Linken analysiert.
- Kapitel 4: Wem gehört der Widerstand? - Die sechziger Jahre
Dieses Kapitel untersucht die Debatte um den Arbeiterwiderstand im Kontext des Generationenkonflikts und der Studentenproteste der sechziger Jahre. Es beleuchtet die Rolle des Arbeiterwiderstands in der gesamtdeutschen Debatte.
- Kapitel 5: Veränderte Wahrnehmung und „Entdeckung“ des linken Widerstandes
Dieses Kapitel befasst sich mit der Veränderung der Wahrnehmung des Arbeiterwiderstands Ende der sechziger Jahre. Es analysiert die Rolle des „Studienkreises zur Erforschung und Vermittlung“ und der „Frankfurter Konferenz“ sowie die Entwicklung des offiziellen Gedenkens.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Arbeiterwiderstand, Rezeption, Erinnerungskultur, 20. Juli 1944, Remer-Prozess, Arbeiteraufstand 17. Juni 1953, Systemkonkurrenz, Exil, politische Linke, Generationenkonflikt, Studentenproteste, Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung, Frankfurter Konferenz, offizieles Gedenken.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde der Arbeiterwiderstand nach 1945 lange nicht gewürdigt?
Gründe waren die Politisierung durch die Systemkonkurrenz im Kalten Krieg, das Stigma des Vaterlandsverrats und die Fokussierung auf den militärischen Widerstand des 20. Juli.
Was versteht man unter dem Begriff "Arbeiterwiderstand"?
Darunter wird der politisch links motivierte Widerstand aus dem Umfeld von SPD, KPD und den Gewerkschaften gegen das NS-Regime verstanden.
Welche Bedeutung hatte der Remer-Prozess für die Widerstandsrezeption?
Der Prozess war eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Rechtmäßigkeit von Widerstand und trug zur schrittweisen Rehabilitation der Widerstandskämpfer bei.
Wie beeinflussten die Studentenproteste der 60er Jahre das Gedenken?
Der Generationenkonflikt und die Proteste führten zu einer publizistischen und historiographischen "Entdeckung" des linken Widerstands als alternatives Vorbild.
Welches Problem stellte das Exil für die Würdigung dar?
Widerständler im Exil wurden in der Nachkriegsgesellschaft oft misstrauisch beäugt oder als "Verräter" diskreditiert, was eine angemessene Ehrung erschwerte.
- Arbeit zitieren
- Till Uhrig (Autor:in), 2005, Die Rezeption des Arbeiterwiderstandes nach 1945, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47264