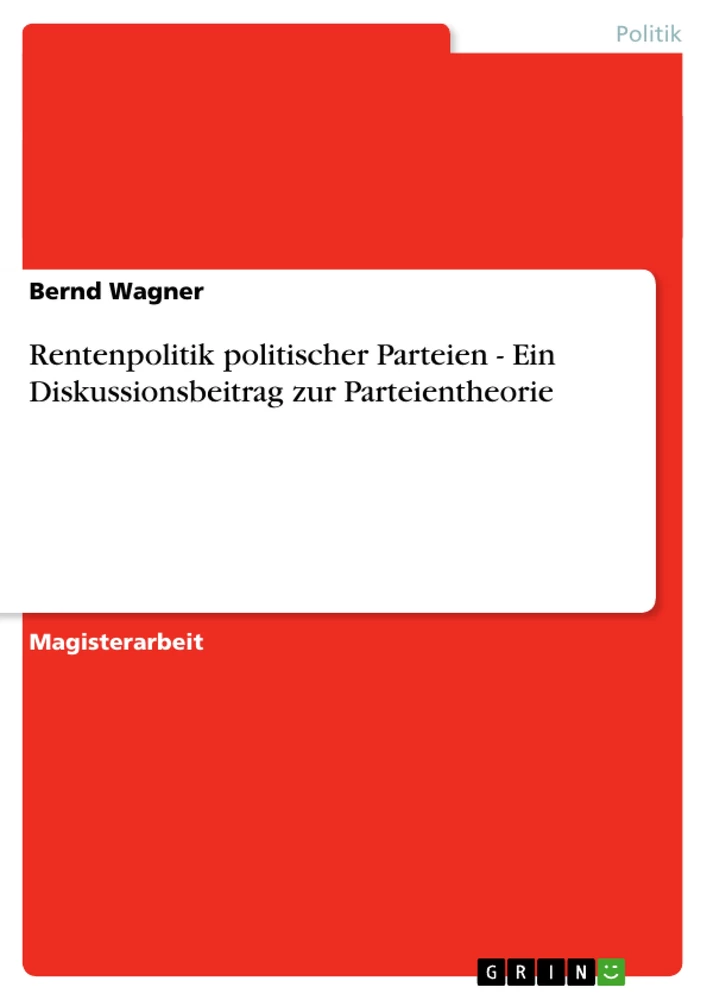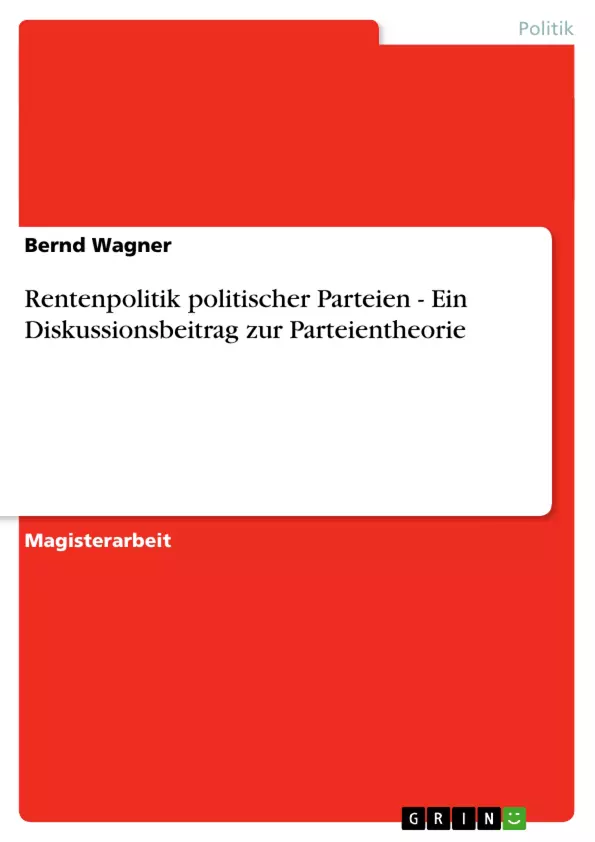Die Studie untersucht den Informationsgehalt und die Stichhaltigkeit von Theorien über politische Parteien am Fallbeispiel der Rentenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland von 1987 bis 2002. Aus den verbreitetsten Parteientheorien werden Hypothesen abgeleitet, deren Validität an den empirischen Beobachtungen im Politikfeld Rentenpolitik geprüft wird. Die besondere Beschaffenheit des Politikfelds führt dabei zu überraschenden Ergebnissen.
Das Politikfeld Rentenpolitik liefert aus verschiedenen Gründen aufschlussreiche Ergebnisse. Erstens handelt es sich um eine sehr bedeutende Materie. Die Rentenversicherung gilt als das legitimatorische Zentrum des deutschen Sozialstaats. Veränderungen in der Ausgestaltung sind Veränderungen in seinem Kernbestand und seinen Selbstverständnis. Zweitens fanden im Untersuchungszeitraum interessante Wandlungsprozesse der Rahmenbedingungen, des Parteienhandelns und der Parteiorganisation statt. Und drittens müssen die Parteien vor allem durch den demographischen Wandel in der Rentenpolitik außergewöhnliche Herausforderungen meistern.
Die Auswahl der Parteientheorien leht sich an den renommierten Parteienforscher Elmar Wiesendahl an. Er hat in seinem Buch „Parteien und Demokratie“ (1980) eine perspektivengebundene Typologie der Parteientheorien vorgeschlagen. Die Studie stellt im ersten Schritt die drei paradigmatischen Denkansätze vor, auf denen die Parteienforschung laut Wiesendahl beruht. In seinem neueren Werk „Parteien in Perspektive“ (1998) macht der Autor für die Gegenwart nur noch zwei theoretische Hauptströmungen aus, die aus den Paradigmen hervorgegangen sind. Im zweiten Schritt werden deshalb zwei prominente Vertreter dieser Richtungen, die funktionalistische Parteientheorie nach Beck und Sorauf und der Rational Choice-Ansatz von Strøm und Müller, vorgestellt und erläutert, wie ihre Konzepte für die Überprüfung in der Rentenpolitik operationalisiert werden. Auf die aus dem dritten Paradigma hervorgegangenen Konflikttheorien wird am Beispiel von Stöss nur am Rande eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Paradigmatische Grundlagen der Parteientheorie
- Das Integrationsparadigma
- Das Konkurrenzparadigma
- Das Transmissionsparadigma
- Ausgewählte Parteientheorien
- Die funktionalistische Parteientheorie nach Beck und Sorauf
- Rational-choice-orientierte Parteientheorie nach Strøm/Müller
- Der konflikttheoretische Ansatz von Richard Stöss
- Exkurs: Parteien in der sozialpolitischen Literatur
- Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland
- Grundzüge
- Entwicklung von 1983 bis 2004
- Implementation: Parteientheorien in der Rentenpolitik
- Parteien in der Rentenpolitik aus Rational Choice-Sicht
- Funktionalistische Sichtweise der Parteien in der Rentenpolitik
- Rentenpolitik aus konflikttheoretischer Perspektive
- Bewertung
- Rational-Choice-Theorie
- Funktionalistische Parteientheorie
- Konflikttheorie
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Informationsgehalt von Theorien über politische Parteien und untersucht, wie diese Theorien auf die Rentenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von drei prominenten Parteientheorien: der funktionalistischen, der rational-choice-orientierten und der konflikttheoretischen Perspektive.
- Bewertung der Gültigkeit und Aussagekraft verschiedener Parteientheorien
- Analyse der Rentenpolitik in Deutschland im Kontext von Parteientheorien
- Empirische Überprüfung der Annahmen und Aussagen der Theorien durch Fallstudien
- Identifizierung von Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze
- Diskussion der Möglichkeiten einer gemeinsamen Anwendung der Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Parteientheorie und die Notwendigkeit einer empirischen Überprüfung der verschiedenen Ansätze dar. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, einen Beitrag zur Diskussion über den Gehalt von Theorien über politische Parteien zu leisten.
- Paradigmatische Grundlagen der Parteientheorie: Dieses Kapitel erläutert die drei paradigmatischen Denkansätze, auf denen die Parteienforschung laut Wiesendahl beruht: Das Integrationsparadigma, das Konkurrenzparadigma und das Transmissionsparadigma.
- Ausgewählte Parteientheorien: Dieses Kapitel stellt zwei prominente Vertreter der funktionalistischen und rational-choice-orientierten Parteientheorie vor und erläutert, wie deren Konzepte für die Überprüfung in der Rentenpolitik operationalisiert werden können. Der konflikttheoretische Ansatz von Stöss wird ebenfalls kurz beleuchtet.
- Exkurs: Parteien in der sozialpolitischen Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Parteientheorien in der Sozialpolitikforschung.
- Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Gestalt und die Geschichte der Rentenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, inklusive einer Darstellung der wichtigsten Entwicklungen von 1983 bis 2004.
- Implementation: Parteientheorien in der Rentenpolitik: Dieses Kapitel untersucht das Handeln, die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse der Parteien in der Rentenpolitik anhand der vorgestellten Parteientheorien und analysiert, inwieweit sich die Beobachtungen mit den Hypothesen der Theorien erklären lassen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Themen wie die Parteientheorie, Rentenpolitik, Deutschland, funktionalistische Parteientheorie, Rational-Choice-Theorie, Konflikttheorie und die empirische Validierung von Theorien. Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, inwieweit verschiedene Theorien über politische Parteien das Handeln von Parteien in einem konkreten Politikfeld, der Rentenpolitik, erklären können.
- Citation du texte
- Bernd Wagner (Auteur), 2004, Rentenpolitik politischer Parteien - Ein Diskussionsbeitrag zur Parteientheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47318